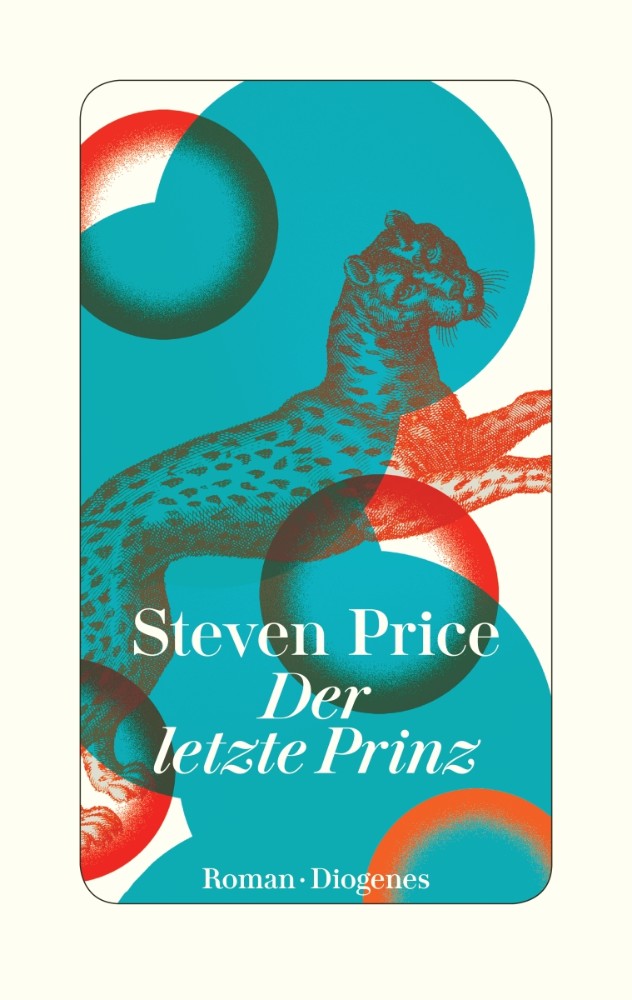Es gibt Bücher, da nimmt einen ein einziger Satz so gefangen, dass man ihn nicht mehr vergisst, weil sich in ihm der ganze Gehalt einer ehrlich erzählten und tief empfundenen Geschichte noch einmal aufs Äußerste sprachlich verdichtet.
So schwebt seit vielen Jahren der Schlusssatz von Hemingways A farewell to arms in meinem Gedächtnis, in dem sich hinter seiner sprachlichen Knappheit, ja fast Beiläufigkeit, eine tiefe Desillusion verbirgt; all das Unsagbare, was der Protagonist, der nun auch noch seine Liebste und das Baby bei der Geburt verloren hat, im Ersten Weltkrieg durchgemacht hat, kulminiert in dem scheinbar lapidaren Satz: „And he was walking back to the hotel in the rain.“
Auch in Steven Price‘ beeindruckendem neuen Roman Der letzte Prinz, in dem der Autor den Entstehungsprozess von Giuseppe Tomasi di Lampedusas erst postum erschienenem und berühmt gewordenem Roman Der Leopard und das Leben seines Autors in einer sehr poetischen Romanbiographie nachbildet, erklingt gegen Ende ein solcher Satz, den man wieder und wieder lesen muss:
Ein dunkler, sehr schöner Morgen ging auf. Seine Augen tränten, und er versuchte, sie offenzuhalten, die Welt so lange zu sehen, wie er konnte. Er lauschte dem Atem seiner Frau. Das schwarze Buch auf dem Knie seiner Frau glänzte. Wie seltsam, dachte er, dass er das Buch nicht kannte, nicht wusste, was drinstand.
Steven Price, Der letzte Prinz
Es ist sein eigenes Buch, sein Lebenswerk, das der sterbende Schriftsteller nicht mehr erkennt. Gleichwohl hier eine poetische Versöhnlichkeit durchschimmert, der Hemingway sich verwehrt, ist den beiden Sätzen doch der melancholische Ton gemeinsam, der auch der Stimmung des gesamten Buches von Steven Price entspricht. Am Beispiel des Lebens eines Schriftstellers, der über Jahre und in einem fortdauernden Kraftakt an einem einzigen Roman schreibt, in dem er die Geschichte seiner Vorfahren und letztlich auch seine eigenen Erfahrungen verarbeitet, und dessen Veröffentlichung er dann nicht einmal mehr erlebt, verbildlicht Steven Price ohne pathetische Hilfsmittel sehr glaubwürdig die ganze „conditio humana“. Es gelingt ihm, Emotionen durchscheinen zu lassen, ohne sie sprachlich zu forcieren; vielmehr liegt der Erzählung ein nachdenklicher, oft auch zweifelnder Ton zugrunde, der den Prozess des Sich-Erinnerns der Romanfigur ebenso auszeichnet wie die behutsame biographische Herangehensweise des Autors.
Während die Erzählgegenwart den Schriftsteller in seinen späten Jahren zeigt, werden kapitelweise Rückblicke eingeschoben, die bis in Giuseppe Tomasi di Lampedusas Kindheit zurückreichen. Eindrücklich wird erzählt, wie er seine schwere Lungenkrankheit lange Zeit vor seiner Frau verbirgt, weil er nicht weiß, wie er ihr diese schicksalhafte Nachricht vermitteln soll. Hier spiegelt sich wohl auch eine viel grundsätzlichere Schwierigkeit: diejenige nämlich, für das, was einen innerlich ausmacht, was einen berührt, was einem Angst macht, einen angemessenen Ausdruck zu finden. So nimmt auch das sich schier endlos in die Länge ziehende, an seinen Kräften zehrende Schreiben Lampedusas an seinem einzigen Roman, den er immer wieder umschreibt, einen großen, ja eigentlich zentralen Raum in der Erzählung ein. Der Leopard ist seine Lebensaufgabe, eine Herausforderung, die höchste Glücksgefühle und tiefste Unsicherheit bereithält.
Der Roman enthält somit durchgehend die Spannung einer doppelten Ebene, die erzähltechnisch überzeugend konstruiert ist: Price schreibt eine Romanbiographie über den letzten Fürsten der Lampedusa, indem er erzählt, wie dieser seinerseits in Romanform vom letzten Fürsten des sizilianischen Geschlechts erzählt, dessen Nachgeborener er ist. Nicht erstaunlich also, dass sich immer wieder Parallelen zwischen Price‘ Romanhelden Giuseppe di Lampedusa und Lampedusas eigenem Romanhelden andeuten, den beiden alternden Prinzen, die auf ganz unterschiedliche Weise doch beide eine im Verschwinden begriffene Welt einzufangen versuchen und zugleich an der Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens zweifeln. Und so wie der alte Fürst Salina aus Der Leopard den Machtverlust in Folge der politischen Umwälzungen im Italien der Jahrhundertwende zu spüren bekommt, erlebt der nachgeborene Schriftsteller, der diesen geschichtlichen Einschnitt in Romanform verewigt hat, durch seine Krankheit und den herannahenden Tod seinerseits eine Form wachsender Ohnmacht — ein gelungenes Ineinander von Geschichte und Individuum.
In dem oben zitierten Satz zeigt sich all dies und vor allem die Erzählkunst des Autors, der für mein ästhetisches Empfinden in seinem Roman genau den richtigen Ton zwischen Nachdenklichkeit und Emotion zu treffen versteht, auch wenn es um einen so intimen, so grausamen und zugleich sublimierten Moment wie das Sterben eines Menschen geht.
Bibliographische Angaben
Steven Price: Der letzte Prinz, Diogenes (2020)
Aus dem Englischen von Malte Krutzsch
ISBN: 9783257071436
Bildquelle
Steven Price, Der letzte Prinz
© Diogenes Verlag AG, Zürich (CH)