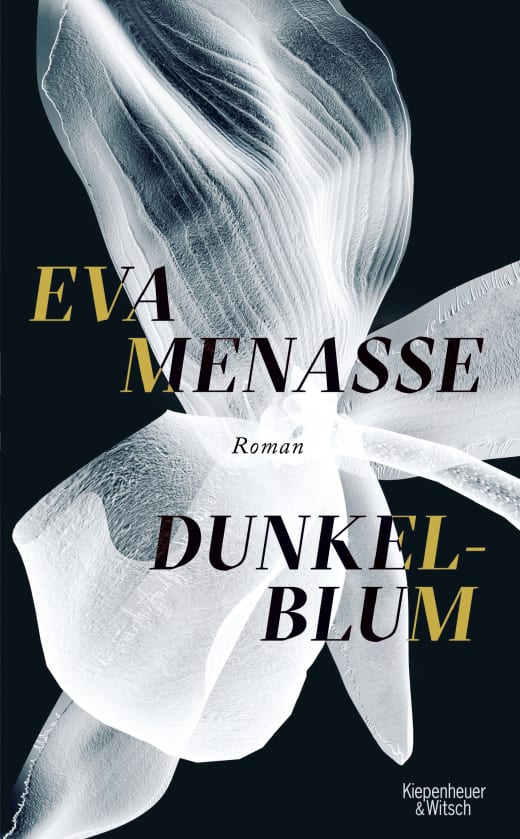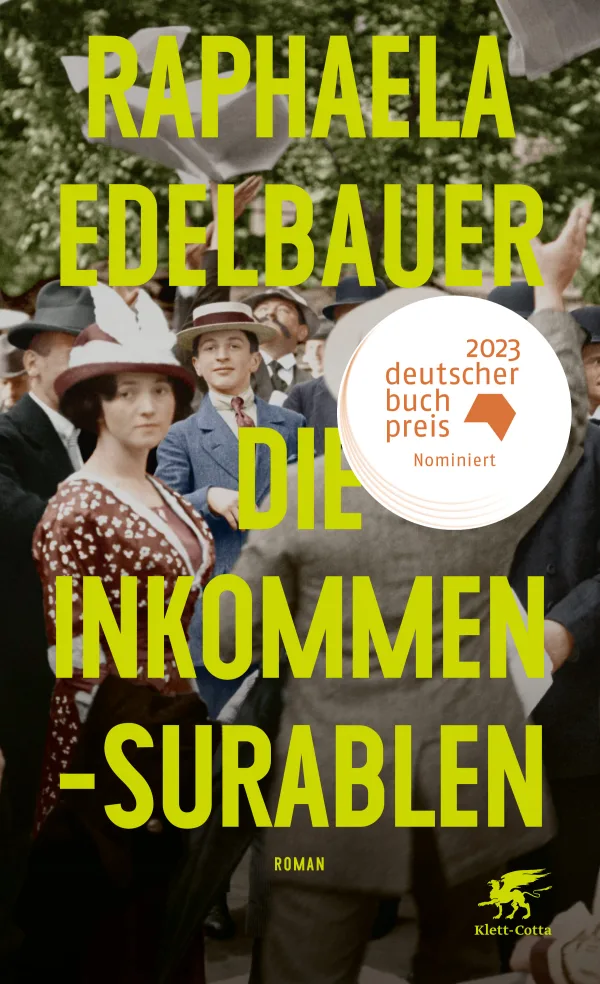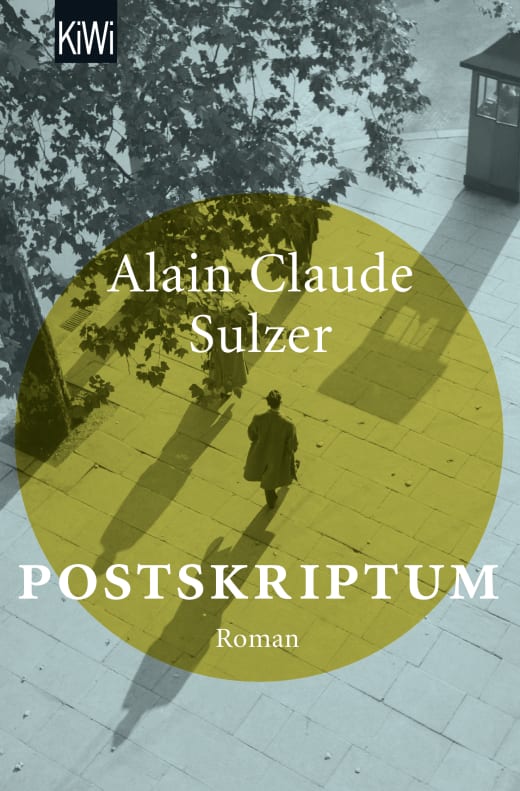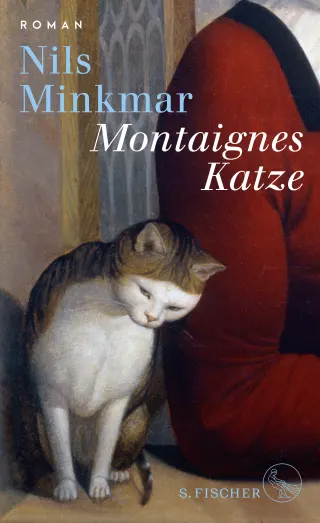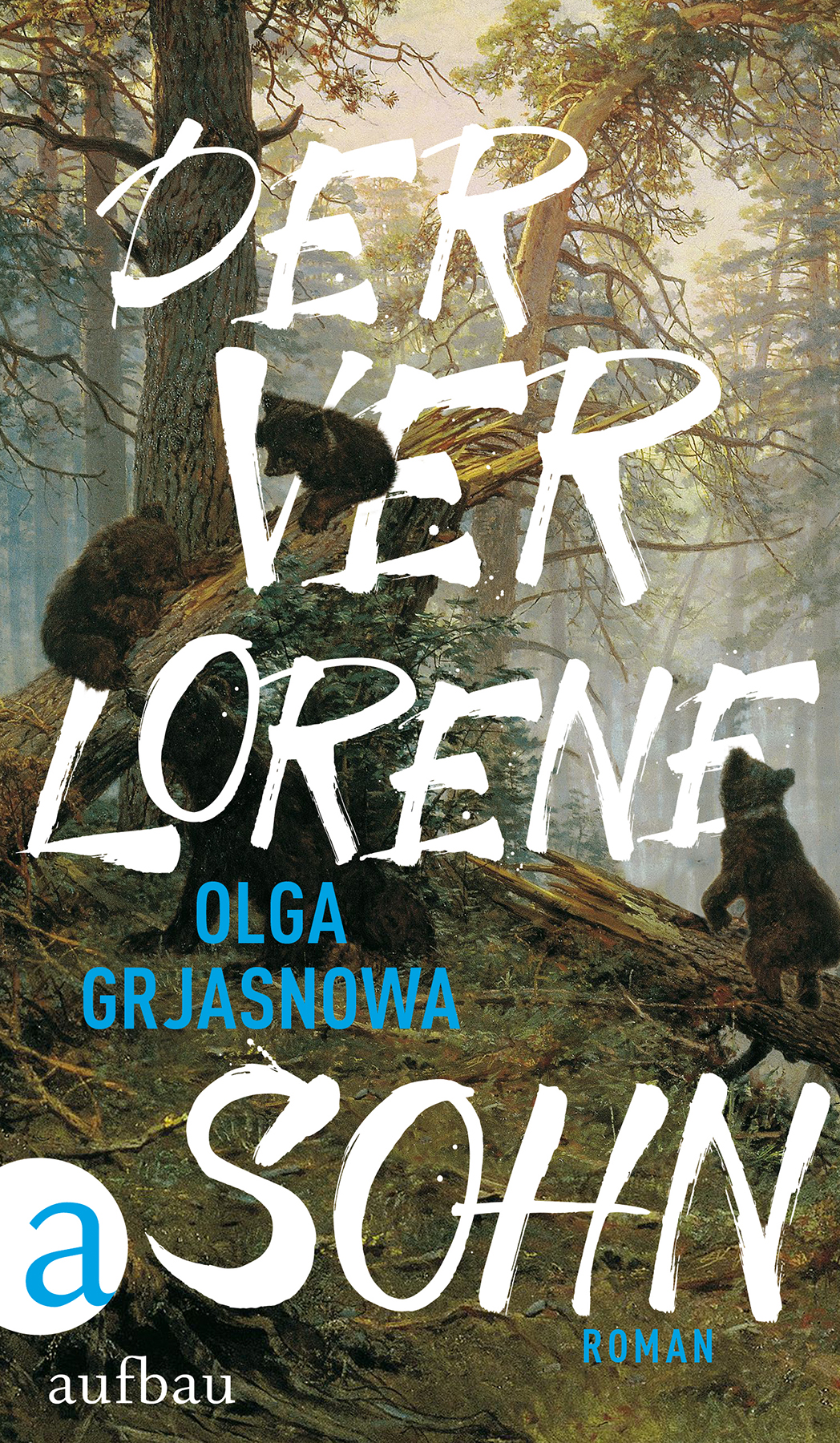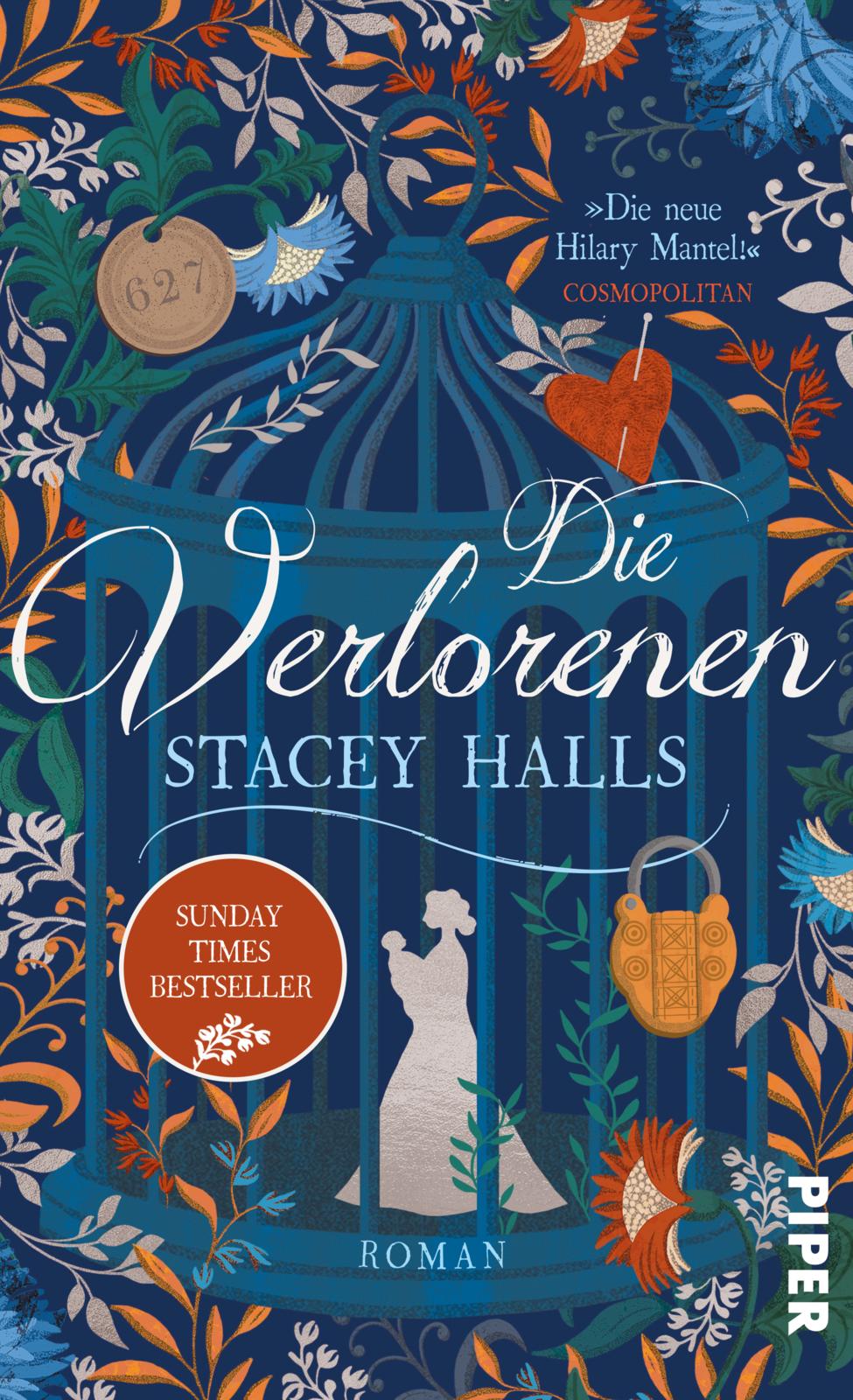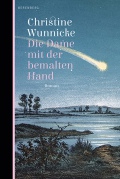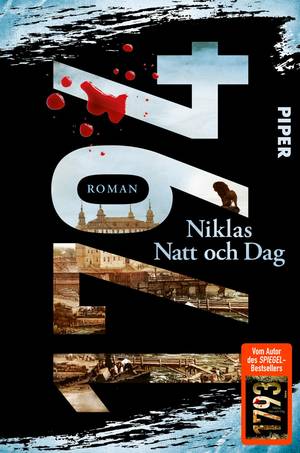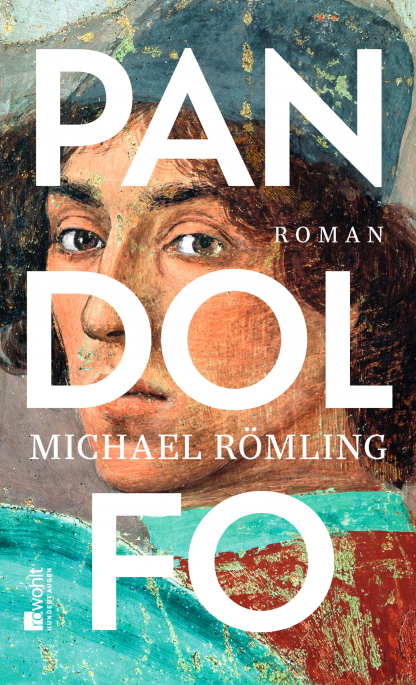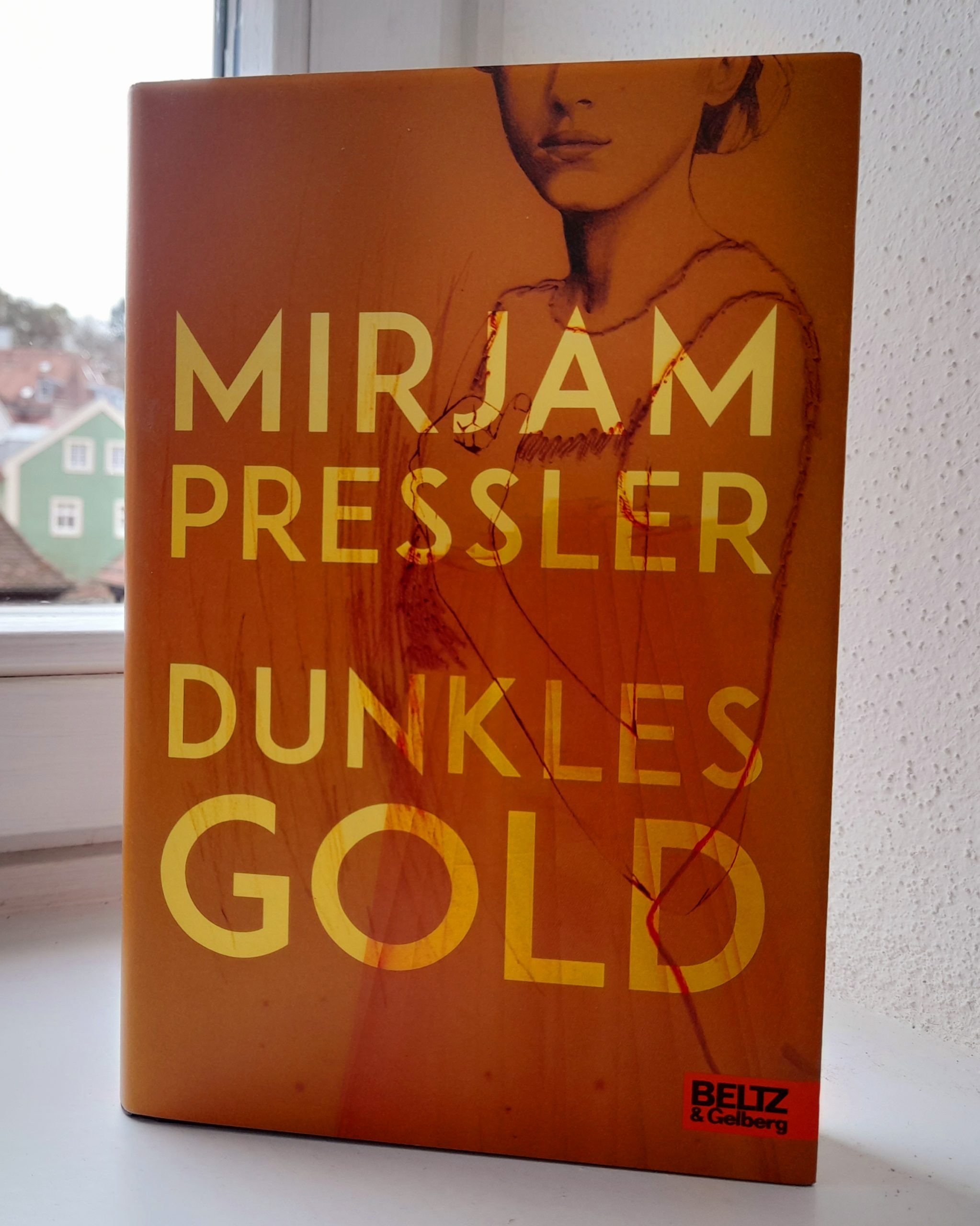Ein historischer Roman trifft immer dann ins Herz meiner Leseerwartung, wenn er, und das eben meistens jenseits der üblichen Genregrenzen, Geschichte in der Literatur erfahrbar und auf eine Weise begreifbar macht, die eine noch so genaue rein wissenschaftliche Beschreibung vielleicht nicht erreichen könnte. Raphaela Edelbauer ist mit ihrem Roman, der die bedrohlich flirrende Zeit kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in einer vielschichtigen Fiktion erfasst, genau das gelungen. Sie verleiht der Hingerissenheit und Zerrissenheit des Endes einer Epoche, ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit, eine literarische Gestalt, die Gesellschafts-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte vereint und dabei auch noch so spannend erzählt ist, dass ich das Buch kaum beiseite legen konnte.
Es passiert auch wirklich eine ganze Menge in diesen gerade mal ein, zwei Tagen, an denen sich die Romanhandlung in großer Dichte und Schnelligkeit abspielt: Schlägereien, Rausch- und Traumerfahrungen, zahlreiche pointierte intellektuelle Dialoge, in denen von Traumdeutung, Psychoanalyse, Suggestion über Mathematik, Philosophie bis zur Diplomatie und zur Musik viele Ebenen des kulturellen, psychischen und politischen Lebens der Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert aufgerufen und zueinander in Beziehung gesetzt werden, und nicht zuletzt auch eine turbulente Freundschaft, so intensiv und emotionsgeladen, wie die kurze Zeitspanne, in der sie entsteht. Um das zentrale Dreigespann der handelnden Personen kurz vorzustellen: Klara, eine hochbegabte Mathematikdoktorandin aus ärmlichsten Verhältnissen, Hans, ein belesener Pferdeknecht aus Tirol, der einen Tag vor Ausbruch des Krieges vom Land in die Großstadt Wien gelangt und auf den beide, die Stadt und die Doktorandin, eine so faszinierende wie einschüchternde Wirkung haben, und schließlich der aus einem reichen und adligen Elternhaus stammende Adam, der gegen den Willen seiner Eltern ganz für seine Leidenschaft, die Musik, zu leben versucht, von dem jedoch erwartet wird, dass er, der Offizierstradition seiner Familie folgend, in den Krieg zieht, sobald dazu aufgerufen wird. Diese drei entwickeln, so verschiedener Herkunft sie auch sind, in der kurzen Zeit, die ihnen beschieden ist, ein besonderes, ein eigenwilliges Band der Freundschaft. Sie begegnen sich, und diese Kontingenz begründet den philosophischen Kern der alles andere als kontingenten Romankonstruktion, bei der Psychoanalytikerin Helene Cheresch, der vierten Hauptfigur, mit der alle drei eine wiederum eigene Geschichte verbindet.
In dieses spannungsreiche Beziehungsgefüge, das um viele weitere der Zeit anverwandelte Figuren ergänzt wird, webt Raphaela Edelbauer viele der explosiven neuen Gedanken und Erscheinungen, die im Jahr 1914 die althergebrachten Denk- und Verhaltensmuster erbeben lassen. Es geht um die Suffragettenbewegung, um weibliche Homosexualität, um den Machtverlust des Adels und das Erstarken neuer politischer Akteure, um neue Wirklichkeitserfahrungen, um die unheimliche Aufwertung des Unterbewusstseins, und überhaupt um einen riesigen Werteverfall oder besser um eine Umwertung aller Werte, in der ein inniger Abscheu gegenüber dem Alten und eine tief sitzende Angst vor dem Neuen gewaltsam aufeinanderprallen. Das Thema von Klaras Doktorarbeit, in der sie sich mit den „Inkommensurablen“ beschäftigt, also mit mathematischen Zahlen, die zueinander in einem irrationalen Verhältnis stehen, die kein gemeinsames Maß haben, aus dem ein reeller Zahlenwert hervorginge, lässt sich, als zentrale Metapher des Romans, auch auf die miteinander in gewaltsamer Konkurrenz stehenden Werte und moralischen Fragen übertragen. Die Masse ist gesellschaftlich eben längst nicht so homogen, wie sie dem historischen Mythos des Augusterlebnisses zufolge 1914 in einen heilbringenden Krieg gezogen sei. Vielmehr spricht allein in der Stadt Wien fast jeder eine andere Sprache, was bei weitem nicht nur an der Sprachenvielfalt des dem Untergang geweihten Vielvölkerreiches liegt. Moralisch, politisch, in jeder nur denkbaren Hinsicht wird mit einem anderen Maß gemessen, so dass die jeweiligen Vorstellungen und Überzeugungen absolut inkompatibel erscheinen: die der Alten und die der Jungen, die der Land- und die der Stadtbevölkerung, die der reichen Militärs aus Adams Elternhaus und die der Frauenrechtlerinnen, die der Nationalisten und die der Internationalen, sowie die der verschiedenen Nationalisten untereinander, und so weiter und so fort. In einer solch inkommensurablen Gesellschaft ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, sich zu verständigen; wo ein gemeinsames Maß fehlt, bleibt nur der Ausdruck der Gewalt. Die brodelnde Maßlosigkeit ist denn auch omnipräsent in diesem Roman, der mancherlei Anklang an Robert Musil, Hermann Broch und vor allem auch an Thomas Manns Zauberberg bereithält, nicht nur, weil die Fiktion schließlich im Kriegsausbruch kulminiert. Die Nervosität und Reizbarkeit der Einzelnen, die einer riskanten Dynamik der Massen in die Hände spielt, die in die Handlung integrierten wissenschaftlichen Diskurse und besonders die schlagfertigen Dialoge, die, anspielungsreich und von unterschwelligem Witz, auch beziehungsreiche inhaltliche Felder durchschreiten, machen deutlich, wo die Autorin ihre großen Vorbilder hat.
Wenn man eine moralisch-ethische Brücke in die Gegenwart schlagen mag, so kann man aus der Durchführung dieser mathematischen Metapher durchaus eine Warnung ableiten, nämlich die vor der Halsstarrigkeit ins Absolute gewendeter Überzeugungen, die religiösen Ideologien gleich, keine anderen neben sich gelten lassen. Ein solches Fehlen von Meinungspluralität wird rasch zum Quell der Gewalt, die sich erst in der Kommunikation, sodann auch in physischer Auseinandersetzung ihren zerstörerischen Ausdruck verschafft.
Der Schluss gestaltet sich im Übrigen so zwangsläufig wie überraschend. Metaebene und Handlungsebene fallen in eins, erweisen sich als geschickt angelegte Versuchsanordnung und desillusionieren sowohl den Protagonisten Hans wie den Leser. Mit der Einschränkung jedoch, dass ein fiktionsironisches Fenster für den aufmerksamen Leser offengelassen wird, durch das er ins Übersinnliche blicken darf — das keinesfalls mit dem Übernatürlichen gleichzusetzen ist, wie man in einer der anregenden Diskussionen der Figuren zuvor erfahren hat.
Bibliographische Angaben
Raphaela Edelbauer, Die Inkommensurablen, Klett-Cotta 2023
ISBN: 9783608986471
Bildquelle
Raphaela Edelbauer, Die Inkommensurablen
© 2024 Klett-Cotta Verlag J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart