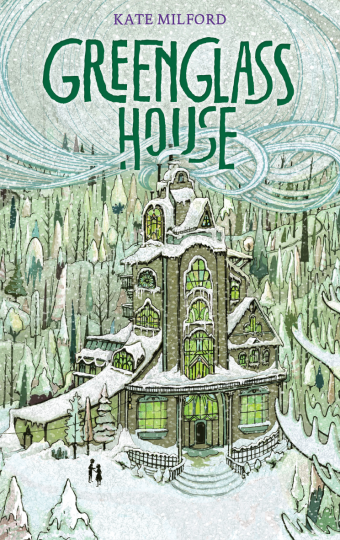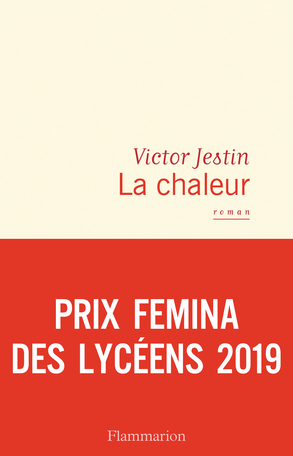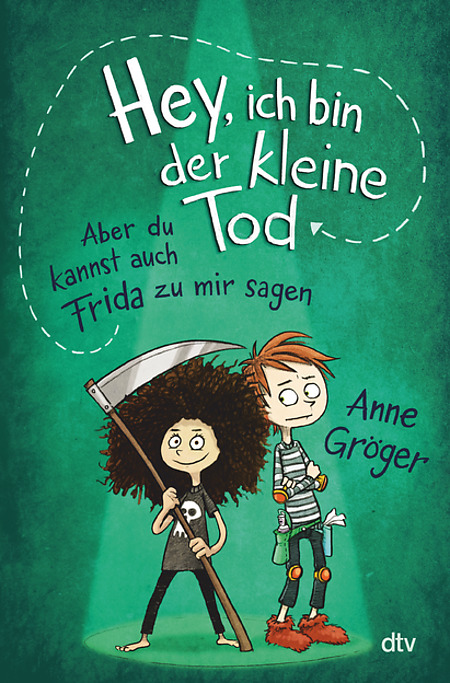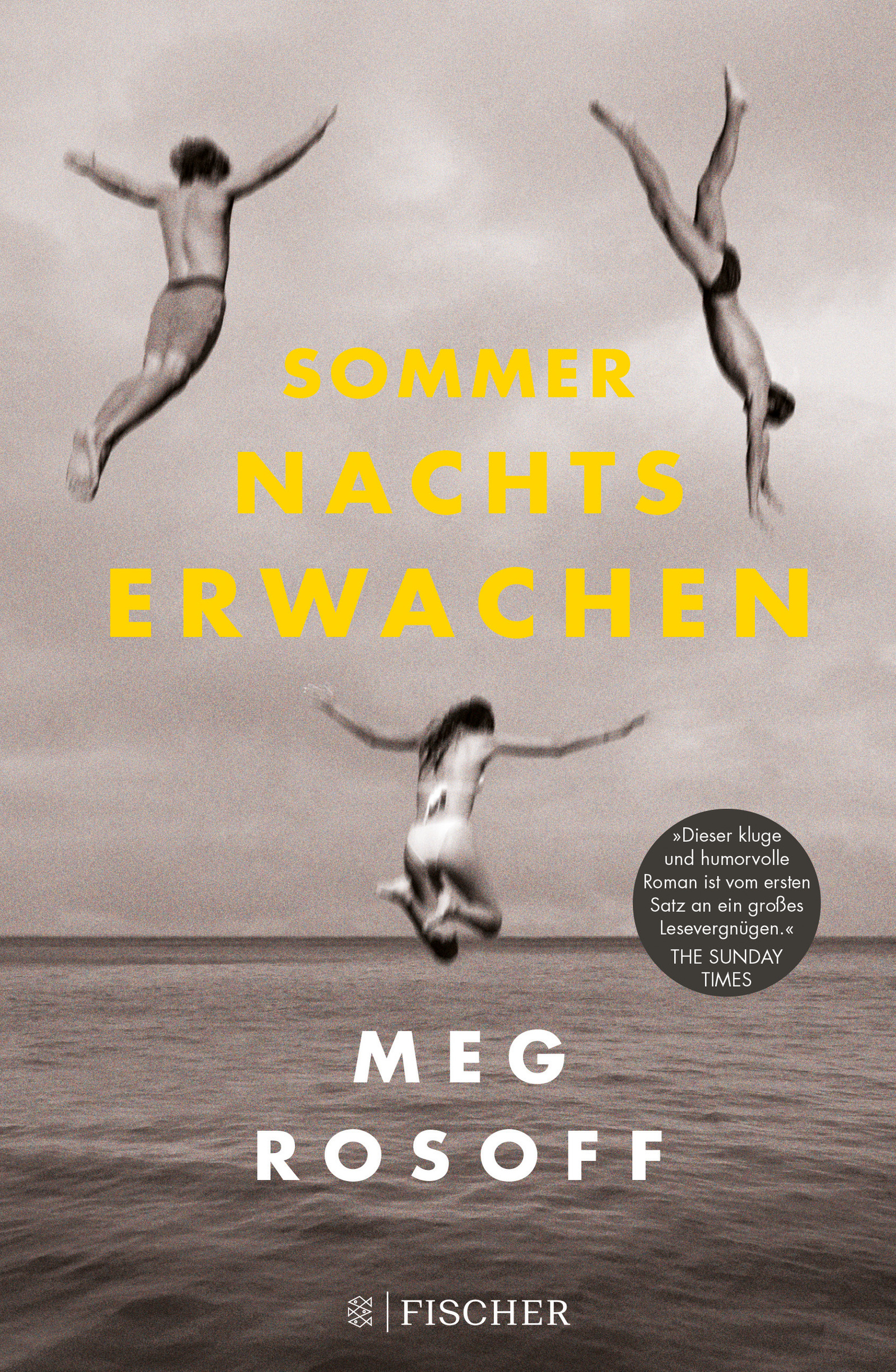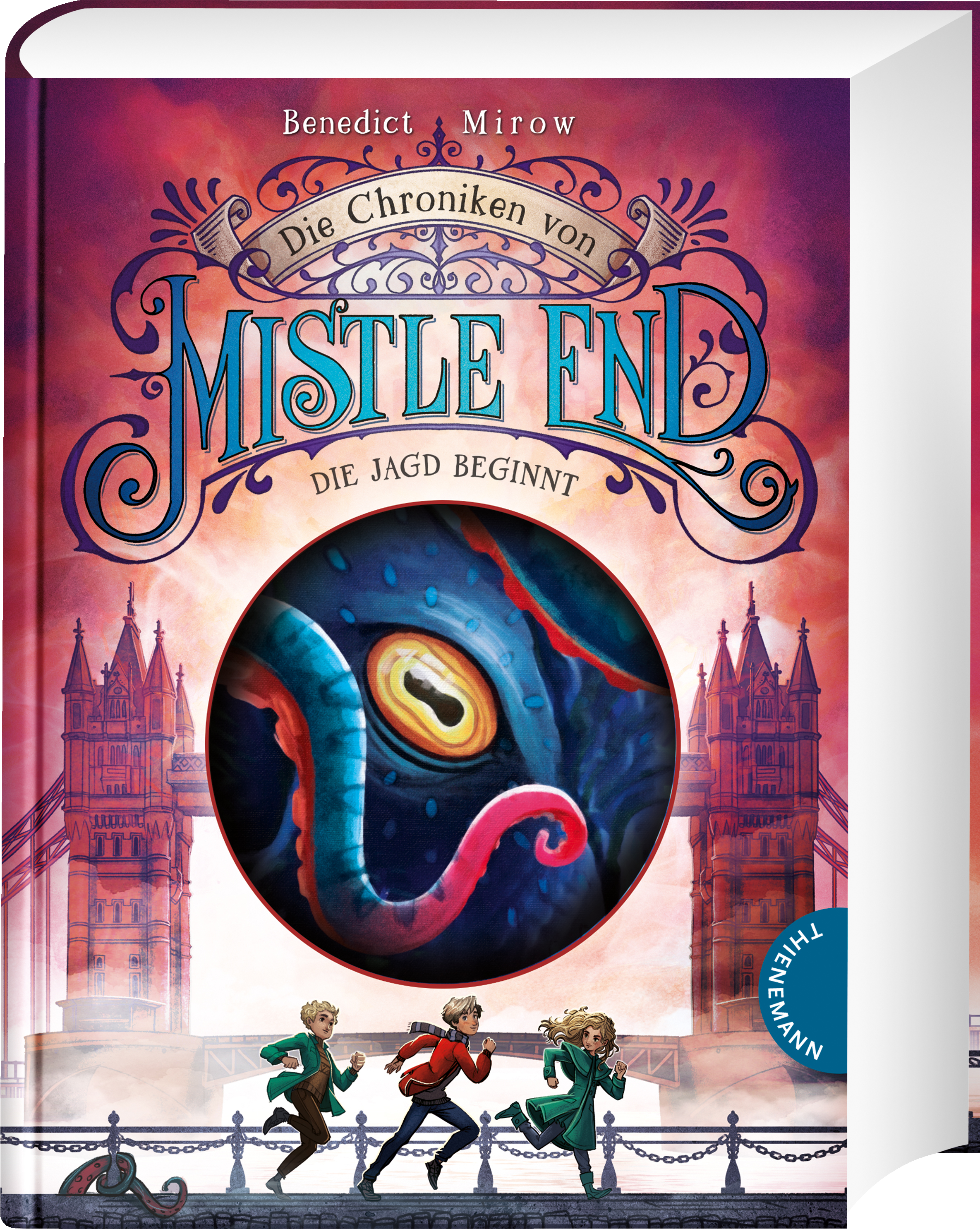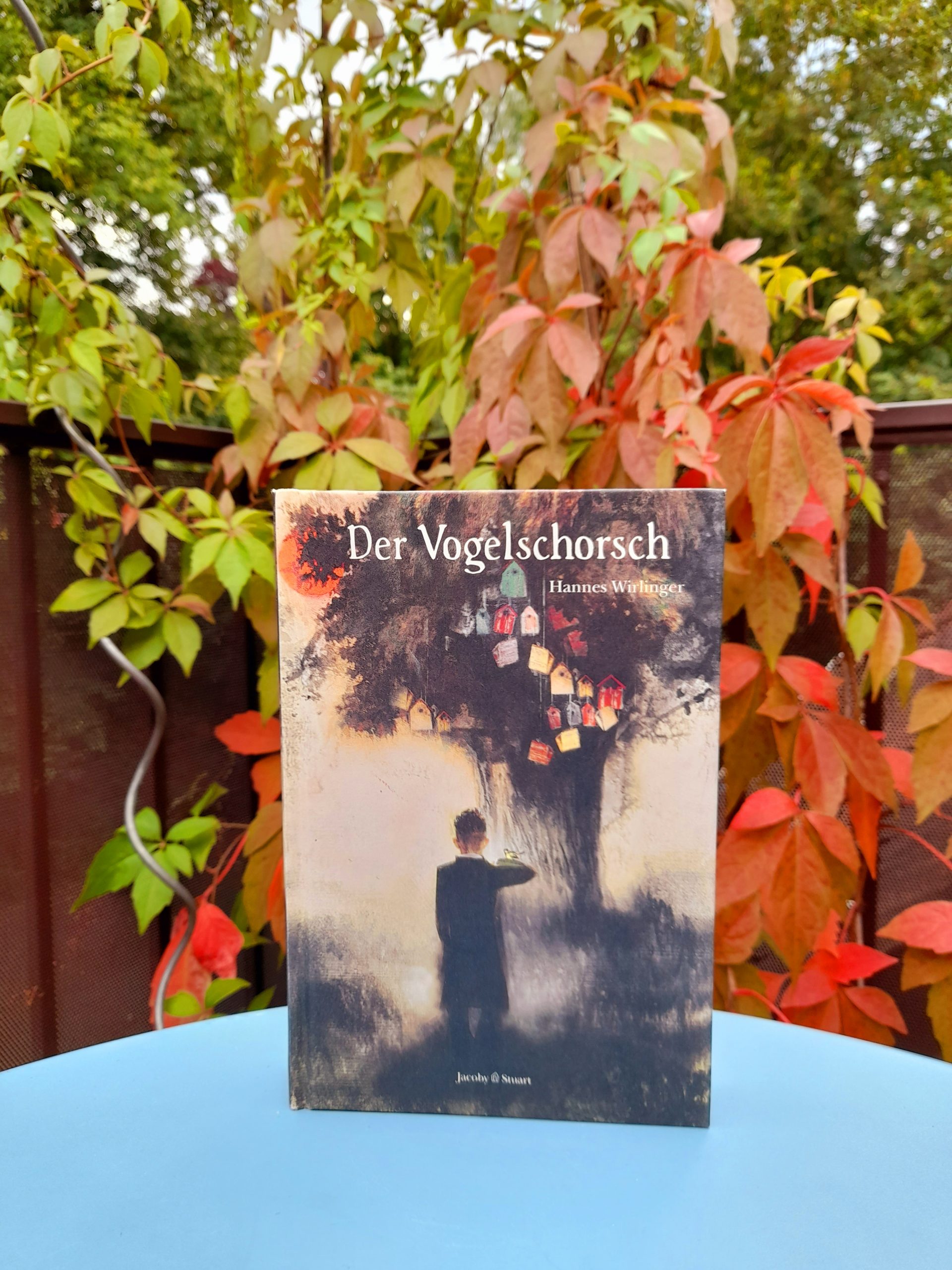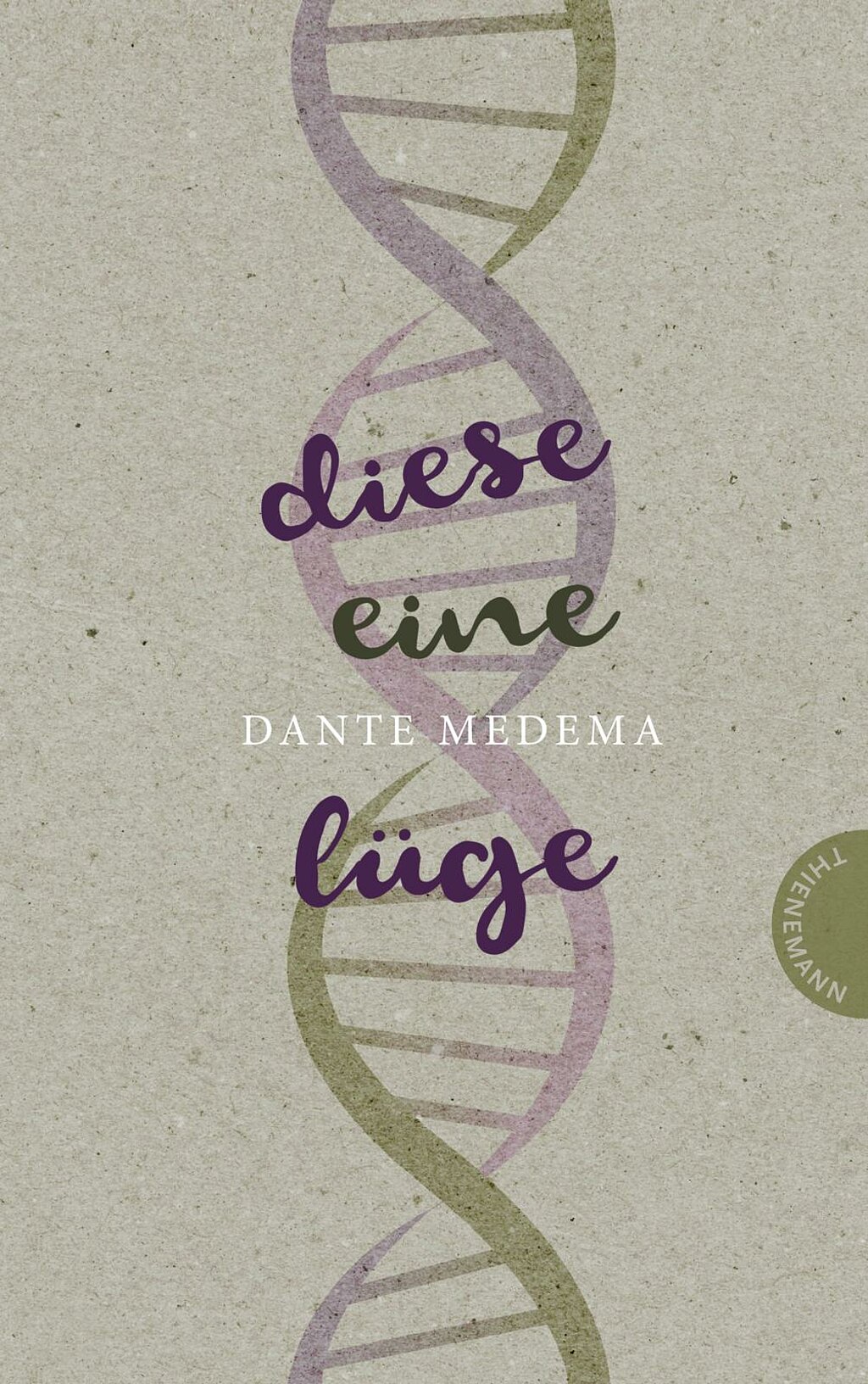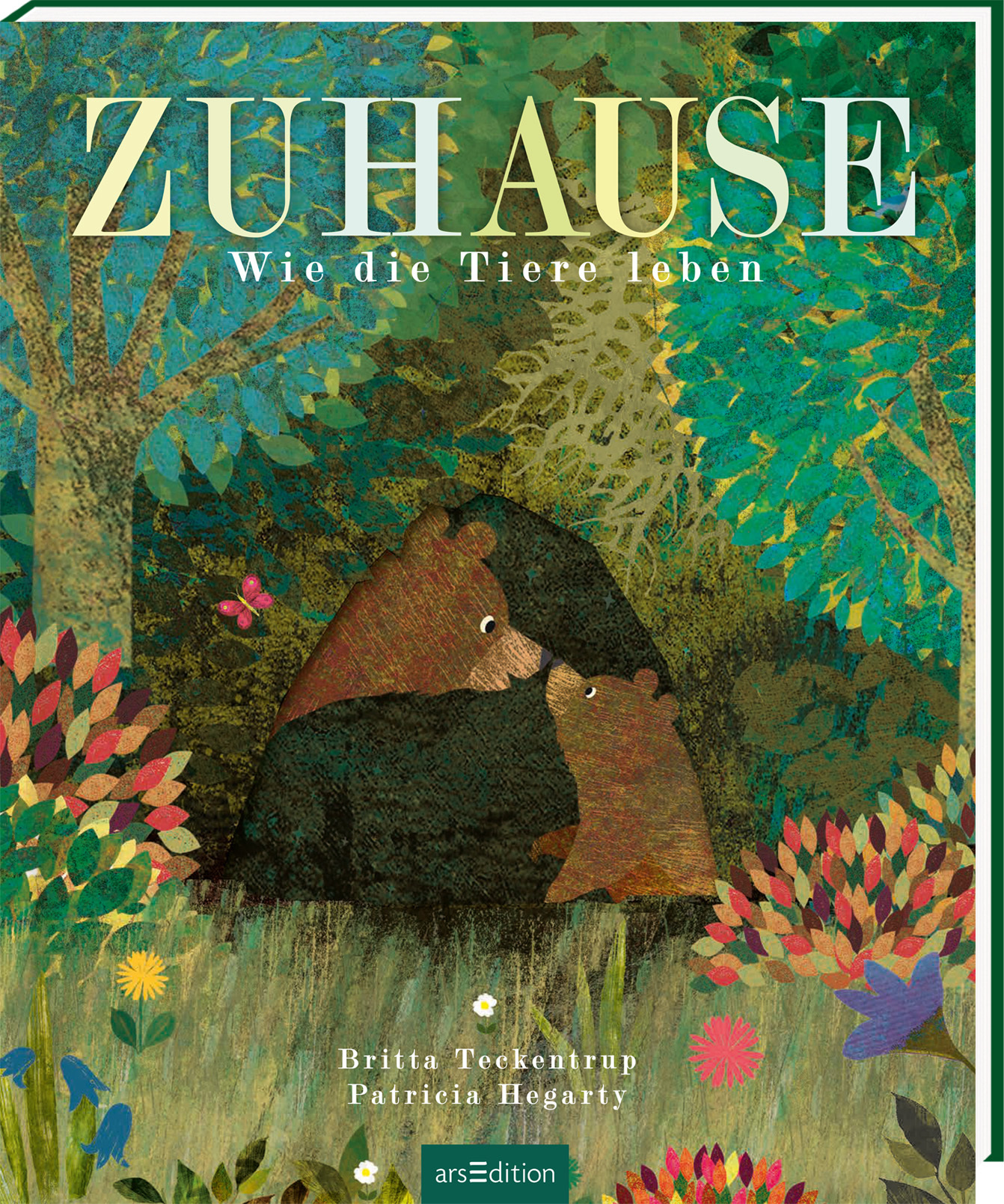La chaleur, die Hitze, ist ein heißes, erstickendes Kammerspiel, das sich im kurzen Zeitraum von nicht einmal zwei ganzen Tagen an der so gar nicht frischen, sondern vor Hitze flirrenden Luft eines französischen Campingplatzes am Atlantik in den Landes abspielt.
Geschrieben hat das Buch der junge Autor Victor Jestin, Jahrgang 1994, der dafür in Frankreich auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde. La chaleur ist sein Debüt, ein aus der Perspektive des 17-jährigen Léonard erzählter Jugendroman, der stilistisch und psychologisch eindrucksvoll geschrieben ist und seinen Lesern emotional einiges abverlangt. Dem Text fast wie eine Warnung vorangestellt ist ein Zitat aus Büchners Woyzeck, über dessen gleichnamige Hauptfigur im Laufe der Theaterhandlung, sinngemäß, eine andere sagt, sie sei in ihrem Wahn zum offenen Rasiermesser für die Welt um sie herum geworden.
Die Schockstarre, in die einen gleich die ersten Zeilen von La chaleur versetzen, hat nichts Rasiermesserblutiges an sich und doch lässt sie einen wie in der eigenen voyeuristischen Leserperspektive ertappt innehalten. Es wird geschildert, wie Léonard, ein Jugendlicher, der seine Sommerferien an einem Campingplatz am Meer verbringt, im Schutze der Dunkelheit beobachtet, wie ein anderer Jugendlicher, Oscar, den Léonard nur flüchtig kennt, sich im trunkenen Zustand selbst tötet, wie er sich in die Seile der Schaukel eindreht, auf der er sitzt, wie er sich irgendwann nicht mehr herauswinden kann und sich so langsam, qualvoll selbst erwürgt. Wie der Leser verhält sich auch Léonard in dieser Szene wie ein Voyeur, wie gelähmt begnügt er sich damit, zuzuschauen, ja er sieht dem anderen sogar direkt in die Augen, greift aber nicht ein, tut nichts, die schreckliche Tat zu verhindern. Auch unmittelbar danach steht Léonard immer noch wie neben sich, er begreift selbst nicht, warum er das Schreckliche, warum er den Tod zugelassen, warum er nicht gehandelt hat. Was er aber begreift, ist, dass er durch seine Passivität Schuld auf sich geladen hat. Doch er handelt weiter irrational. Anstatt Hilfe zu holen oder auch einfach nur abzuhauen, vergräbt er den Leichnam des Jungen am Strand in den Dünen.
Während der ganzen Erzählung ist man kontinuierlich in den Gedanken von Léonard, erlebt alles aus seiner Sicht. Das ist schockierend, intensiv, und verwirrenderweise auch berührend, man fühlt mit ihm und ist zugleich abgestoßen von seinem (Nicht-) Verhalten. Jestin lässt uns auf diese Weise in großer Eindringlichkeit miterleben, wie Léonard den darauffolgenden Tag verbringt, die darauffolgende Nacht, und die weiteren Tage bis zu seiner Abreise. Man lernt den Jugendlichen und seine Innenwelt immer genauer kennen, erfährt, dass Léonard eigentlich alles andere als einer der feierwütigen Teenager ist, die sich auf dem Campingplatz tummeln, dass er sich auf all den Partys eher fehl am Platz fühlt und nicht so recht Anschluss zu finden vermag. Auch an jenem fatalen Abend hatte er sich früher zurückgezogen und die Einsamkeit gesucht. Man erfährt auch, wie Léonard mit seinen kleinen Geschwistern umgeht, wie er mit seinen Eltern klar kommt, wie er — aus Pflichtgefühl, aus Neugier, schlechtem Gewissen, dem Wunsch zu reden — bei Oscars Mutter vorbeischaut, und wie er sich in ein Mädchen verliebt, das am Vortag ausgerechnet mit Oscar geflirtet hatte; wie er sich, so wie Oscar in den tödlichen Seilen der Schaukel, in einer hitzigen Gedankenspirale an den toten Jungen verfängt, und wie er immer wieder Anstrengungen unternimmt, zu reden, zu beichten, und es doch nicht über sich bringt.
Die titelgebende Hitze, die natürlich symbolischen Charakter hat, macht Jestin zur sichtbaren oder besser spürbaren Begleiterin der innerlichen Turbulenzen, die Léonard durchlebt. Fast erscheint seine „Tat“ als notwendige Konsequenz der Jahr für Jahr und auch in diesem Sommer immer unerträglicher werdenden Temperaturen:
Depuis quelques étés déjà, la chaleur ne cessait de s’intensifier. Chaque année elle surgissait plus tôt, cette fois dès février, et on l’avait accueillie sans crainte, trop heureux de finir l’hiver, on avait dressé les terrasses des bars sans présager du pire. Je me demandais à compter de quel degré ce serait trop. Tout se renverserait. On fuirait ce camping comme on saute d’un appartement en flammes (…).
Schon seit einigen Sommern nahm die Hitze unablässig an Intensität zu. Jedes Jahr kam sie früher, dieses Mal schon im Februar, man hatte sie furchtlos begrüßt, freute man sich doch zu sehr, dass der Winter endlich zu Ende war, man hatte die Terrassen der Bars geöffnet, ohne das Schlimmste zu ahnen. Ich fragte mich, ab wieviel Grad der Punkt überschritten wäre. An dem sich alles umkehren würde. Man würde vom Campingplatz flüchten, so wie man aus einer brennenden Wohnung springen würde (…).
Jestin, Chaleur, S. 33, Übersetzung der Rezensentin
An diesem Kipppunkt, das ist die erzählerische Kunst des jungen französischen Autors, bewegt sich die ganze Erzählung. Die Hitze des Sommers wird zu einem flirrenden Bild für das überhitzte Verhalten auch der anderen Teenager, all der flirtenden Mädchen, der aggressiven halbstarken Jungen, des unglücklichen berauschten Oscar. Bei Léonard ist die Hitze auch ganz deutlich an ein Empfinden der Enge, der Bedrängnis im Inneren gekoppelt, so dass er bisweilen mit einer scheinbar paradoxen Gefühlskälte auf die äußere Überhitzung reagiert. Das schließt nicht aus, dass sich hinter einer solchen scheinbar emotionslosen Haltung ein sehr sensibler Junge verbirgt; seine innere Stimme, die das Geschehene, die den toten Oscar nicht aus dem Gedächtnis vertreiben kann, spricht Bände, und man leidet beim Lesen mit, erlebt seine Ohnmacht, seine Hemmungen gegenüber seinen Altersgenossen fast wie am eigenen Leib. Mit einfachen und doch immer wieder genau ins Herz treffenden Worten schildert Jestin die unbeholfenen Versuche eines introvertierten und zutiefst aufgewühlten Jungen, mit anderen in Kontakt zu treten, wie etwa mit Louis, einem anderen Teenager auf dem Campingplatz, zu dem sich eine flüchtige Freundschaft anbahnt:
J’ai voulu lui [Louis] tapoter l’épaule, lui dire un mot, faire quelque chose, mais rien n’est venu. J’ai tenté d’imaginer ce que cela faisait d’être lui en permanence, mais je n’ai pas réussi non plus.
Ich wollte ihm [Louis] auf die Schulter klopfen, ihm etwas sagen, irgendetwas tun, aber es kam nichts aus mir heraus. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, ständig in seiner Haut zu stecken, aber auch das habe ich nicht fertiggebracht.
Jestin, Chaleur, S. 67, Übersetzung der Rezensentin
Trotz der beklemmenden Hitze allerorten wird der Roman nicht gänzlich von einer düster-schweren Atmosphäre erdrückt, denn Jestin gelingt es, ohne Stilbruch auch leichtere Szenen einzubauen, kurze Einblicke in den Familienalltag zu geben oder das zarte und zugleich herausfordernde Entstehen einer Freundschaft, einer Liebe zu schildern, die das Camp nicht überdauern werden. Eine Melancholie der Zeitlichkeit liegt über allem, das Leichte und das Schwere sind nicht voneinander zu trennen, sind eng verschlungen im so eindringlich erzählten Kosmos einer jugendlichen Suche nach Liebe und Wahrheit. Victor Jestins Text ist vielleicht nicht unbedingt nur ein Jugendroman, sondern vor allem ein überzeugendes psychologisches Sommerstück, das einen Blick hinter die idyllischen Kulissen der Sandstrände wirft und in einer poetischen klaren Sprache die Desillusionierung eines schmerzhaft der Kindheit entwachsenen Teenagers erzählt, die fast als Parabel für die gegenwärtige Desillusionierung der Menschheit über sich selbst gelesen werden könnte.
C’est beau les Landes, disaient les gens. L’air est pur, il fait chaud, on a l’océan devant soi. Personne ne disait: C’est terrible, les Landes. C’est le faux calme des pins, le fracas des vagues dont on sait bien qu’elles on déjà tué, et tous ces rires et cris de jouissance mêlés en un même écho sourd […].
Wie schön die Landes sind, sagten die Leute. Die Luft dort ist klar, es ist warm, der Ozean liegt vor einem. Niemand sagte: Wie schrecklich die Landes sind. Die trügerische Ruhe der Pinien, der Lärm der Wellen, die, wie man genau weiß, schon den Tod gebracht haben, und all das Gelächter und die Schreie der Lust, die sich im selben dumpfen Echo miteinander vermengen […].
Jestin, Chaleur, S. 47, Übersetzung der Rezensentin
Bibliographische Angaben
Victor Jestin: La chaleur, Flammarion 2019
ISBN: 9782081478961
In deutscher Übersetzung von Sina de Malafosse ist Victor Jestin: Hitze 2021 bei Kein & Aber erschienen.
Bildquelle
Victor Jestin, La chaleur
© Éditions Flammarion SA, Paris