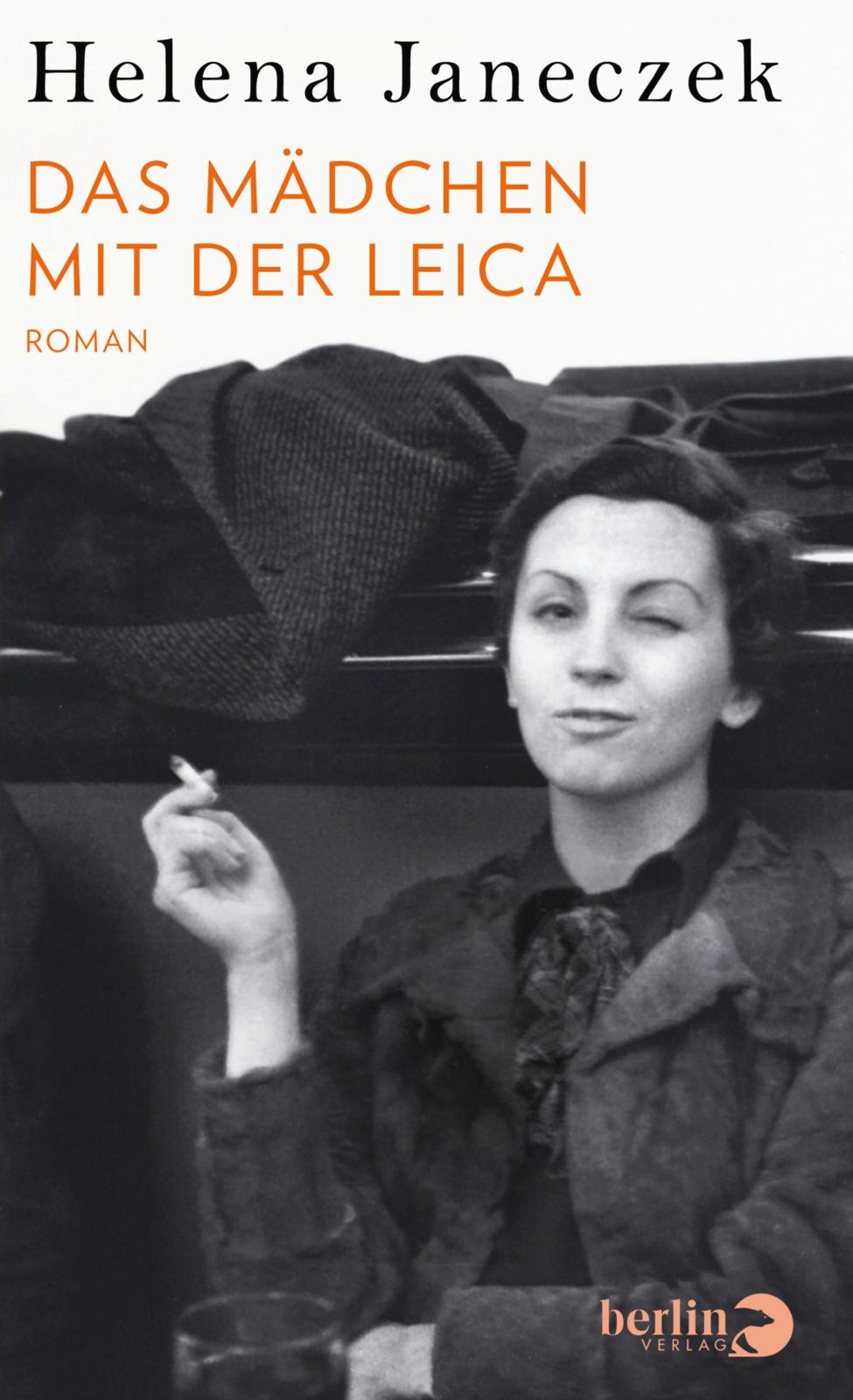Ich finde, auch in Deutschland reden wir zu wenig und zu undurchsichtig über unsere Arbeit, weshalb willkürliche Ungleichheiten der Entlohnung ebenso wie eine unverhältnismäßige Ungleichheit der sozialen Hierarchien am Arbeitsplatz, in Form belastender oder gar entwürdigender Einschränkungen von Respekt, Status und Autonomie der Arbeitnehmer zur Steigerung des unternehmerischen Profits, oft unhinterfragt hingenommen werden. Die amerikanische Philosophin Elizabeth Anderson bricht in ihren 2014-15 in Princeton gehaltenen Tanner Lectures, die inzwischen in deutscher Übersetzung bei Suhrkamp erschienen sind, ein unausgesprochenes Tabu: Sie entlarvt die in Persönlichkeitsrechte hineinreichende private, d.h. nicht öffentlich diskutierte, sondern rechenschaftsfreie Herrschaft der Arbeitgeber über ihre Arbeitnehmer in privaten Unternehmen als anstößig und vielfach ungerechtfertigt und unterzieht die allseits akzeptierte Legitimierung solcher quasi diktatorisch agierenden „privaten Regierungen“ inmitten demokratischer Staaten durch die mit der modernen Lebens- und Arbeitswelt nicht mehr in Einklang zu bringende liberalistische Idee des freien Marktes einer grundlegenden Ideologiekritik.
Zentrales Anliegen der Philosophin ist es denn auch, die heute aus dem Blick geratene Frage nach Formen privater Herrschaft und Unterdrückung am Arbeitsplatz wieder zum Thema der politischen Theorie zu machen und einen öffentlichen Diskurs darüber anzustoßen, wie auf Kosten zahlloser Lohnarbeiter — und ganz besonders der Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnsektor — eine kleine Schar privater Geschäftsmänner von einem „symbiotische[n] Verhältnis zwischen Libertarismus und Autoritarismus“ profitieren, „das unsere politischen Diskurse […] wie Mehltau überzieht“ (Anderson, S. 11) und mit der ursprünglichen Idee des Liberalismus nichts mehr zu tun hat.
Denn das Ideal einer freien Marktwirtschaft, so stellt Anderson es in einem historischen Rückblick heraus, war zu Beginn ein Anliegen der Linken und untrennbar mit egalitären sozialen Zielen verbunden. So ging es den frühen Fürsprechern des Liberalismus im 17. Jahrhundert, den Levellers, um die Befreiung der Menschen aus patriarchalen Formen der Unterwerfung und um den Abbau von Monopolen in allen Lebensbereichen der Gesellschaft zugunsten der sozialen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Individuen. Adam Smith knüpfte mit seiner ökonomischen Vision an diese Ideen an und hatte ebenfalls vor allem Kleinbauern und Kleinunternehmer im Blick, in deren durch den Liberalismus garantierten wirtschaftlichen Unabhängigkeit er die beste Voraussetzung für eine human und freiheitlich gestaltete zukünftige Gesellschaft sah. Doch die Vordenker des Liberalismus konnten nicht ahnen, dass sich die Markt- und Arbeitsverhältnisse mit der Industriellen Revolution grundlegend verändern würden. Anderson hebt hervor, welch radikaler Einschnitt mit der Ausbreitung der großen Fabrik- und Industriebetriebe für die sozialen Hierarchien zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verbunden war. Die große Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung bestand von nun an aus abhängigen Lohnarbeitern und war weit entfernt vom Ideal der wirtschaftlichen Selbständigkeit eines Handwerkers oder Kleinbauern. In einer solchen Situation bedeutet ein von staatlichen Eingriffen freier Markt jedoch nicht mehr Gleichheit und Freiheit, sondern im Gegenteil Konzentration einer mit Macht verbundenen unternehmerischen Autonomie in den Händen einzelner einflussreicher Großbetriebe und damit die Etablierung eines nicht öffentlichen Raums privat regierter Arbeitsplätze:
Wenn der Großteil der Bevölkerung selbständig ist, ist ein Plädoyer gegen staatliche Einmischung eine völlig andere Aussage, als sie es heute wäre.
Anderson: Private Regierung, S. 66
Während Anderson ihren Blick hauptsächlich auf die große Zahl der Angestellten und Lohnarbeiter richtet, erstrecken sich die Formen privater Herrschaft meines Erachtens in vielen Fällen auch auf scheinbar unabhängige Soloselbständige oder Kleinunternehmen, die — gerade zur Aufrechterhaltung ihrer wirtschaftlichen Selbständigkeit — bisweilen gezwungen sind, hierarchische Ungleichheiten und Autonomieverluste in Kauf zu nehmen, etwa wenn sie Aufträge auch um den Preis einer diktatorischen Behandlung durch die auftraggebenden Konzerne annehmen müssen. Dies liegt nicht zuletzt an der Entstehung neuer Monopole — große Finanzhäuser oder Konzerne wie Google, Amazon oder Netflix –, die nicht etwa unter staatlicher Herrschaft stehen, sondern in einem zu wenig regulierten ökonomischen Freiraum gedeihen können und den freien und gleichen Wettbewerb verzerren. In einem Artikel in der ZEIT vom 26.3.2020 spricht genau in diesem Sinn der Finanzexperte und ehemalige Abgeordnete der Grünen, Gerhard Schick, von einer Transformation der sozialen Marktwirtschaft in eine „Machtwirtschaft“, in der nicht das beste Produkt gewinnt, sondern eine kleine wirtschaftliche Machtelite, die dem Staat die Regeln diktiert und über die einflussreichsten Lobbys und größten Geldakkumulationen verfügt. Wirklich frei und selbständig wirtschaften können heute nur die wenigsten, allen gleich ist nur die Marktwertabhängigkeit, die neue Privilegien schafft. Denn wie Anderson schreibt, liegt ein Denkfehler des mit der Industriellen Revolution einhergehenden neuen Liberalismus darin, dass auch die Arbeitskraft selbst, also der Mensch, als Ware betrachtet wird anstatt als autonomes Subjekt. So kommt letztlich nur eine kleine Schar Privilegierter in den Genuss der Vorteile des freien Marktes, die einst für die große Mehrheit angedacht waren:
Während Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an der Spitze der Unternehmenshierarchie eine solche Freiheit ebenso besitzen wie eine Handvoll Topathleten, Mediengrößen und Starakademiker, [wird in der vielfach geäußerten Verteidigung privater Regierung die Tatsache ignoriert], dass die große Mehrheit der Arbeitnehmer, die nicht durch Gewerkschaften vertreten wird, die Bedingungen für die Autorität des Arbeitgebers überhaupt nicht aushandelt.
Anderson: Private Regierung, S. 106
Anderson zufolge ist der reine Arbeitsvertrag, der den freien Ein- und Austritt aus dem Arbeitsverhältnis garantiert, alles andere als ausreichend, um die Möglichkeit des Machtmissbrauchs in der privaten Regierung des Arbeitgebers zu minimieren. Auch der Zeitraum dazwischen muss mit einer rechtlichen Infrastruktur versehen werden. Anderson ist grundsätzlich dafür, hier die Rolle des Staates zum Schutz der Arbeitnehmer zu stärken, hält darüber hinaus aufgrund der vielfältigen, ganz unterschiedlich strukturierten Arbeitsplätze aber auch interne Regelungen, etwa in Form von Mitspracherechten der Arbeitnehmer, für unverzichtbar.
In einiger Hinsicht sind die europäischen Länder hier weiter als Amerika, dessen Arbeitsverhältnisse den Ausgangspunkt von Andersons Kritik darstellen. Doch auch wenn die Autorin sogar gewisse in Deutschland praktizierte Formen der Mitsprache in Betrieben als Vorbild anführt, lassen sich auch hier Strukturen der Ungleichheit am Arbeitsplatz ausmachen, die unnötig Stress und Unzufriedenheit hervorrufen. Viele Arbeitnehmer leiden unter willkürlichen Arbeitszeiten, kurzfristigen und familieninkompatiblen Einsatzplänen, unter der unterschwelligen Stigmatisierung von kurzen Wortwechseln mit Kollegen oder Toilettengängen als „Zeitdiebstahl“, unter mangelnder Anerkennung, Leistungsdruck auf Kosten der (psychischen) Gesundheit oder unter einer Überstrapazierung der vertraglich oft bewusst unbestimmt gehaltenen Arbeitsbereiche, die es dem Arbeitgeber ermöglicht, sein Personal in nicht weiter zu rechtfertigenden „ökonomischen Notlagen“ willkürlich zu Aufgaben zu zwingen, die nichts mit der Qualifikation des Arbeitnehmers zu tun haben. Gerade in nicht hochqualifizierten Berufen wie Einzelhandel oder Pflege ist ein Verschleiß von menschlichen Arbeitskräften alles andere als unüblich. Öffentlicher Redebedarf ist also auf jeden Fall angebracht, in Deutschland ebenso wie in Amerika.
Ich lege keine Blaupause für eine bessere Verfassung der Regierung am Arbeitsplatz vor. Vielmehr schlage ich einen Rahmen für das Reden über den Arbeitsplatz vor, in dem wir artikulieren können, wie die Arbeitnehmerinteressen von der Macht beeinträchtigt werden, die Arbeitgeber über die Beschäftigten ausüben, und wie alternative Verfassungen für die Regierung am Arbeitsplatz angelegt sein könnten, um den Interessen der Beschäftigten aufgeschlossener und ihrer Würde und Autonomie respektvoller zu begegnen.
Anderson: Private Regierung, S. 30
Private Regierung ist ein wichtiges Buch. Denn das Bedürfnis nach mehr Mitsprache und Autonomie am Arbeitsplatz ist unumstritten vorhanden; dass es bisher zu wenig firmeninternen Diskurs darüber gibt, liegt sicher auch an der das Schlaglicht auf die ungleichen sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz werfenden Angst vor Entlassung. Und gerade deshalb ist ein öffentlicher Diskurs, den die einflussreiche Philosophin Elizabeth Anderson mit ihren Vorlesungen in Amerika angestoßen hat, so wichtig und sollte unbedingt auch hier Gehör finden.
Elizabeth Anderson: Private Regierung — Wie Arbeitgeber über unser Leben herrschen (und warum wir nicht darüber reden), Suhrkamp (2019)
ISBN: 9783518587270
–> Zur Neuauflage 2020 in der Reihe Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft