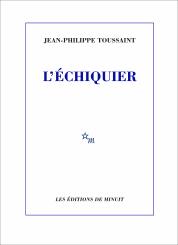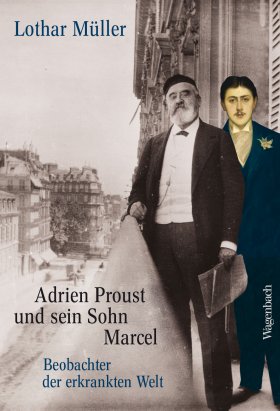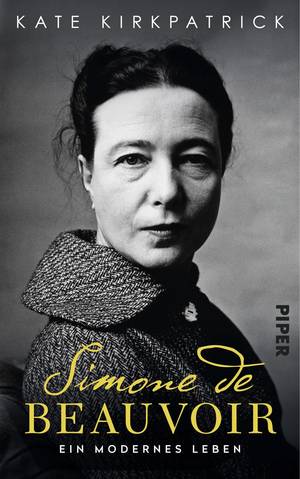Wer von der Literatur lebt — und das ist nicht ökonomisch gemeint –, für den ist das Schreiben als Projekt niemals abgeschlossen, am Text des Lebens wird unermüdlich weitergewoben. Neigt sich die Arbeit an einem Buch dem Ende entgegen, hat die Zeit des neuen Textentwurfs schon begonnen, die immer wieder auch eine Zeit der neuen Orientierung ist. In dieser Nervosität ebenso wie Euphorie hervorrufenden Phase ist L’Échiquier, das neue Buch des belgischen Schriftstellers Jean-Philippe Toussaint, entstanden: Während er die Druckfahnen seines letzten Buches Les Émotions korrigiert, schwelgt er, schreibend, denkend, entwerfend, bereits darin, mit gleich drei schriftstellerischen Vorhaben seine literarische Verteidigung gegen die unvermeidlichen Verletzungen des Daseins fortzuführen. Er will, erstens, Stefan Zweigs Schachnovelle ins Französische übersetzen, zweitens, einen Essay über das Übersetzen verfassen und, drittens, parallel dazu eine Art Bordtagebuch, eben den vorliegenden Text, L’Échiquier (dt. „das Schachbrett“), in Angriff nehmen, einer Reflexion zugleich über das Schreiben und das Übersetzen.
Zwei dieser Projekte, die Übersetzung von Stefan Zweig und das „journal de bord“, sind 2023 im Verlag Les Éditions de Minuit erschienen. Sie sind zu einem gewissen Teil auch von den besonderen Umständen der Coronapandemie getragen und beeinflusst, die Toussaint als beunruhigenden und zugleich merkwürdig beflügelnden, in jedem Fall nachhaltig erschütternden Einbruch der Wirklichkeit in das individuelle Dasein wahrnimmt. Während in dieser angespannten Situation öffentlich viel über die Zukunft und die notwendigen Veränderungen in ihr diskutiert wird, erfährt Toussaint die Krise vor allem als Rückkehr in die Vergangenheit, wirft diese ihn zurück in die Abgründe der Erinnerung. Doch auch wenn immer wieder Autobiographisches in seinen Text mit einfließt, ist dieses „Tagebuch“ in jeder Zeile Literatur und Reflexion. Das Persönliche motiviert das Erzählte, es drängt sich immer wieder auf und hinein in den Text, da Leben und Schreiben bei Toussaint eng miteinander verwoben sind. Doch das Ordnungsprinzip seines Buches besteht nicht darin, romanhaft ein Leben ab ovo zu erzählen, zu rekonstruieren. Die Ordnung oder Struktur des Textes ist vielmehr das titelgebende „Schachbrett“, auf dessen Feldern er wie die Figur des Pferdchens springt, in einer raumzeitlichen Logik, deren Zügel innerhalb des gegebenen Rahmens gelockert sind und mit denen in der schreibenden Hand er weniger den Spielregeln der Chronologie als gewissen Mustern und Assoziationen folgt, die ihn auf das Terrain der Erinnerung führen. Die Erinnerungen in L’Échiquier sind nicht ausufernd, aber sie werden mit den Instrumenten des Schriftstellers bearbeitet, durchdrungen, durchleuchtet, in ihrer Vielschichtigkeit und auch Inkonsistenz konstruiert und hinterfragt. Es sind vor allem blitzlichtartige Momente seiner Kindheit und Jugend, die der sich erinnernde Ich-Erzähler an die Oberfläche des Textes holt, Erinnerungsspuren, die ihn zurück ins Internat, zu vergangenen Freundschaften und nicht zuletzt zu seinem inzwischen verstorbenen Vater führen, der es zu Lebzeiten immer wieder bedauert hat, als einziger der Familie in keinem der Bücher seines Schriftstellersohnes aufzutauchen. Nun, nach seinem Tod, scheint der Moment gekommen, und L’Échiquier ist, so wird sich der Erzähler beim Schreiben immer deutlicher bewusst, im Grunde ein Buch darüber, wie er zum Schriftsteller geworden ist, und, eng damit verbunden, über seine Beziehung zum Vater, der selbst ein renommierter Journalist war und dessen uneingestandenen Wunsch, Schriftsteller zu werden, er als sein Sohn schließlich gewissermaßen substitutiv erfüllt hat.
Auffallend ist auch die Nähe zu Patrick Modiano in manchen Passagen, mit dem er das schriftstellerische Interesse für die so hartnäckige wie behutsame Erkundung der literarischen Dimension der Zeit teilt und für die Rolle, die die subjektive und in der Folge immer wieder mysteriöse Kategorie der Erinnerung darin spielt. Das Geheimnisvolle der Erinnerung, das von einem leisen Unbehagen, ja manchmal auch von Schmerz durchzogen ist, das Bruchstückhafte, Schemenhafte früherer Begegnungen, die im Nachhinein anders oder überhaupt gedeutet werden, all das findet man auch bei Jean-Philippe Toussaint, der etwa von einem älteren Internatsjungen erzählt, der sich mit einem Mysterium umgeben hat, sich in Andeutungen an einen Vater erging, der beim Geheimdienst sei, der nach den Weihnachtsferien ohne Erklärung nicht mehr in die Schule zurückgekehrt ist, und dessen Verschwinden noch immer ein von der Aura der Gefahr und des Todes umwehtes Rätsel darstellt.
So wie Stefan Zweig den Schriftsteller schon sein Leben lang beschäftigt, begleitet ihn auch das Schachspiel seit seiner Kindheit; er erinnert sich an Schachpartien mit seinem Vater, die dieser grundsätzlich gewann, daran, wie er beim Duell Karpov/Kasparov im Publikum saß, wie er in der Schachabteilung der Bibliothek im Centre Pompidou auf andere Gestalten traf, die von diesem Sport auf ähnliche Weise in den Bann gezogen wurden wie er. Auch sein erster, unveröffentlichter Roman hat den Titel Échecs (dt. „Schach“). Und doch ist das Schachspiel für den Schriftsteller Toussaint vor allem eine Gedankenfigur, die ihn durch seinen gedankenreichen Text trägt, der immer wieder in Reflexionen über die Literatur und das Schreiben mündet. Sie fließen aus der Feder eines Schriftstellers, der Kafka und Nabokov bewundert, der in einem Verlag publiziert wird, in dem auch Beckett, Robbe-Grillet und Sarraute verlegt wurden, der das Schreiben als Umgang mit dem Dasein in seiner Existentialität betrachtet, der in der Literatur Schutz vor der Wirklichkeit sucht und diese dabei doch nicht ausblendet, sondern sich intellektuell mit ihr auseinanderzusetzen versucht, wie Odysseus, der den Sirenen zu lauschen vermag, ohne sich von ihrem Gesang töten zu lassen. So hat L’Échiquier eine philosophische Grundierung, die neben einer unbestreitbaren Melancholie auch den Humor nicht ausschließt. Was den Text so sympathisch und lesenswert macht, ist nämlich die immer wieder aufblitzende Selbstironie des sich erinnernden, schreibenden, alternden, aufrichtigen Schachbretthüpfers der Literatur, der mit so treffenden wie komischen Zeilen Einblick in die Detailarbeit aus dem Alltag eines Übersetzers gibt und das augenzwinkernde Porträt eines um Aufrichtigkeit bemühten und doch immer wieder auf Stolpersteine stoßenden existentiellen Sprachsuchers entwirft.
Bibliographische Angaben
Jean-Philippe Toussaint: L’Échiquier, Editions de Minuit 2023
ISBN: 9782707348852
Deutsche Ausgabe:
Jean-Philippe Toussaint: Das Schachbrett, Frankfurter Verlagsanstalt 2024
Übersetzt von Joachim Unseld
ISBN: 9783627003180
Bildquelle
Jean-Philippe Toussaint, L’Échiquier
© 2024 Les Editions de Minuit, Paris