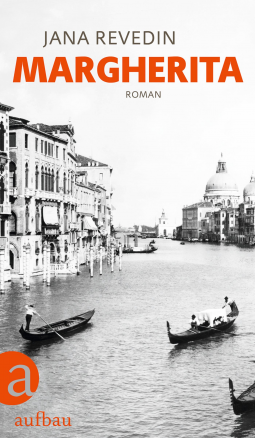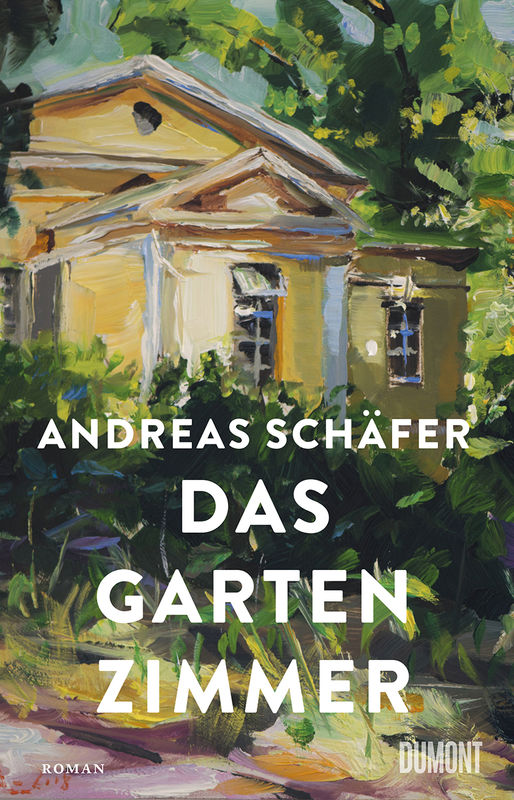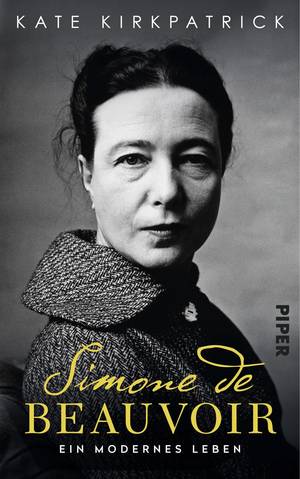Rüdiger Zill stellt seine Biographie von Hans Blumenberg unter das Motto des „absoluten Lesers“ und charakterisiert damit nicht nur das unstillbare Lesebedürfnis des Philosophen, für den die zuerst lesende, dann schreibende Auseinandersetzung mit Texten zeit seines Lebens Antrieb seines Denkens war, ja dessen Werk selbst als fortgesetztes Lesen bezeichnet werden könnte, sondern umreißt damit auch schon die ambitionierte Zielsetzung eines Textes, der Hans Blumenberg als Person und in seinem Denken einfangen möchte, ohne ihn jedoch in absolut gestellten Begriffen seiner Philosophie gefangen zu halten.
Gerade der Begriff des Absoluten würde sich dafür ja durchaus anbieten, lässt er doch an die „absolute Metapher“ aus Blumenbergs Philosophie der Unbegrifflichkeit denken, der Metaphorologie, die eine große Rolle in seinem Denken spielt, oder auch an den „Absolutismus der Wirklichkeit“, in dem er, pointiert gesagt, seine Theorie der Metaphorologie in eine Anthropologie überführt, die die Geschichte des menschlichen Denkens und Handelns zugleich konstant und variantenreich auf eine als übermächtig erfahrene Wirklichkeit bezogen versteht und die etwa sein Kollege Odo Marquard nicht zu Unrecht als Blumenbergs philosophisches Herzstück betrachtet. Doch so wie sich Hans Blumenbergs auf die Spitze getriebene Hermeneutik des absoluten Lesers als letztlich unabschließbares Projekt versteht, so verwehrt sich sein Biograph explizit gegen jeden absoluten Ansatz. Vielmehr geht es Rüdiger Zill vor allem darum, Leben und Werk zu kontextualisieren und das Prozesshafte in Blumenbergs Denken herauszuarbeiten, das ohne Zweifel große, wiederkehrende Lebensthemen aufwies, sich über die Jahre und Jahrzehnte jedoch auf bemerkenswerte Weise immer wieder wandelte, sich der Zeit, den (Lese-) Erfahrungen anpasste, sich formte und umbildete und immer wieder neue, unerwartete Wege und Umwege einschlug.
Rüdiger Zill, Herausgeber der 2019 erschienenen Schrift Die nackte Wahrheit aus dem Nachlass Blumenbergs und selbst Philosoph, ist sich der Herausforderung seines biographischen Unterfangens bewusst, die auch darin besteht, dass der, über den er schreibt, sich anders als seine sehr präsenten Kollegen Adorno oder Habermas zunehmend der Öffentlichkeit entzog; und er stellt sich dieser Herausforderung mit Bravour, mit stilistischem Feingefühl und enormem Erkenntnisgewinn für den auf Blumenbergs Denken und Leben neugierigen Leser. Der Untertitel „intellektuelle Biographie“ trifft, wie ich finde, ziemlich gut, was einen erwartet: ein Buch, das sich nicht oberflächlich oder voyeuristisch am Privaten entlang hangelt, sondern tief in das Denken eines Menschen eintaucht und auf diese Weise fast en passant auch einige bezeichnende Charakterzüge offenlegt, die einem Blumenberg auch als Person näherbringen.
Und natürlich hat sich der Biograph, sich am Ideal des absoluten Lesers orientierend, intensiv mit dem umfangreichen Werk des Philosophen auseinandergesetzt, hat nicht nur die zu Lebzeiten erschienenen wissenschaftlichen Texte studiert, sondern auch alle möglichen weiteren Quellen: unveröffentlichte Schriften, Briefe, Feuilletonartikel, Typoskripte — und nicht zuletzt auch Blumenbergs mit Leselisten und Zettelkästen reich dokumentierte intellektuelle Vorarbeiten eines nicht immer in Veröffentlichungen mündenden unermüdlichen Denkens. Die Vertrautheit Zills mit dem Werk des Philosophen, aus dem er viele spannende Passagen zitiert, spürt man auf jeder Seite. Geschmeidig bewegt er sich durch komplexe Gedankengänge, ja macht sich fast selbst schon das Denken Blumenbergs in seiner Argumentation zu eigen, spinnt es weiter, in einem reflektierten und kritischen Dialog mit dem Philosophen, dessen Gedanken er in ihrer Genese ebenso sichtbar macht wie in ihrer immer wieder frappierenden Tauglichkeit für heute und für die Zukunft.
So liegt ein Hauptverdienst des Buches auch darin, dass es all die Verknüpfungen herausarbeitet, zwischen Philosophie und Leben, Lesen und Schreiben, zwischen den verschiedenen Phasen seines Lebens und Denkens. Um das zu erreichen, hat Zill auch eine für eine Biographie zunächst etwas ungewöhnlich erscheinende Komposition gewählt. Er unterteilt sein Buch in drei große Teile: Der „Beschreibung des Lebens“, einem im engeren Sinne biographischen ersten Teil, folgt in „Arbeit am Werk“ ein kürzerer Abschnitt über die verschlungenen Wege von Blumenbergs Publizieren und Schreiben, die nicht immer einfache Beziehung zu Verlegern und Redakteuren, zu seinem Publikum, und in „Der Prozess einer philosophischen Neugierde“ ein umfangreicher dritter Teil, in dem sich Zill vor dem bereits geschilderten Hintergrund von Leben und Publikationstätigkeit auf Blumenbergs Philosophie konzentrieren kann, deren Wesen oder „Selbstverständnis“, wie er es nennt, er anhand mehrerer Schlüsseltexte herausarbeiten möchte.
Auch wenn nicht viele Äußerungen Blumenbergs über seine Kindheit und Jugend überliefert sind und er ja ohnehin generelle Vorbehalte gegenüber memoirenhaften Erinnerungen hatte, lassen sich doch ein paar aufschlussreiche biographische Erfahrungen herausarbeiten, die auch so manche Entwicklungen seines Lebens und Denkens verständlicher machen. 1920 in Lübeck geboren erlebte Hans Blumenberg das Dritte Reich als Jugendlicher und junger Mann. Ebenso wie ihn der Katholizismus des Vaters und der Humanismus seiner ersten Schule prägten, hinterließ auch die Erfahrung des Nationalsozialismus und des Krieges Spuren in ihm, hielt sie doch eine Art ersten schmerzhaften Kontakt mit dem „Absolutismus der Wirklichkeit“ für ihn bereit: Als Sohn einer zum Christentum konvertierten Jüdin gestaltete sich der Beginn seiner akademischen Laufbahn schwierig; studieren durfte er aufgrund der restriktiven antisemitischen Politik zunächst nur an einer katholischen Hochschule und bald überhaupt nicht mehr. 1942 wurde sein Elternhaus — und mit ihm auch die gesamte Bibliothek des in alle Richtungen belesenen jungen Mannes, für den in den Worten Zills „diese Nacht eine Art ersten Tod“ (S. 7) bedeutete — bei einem Flächenbombardement zerstört und Blumenberg zum Arbeitsdienst verpflichtet; später wurde er für einige Zeit in einem Arbeitslager interniert, und die letzten Wochen vor der Kapitulation verbrachte er untergetaucht in der Dachkammer einer Lübecker Schuhmacherfamilie, deren Tochter dann seine Frau und die Mutter von insgesamt vier gemeinsamen Kindern wurde.
Nachdem es während dem Krieg zeitweise so ausgesehen hatte, als stünde ihm eine Laufbahn als Firmenangestellter bevor, nutzte er schon im Wintersemester 1945/46 die Gelegenheit, sich an der Universität in Hamburg für die Fächer Philosophie, Germanistik und Griechisch zu immatrikulieren. Getrieben von dem Gedanken, die verlorene Zeit aufzuholen und außerdem in Sorge, seine junge Familie zu versorgen, absolvierte er sein Studium in kürzester Zeit und schloss schon 1947 seine Dissertation ab. Sein Doktorvater war der Phänomenologe Ludwig Landgrebe, dem er an die Universität Kiel folgte, wo er sich — nach einigem universitären Streit — auch habilitierte. Die nächsten Stationen seiner Laufbahn waren Hamburg, Gießen, Bochum und zuletzt bis zu seiner Emeritierung 1985 Münster, unter seinen Weggefährten befanden sich der Altphilologe Bruno Snell, der Romanist Hans Robert Jauß, mit dem er die einflussreiche Forschungsgruppe „Poetik und Hermeneutik“ gründete, und für eine kurze Zeit auch Jürgen Habermas, mit dem er die Reihe „Theorie“ im Suhrkamp Verlag herausgab. Rüdiger Zill schildert Formen des ergiebigen geistigen Austausches Blumenbergs mit Lehrern, Förderern und Kollegen, genauso aber auch, wie er immer wieder aneckte, sich mit universitären Autoritäten oder Verlegern anlegte, Projekte beendete, wie er — auch als er sich längst einen Namen gemacht hatte, — zeitlebens das Gefühl hatte, um die Anerkennung seiner Arbeit ringen zu müssen.
Während sich die Charakterisierung Blumenbergs als vielseitig interessierter und exzessiver Leser — Zill nennt ihn einen „bibliophile(n) Allesfresser“ und „intellektuellen Freigeist“ (S. 99), der sich für Wissenschaft, Technik, Philosophie und eben auch für die schöne Literatur interessierte — wie ein roter Faden durch das Buch zieht, geht insbesondere aus dem zweiten Teil hervor, wie die Prozesse des Lesens und Schreibens einander wechselseitig bedingten. Aufschlussreich ist, dass sich der Philosoph gerade in seinen Anfängen intensiv mit literarischen Texten auseinandersetzte, seinen auf das Narrative, Anschauliche ausgerichteten Stil nicht zuletzt an Interpretationen von Dostojewski, Kafka, Valéry schulte und sich in seinen frühen Beiträgen fürs Feuilleton, wie Zill das nennt, auch für seine philosophischen Texte „freischreiben“ konnte. Immer auch kritisch mit sich selbst, freute Blumenberg sich umso mehr über das Lob seines Redakteurs Neukirchen, bei dem er seinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz für die Zeitschrift Studium Generale eingereicht hatte:
„Du hast sehr genau gemerkt, was mir die Sprache, das Wort bedeuten, daß ich mich mit der Korrosion und Erosion gerade des wissenschaftlichen Wortschatzes nicht abfinden mag und mich doch auch von Heideggers Etymologisterei abgestoßen fühle, daß ich also dem Begriff seine Obertöne an Bedeutung zurückzugeben bestrebt bin (…).“
Blumenberg, zit. nach Zill, Der absolute Leser, S. 211
Zum Feuilleton, mit dem er in den 1950er Jahren sein Schreiben begann, kehrte er am Ende seines Lebens auch wieder zurück, mit Glossen für Tageszeitungen, geisteswissenschaftlichen und kulturkritischen Texten. Dazwischen liegt als sichtbarer Höhepunkt die Publikation einer Reihe von Monographien, mit denen er — bezeichnenderweise erst spät, nachdem er längst ordentlicher Professor war — auch über die akademischen Kreise hinaus Berühmtheit erlangte: Die Legitimität der Neuzeit, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Arbeit am Mythos, Die Lesbarkeit der Welt — um nur ein paar der bekanntesten Titel zu nennen. Darüber hinaus gibt es jedoch noch eine Vielzahl an Texten, in denen sich die verschiedenen Stadien des intellektuellen Lese- und Schreibprozesses spiegeln, Vorlesungsskripte etwa, Vorträge, Aufsätze für Fachzeitschriften. Und es gibt Blumenbergs Leselisten und Zettelkästen, die so einiges über seine Denk- und Verstehensprozesse verraten. Zill führt in einem sehr spannenden Kapitel aus, wie sich der experimentelle Umgang mit dem Material auch auf weiteren Stufen fortsetzt, wie Blumenberg zunächst für die Vorlesungen eine erste schriftliche Verarbeitung seiner Gedanken unternimmt, wie diese später dann in Aufsätze umgewandelt und aus den Aufsätzen wiederum durch weitere Prozesse „des Schreibens und Umschreibens, des Erweiterns und Revidierens“ (S. 395) Monographien entstanden.
Entsprechend legt Zill den Fokus auch im dritten Teil, in dem die Philosophie im Zentrum steht, auf das Prozessuale, die Wandelbarkeit und Offenheit von Blumenbergs Denkens. Früh interessierte ihn der Zusammenhang von Wissenschaft und Wahrheit, und die Rolle, die die Philosophie in diesem Kontext einnimmt. Die Auseinandersetzung mit den philosophischen Strömungen seiner Zeit und gewiss auch seine eigene Lebenserfahrung brachten ihn dazu, dem Absoluten in jeder Hinsicht zu misstrauen und die Geschichtlichkeit des Menschen und seines Denkens, quasi als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis, in den Vordergrund auch und gerade der Philosophie zu rücken. Für ihn, der sich empörte, wenn man ihn einen bloßen Philosophiehistoriker nannte, gehörten auch in der Philosophie Geschichte und System untrennbar zusammen. Über seine Forschungen zur Wissenschaftsgeschichte und mehr und mehr auch der Geschichte der Technik kristallisierte sich allmählich der Gedanke der Freiheit heraus und eröffnete einen neuen Weg zu einer Kritik der reinen Rationalität:
Kopernikus ist für Blumenberg nicht einfach der Befreier, der dieses System [das dogmatische Weltbild des Mittelalters] durch den Gebrauch der Vernunft zerschlagen hat, sondern jemand, dessen Denken überhaupt erst möglich war, nachdem sich dieses System aufgrund seiner inneren Widersprüche selbst zersetzt und dadurch einen Raum für Gedankenspiele eröffnet hatte (…).
Zill, Der absolute Leser, S 469
So wie Blumenberg die Philosophie nun als werdendes Selbstbewusstsein des Menschen verstand, verschob sich der Fokus seines Interesses von der Geistesgeschichte zur Anthropologie. Dabei rückte dann auch ein früheres Randthema auf einmal prominent in den Vordergrund, nämlich seine Gedanken zur Metaphorologie. Das Wirklichkeitsverhältnis des Menschen betrachtete er grundlegend als ein metaphorisches, also eines der Distanz. Und über diese Umwegstruktur der Metapher, die den indirekten, verzögerten, umständlichen Bezug zur Wirklichkeit kennzeichnet, über die Erforschung von kleinen Formen der „Unbegrifflichkeit“ wie der Anekdote oder der Fabel, gelangte er schließlich zu seiner Philosophie der Umwege und der Antimethode (in Analogie und Abgrenzung zu Descartes‘ Discours de la méthode), die ihn am Ende seines Lebens am meisten beschäftigte und die sich auch publizistisch im Übergang zu den Formen des Fragments und der Glosse niederschlug. Das Narrative, per se dem Umweg verpflichtet und gegen das Diktat der Effizienz gerichtet, blieb auch diesen kurzen Formen erhalten, und lässt sich generell als Charakteristikum seiner Schriften betrachten, die nicht immer einfach zu lesen, aber zur Freude auch des heutigen Lesers stets auf Anschaulichkeit bedacht sind.
„Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?“ — „Sagen zu können, was ich sehe.“
Blumenberg, zit. nach Zill, Der absolute Leser, S. 78
Der Umweg im Sinne Blumenbergs verstanden als Abenteuer, das nicht ziel- und zwecklos ist, sondern überraschende Erkenntnisse liefert, ist auch ein wenig das Strukturprinzip von Rüdiger Zills Biographie. Sie erfordert bei den vielen und vielfach verknüpften Gedankengängen, die sie verfolgt, einiges an Konzentration, und ist daher auch als Einstiegslektüre zu Blumenberg nicht wirklich geeignet. Wer sich aber für Philosophie begeistert und Blumenberg vielleicht bereits in dem einen oder anderen Text begegnet ist, kann sein Verständnis von seiner Philosophie in diesem Buch wunderbar vertiefen — und sich beeindrucken lassen, wie zeitlos bzw. wie zeitgemäß gerade heute sein Denken erscheint.
Rüdiger Zill: Der absolute Leser — Hans Blumenberg, eine intellektuelle Biographie, Suhrkamp (2020)
ISBN: 9783518587522