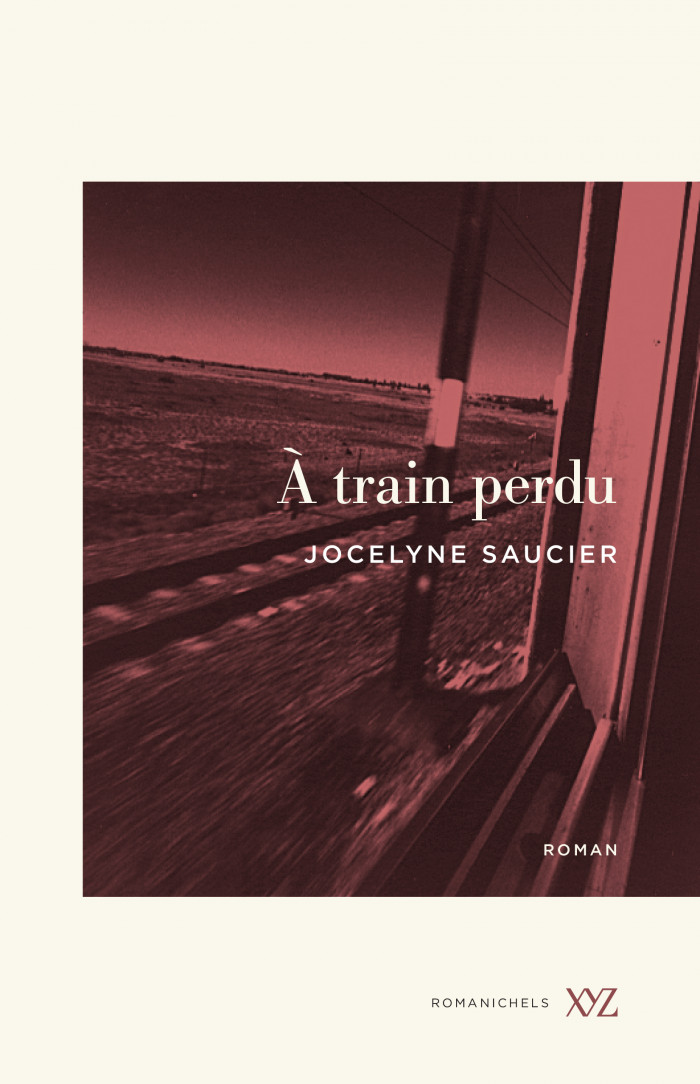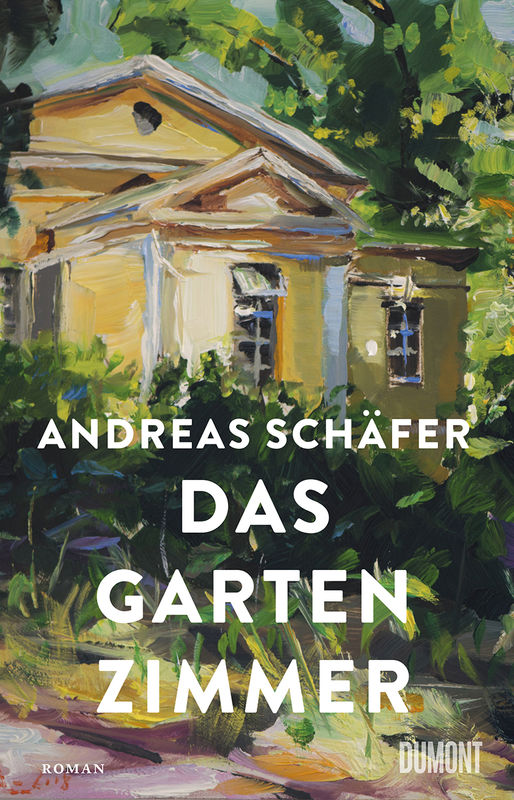Sanft melancholisch, nachdenklich und in einer geglückten Balance aus emotionaler Involviertheit und selbstironischer Distanz erzählt Jocelyne Saucier in A train perdu von den entlegenen Weiten, dichten Wäldern und stillgelegten Minen eines wenig bekannten Kanadas fern der Metropolen, von einem im Verschwinden begriffenen Schienennetz, das die abgelegenen Dörfer im nördlichen Ontario und Québec, einst blühende Bergarbeiterstädte, nur noch rudimentär miteinander verbindet, und von einer Frau, die dieser Gegend entstammt, die mit ihr verwachsen ist und sich am Ende ihres Lebens auf eine unumkehrbare Reise macht, mit der sie das Leben ganz unterschiedlicher Menschen aus der Region durcheinanderbringt.
Ausgangspunkt der Erzählung ist das Verschwinden, ist die Flucht, die Reise, die Mission der alten Gladys Comeau, die unangekündigt und zur großen Verwirrung und Bestürzung ihres Umfelds von heute auf morgen ihr Dorf mit dem auffälligen Namen Swastika verlässt, um — wie sich bald herausstellt todkrank — mit wechselnden Zügen quer durch das nördliche Kanada zu fahren. Ihre Route, die sich dem Zufall ergeben entlang dem teilweise schon außer Betrieb gesetzten Schienennetz entfaltet, mag von außen verwirrend erscheinen, und doch hat Gladys ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen, das der Ich-Erzähler und selbst ernannte Chronist dieser Geschichte allmählich zu verstehen und dem Leser zu vermitteln beginnt.
Mit der Spurensuche des Erzählers, die dieser zeitlich leicht versetzt aufnimmt, taucht man in die Lebenswelt der Region ein, eine in einem nicht mehr aufzuhaltenden Wandel begriffene, gleichwohl vergleichsweise noch immer entschleunigte Welt. Die ewige Verspätung der Züge macht hier niemandem etwas aus, viele der kleinen Dörfer sind noch immer nur mit der Eisenbahn erreichbar. Jocelyne Saucier führt uns zurück in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg und bis in die Gegenwart. A train perdu ist eine Reise in die Vergangenheit des Landes und seiner Bewohner, erzählt in vielen kurzen, einfühlsamen Porträts „gewöhnlicher“ Menschen. All die Streckenarbeiter, Waldarbeiter, Erzgräber, Fallensteller, die Einwanderer und die Eingeborenen, alle führten sie ein einfaches Leben, abgeschottet vom Rest der Welt; diese „petits sauvageons des bois“ (A train perdu, S. 67) konnten kein Englisch und erhielten ihre Bildung in den sogenannten „school trains“, Schulen auf Rädern, von Güterwägen gezogen, die zwischen 1926 und 1967 in den Wäldern Ontarios die einzige Möglichkeit für die Einwohner waren, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Gladys, die am Ende ihres Lebens wieder in die rollende Welt der Züge zurückkehrt, war in dieser Umgebung sozialisiert worden, ihre Eltern waren Lehrer in den „school trains“ gewesen. Später hatte Gladys Albert, einen stillen, melancholischen Jungen aus den Wäldern, geheiratet, den sie nur ein Jahr nach der Hochzeit bei einem Grubenunglück verlor. Das gemeinsame Kind, Lisana, lebt inzwischen, längst erwachsen und selbstmordgefährdet, wieder bei ihrer Mutter. Auch sie lässt Gladys zurück, als sie sich auf ihre letzte Reise macht, ihr großes, einst so fröhliches Kind, das studiert hat und dann mit Depressionen wieder in die Heimat zurückkehrte. Man lernt auch die Nachbarn von Gladys kennen, die sich nach ihrem Verschwinden Vorwürfe machen und alles auf den Kopf stellen, um die Flüchtige wieder einzufangen, die sich ihnen jedoch geschickt zu entziehen versteht. Unterstützt wird sie dabei von Jeanette, einer Frau, der Gladys auf ihrer Reise begegnet, auch sie eine, die den Zug als Heimat begreift.
Da die écriture in diesem fein gesponnenen Text ein großes Thema und gewissermaßen der rote Faden der Geschichte ist, der sich entrollt, Knoten bildet und wieder löst wie das nostalgische kanadische Schienenetz, möchte ich noch einmal auf den selbst ernannten Chronisten und sein Schreiben zurückkommen. Seine stilistische Neigung zu Dreierschritten, die sich durch die gesamte Erzählung ziehen und am Schluss in einer ins Transzendente gewendeten, lebensbejahenden Symbolik kulminieren, ist auffällig; sie sind weniger als Klimax denn als ein Sich-Annähern zu verstehen, was der Aufgabe entspricht, die sich der Ich-Erzähler gegeben hat und die ihm geradezu eine Philosophie geworden ist, eine Einstellung, mit der er sein Dasein und das der anderen zu begreifen und einzuordnen versucht:
Mais il n’y a que Gladys, il y a tous les autres qui m’ont hélé, harcelé, harnaché à cette quête ou enquête — je ne sais plus ce que c’est — que je dois maintenant relater.
Doch nicht nur Gladys, auch all die anderen haben mich zu dieser Untersuchung oder Selbstsuche — ich weiß selbst nicht mehr, was es ist — angehalten, gedrängt, angespornt, von der ich nun Zeugnis ablegen muss.
J’ai à sonder, à élucider, à comprendre mes propres motivations.
Ich muss nachforschen, aufklären, meine eigenen Motive verstehen.
Saucier, A train perdu, S. 12 f. (Übersetzung der Rezensentin)
Von diesen anderen sollten zwei hier Erwähnung finden, da sie dem Suchen und Schreiben des Chronisten jeweils eine neue Richtung geben: erstens ein Mann mit Schal am Bahngleis, der dort die Leute ausfragt und sich als französischer Autor aus Paris entpuppt, der nach Kanada gereist ist, um dem Dorf mit diesem ungewöhnlichen, historisch vorbelasteten Namen, Swastika, auf den Grund zu gehen und seine Geschichte ans Licht zu bringen; zweitens ein Biolehrer und Freund des Chronisten, den dieser im Stadtmuseum kennengelernt hat und der sich für die Geschichte der Gegend, insbesondere für das schreckliche Grubenunglück, dem auch Gladys Mann zum Opfer gefallen war, interessiert, und der außerdem ein großes Misstrauen gegen jede Form der Ausschmückung und der Fiktion hegt.
Die Vorgehensweise des Ich-Erzählers ist denn auch geprägt von genauem Beobachten, Zuhören und Nachfragen, es ist ein feines Erzählen mit vielen Zwischentönen, das mehrere, oft auf den ersten Blick undurchsichtige Ebenen der Wahrnehmung und der Handlungsmotivation zugleich aufscheinen lässt. So gelingt auch immer wieder ein Blick unter die Oberfläche, der, wenn nicht zwangsläufig einen Widerspruch, so doch ein komplementäres Bild zu dem, was von außen sichtbar ist, erkennen lässt. Denn in den Geschichten der Menschen klingt in erster Linie eine große Zufriedenheit und Bescheidenheit auf, eine liebevolle Verbundenheit mit der Region, die früher belebter, lebendiger schien, eine Nostalgie wird spürbar, aber keine lauten Klagen, vielmehr der Stolz auf die spärlichen Früchte eines mühsamen Lebens. Die écriture von Jocelyne Saucier transformiert diese berührende, gleichwohl nicht vor Lebensfluchten und -Lügen gefeite Haltung in ihrem Text in einen menschenfreundlichen Humor angesichts einer tiefen Melancholie, eines Glückes, das vergänglich ist, flüchtig, wie die vorbeigleitenden Eisenbahnen in den Weiten eines wenig bekannten Kanada.
A train perdu ist ein Werk in Bewegung, das sich langsam, aber unaufhörlich, dem poetischen Rattern der alten Zugräder gleich, entfaltet und den Leser immer wieder mit kleinen Verschiebungen und subtilen Veränderungen überrascht. Die Begegnung mit dem Text hat wie die in ihn eingebundenen Figuren zunächst eine Zufälligkeit, die an Kontur und Tiefe gewinnt, ohne je an Offenheit zu verlieren. Ein in all seiner Realitätsnähe und Menschlichkeit wahrhaft magisches Buch!
Bibliographische Angaben
Jocelyne Saucier: A train perdu, Les Editions XYZ 2020
ISBN: 9782897722470
Bildquelle
Jocelyne Saucier, A train perdu
© 2024 Editions XYZ, Montréal (Québec)