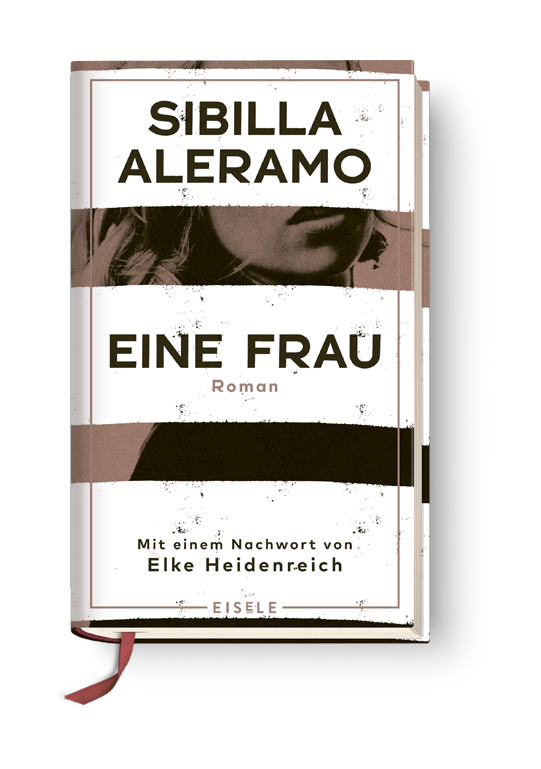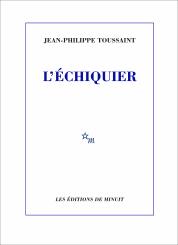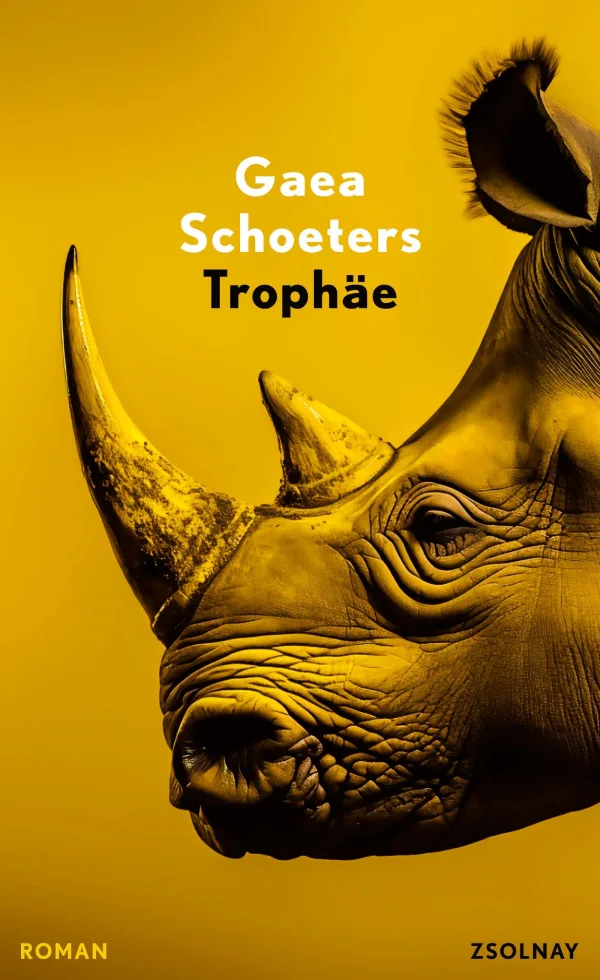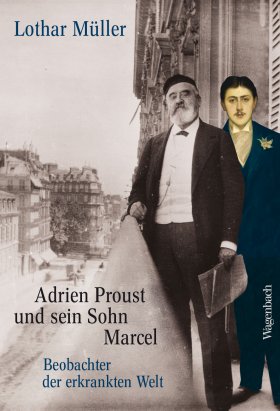Autofiktionale Verarbeitung von deutschen Familiengeschichten aus der Perspektive der Generation, die den Krieg nicht mehr selbst erlebt hat, aber seine erdrückenden oder beengenden Folgen über die Eltern oder Großeltern noch zu spüren bekommt, scheint momentan wieder ein Trend auf dem Buchmarkt zu sein. Diese Texte, die sich, meist schmerzhaft, mal mit der ostdeutschen, mal mit der bundesdeutschen Gesellschaft, mit weiterwirkenden patriarchalen Machtstrukturen, mit versteckten Traumata, mit fragwürdigen Erziehungsmethoden, auseinandersetzen, sind stilistisch sehr unterschiedlich: die Spannbreite reicht von akribisch recherchierten Büchern mit vorwiegend dokumentarischem Charakter bis hin zu stark fiktionalisierten Romanen, in denen sich das erzählende Ich deutlich vom Autor abgrenzen lässt. Michael Lentz geht in Heimwärts noch einen anderen Weg, der deutlich selbstreferentielle, bisweilen poetologische Züge aufweist, das Erinnern und ihre Versprachlichung in vielen mäandernden Bildern selbst zum zentralen Gegenstand des Textes macht. Diese zugleich radikal subjektive und stark reflektierende, literarische Herangehensweise an die eigene Familiengeschichte ist einerseits bemerkenswert, andererseits führt die Gleichzeitigkeit von Innerlichkeit und poetologisch-philosophischem Anspruch in diesem Fall zu einer wohl auch bewusst herbeigeführten stilistischen Heterogenität, die intersubjektiv schwer greifbar ist, es also dem Leser nicht gerade einfach macht, der sich immer wieder entziehenden, richtungslos dahinfließenden Erzählung zu folgen, die auf einen dramaturgischen Spannungsbogen verzichtet und einen mitunter ein wenig die Orientierung verlieren lässt.
Gleichwohl ist der Text nicht ohne Struktur, die man vielleicht als diejenige des Schachtelteufels bezeichnen könnte. So wie der Erzähler schon als Kind von den Schachteln und Truhen und Regalen mit Einmachgläsern fasziniert ist, deren Inneres er im Haus der Eltern meist heimlich untersucht, erhebt er die Verschachtelung zum Prinzip seines Textes. Es ist ein Ineinander von mehreren Perspektiven, der kindlichen und der erwachsenen des Erzähler-Ichs, in die er, fast unmerklich, auch noch das Ich seines eigenen Kindes hineinschreibt; es ist auch ein Ineinander von Vorstellung und Wirklichkeit, von Halluzination und Traum, die in der Erinnerung oft kaum voneinander zu unterscheiden sind und dem Leser einen auch oft bedrückenden Einblick in die Psyche des kindlichen Erzähler-Ichs geben, die im sich erinnernden, schreibend nach Ordnung suchenden Erwachsenen weiterhin ihr „Unwesen“ treibt und der er mit den Mitteln der Sprache, der Literatur entgegenzugehen versucht — sowie in seiner, so scheint es immer wieder durch, als große Verantwortung empfundenen Rolle als Vater, als der er so ziemlich alles anders machen will als sein eigener Vater. Dass das Aufwachsen in den 60er und 70er Jahren in seiner Familie, bei seiner depressiven Mutter und seinem sich noch unmissverständlich als Patriarch verstehenden Vater von ihm zugleich als beklemmende Enge und fehlende emotionale Nähe erlebt wurde, davon sprechen die Erinnerungsbilder, die der Erzähler in vielen Variationen heraufbeschwört, eindrücklich. „Die jammernde Mutter. Der strafende Vater. Das nicht ausweichen könnende Kind.“, so heißt es im Text einmal. Der Mangel an Geborgenheit entspricht einem wiederkehrenden Missverstehen in der Beziehung zwischen Eltern und Kind, und darüber hinaus in der Beziehung des Kindes mit der Welt, die sich — auch noch dem sich erinnernden Erzähler — als große Unordnung präsentiert, in der sich innen und außen nur selten miteinander in Einklang bringen lassen. Wenn die Zeit als „zunehmende Unordnung“ erlebt wird, leitet der Erzähler, schon als Kind, daraus ein Verständnis der Gegenwart ab, in der es seine Aufgabe ist, Ordnung herzustellen. Daher rührt die Bedeutung, ja die große Faszination, die Worte und Wörter, seit seiner sprachlichen Initiation des als ambivalent erlebten Lesenlernens, für den Erzähler haben. Während er in der mit der Sprache verbundenen Imaginations- und Assoziationskraft, ihrer Affinität zum Experiment, zur Gestaltung und ja, zur Anarchie, eine Form von Freiheit erfährt, die ihn aus der Enge des Elternhauses heraushebt, werden um ihn herum die Worte auch anders benutzt, als in sprachliche Klischees gehüllte Glaubenssätze und Machtinstrumente.
Indem der Erzähler kreativ mit der Sprache als Material umgeht, führt er das, was er als Kind, noch gefangen im magischen Denken, als immer auch von Furcht begleitetes emanzipatorisches Projekt begonnen hat, schreibend fort: eine ganz auf der Ebene der Sprache praktizierte Selbstsuche, eine Annäherung an die Wirklichkeit, die nicht mehr ausschließlich über eine Ordnung der Gegenwart erschließbar wird, sondern gleichfalls eine Annäherung an die Vergangenheit zur Bedingung hat. Diese Annäherung, als welche der Erzähler, und sicher auch der Autor Michael Lentz, die Erinnerung versteht, ist ein letztlich unabschließbarer, bruchstückhaft bleibender Prozess, der für ihn nur über die Sinnlichkeit der Gegenstände — als welche auch die Worte erscheinen — vorangetrieben werden kann. Der Erzähler hangelt sich an der Sprache entlang, an Ausdrücken, die er in Metaphern verwandelt und die ihm zu Erkenntnis- oder vielleicht eher Annäherungsinstrumenten werden, um die als so flüchtig wie manipulierbar wahrgenommene Erinnerung irgendwie greifen zu können. Der Text, der so sehr um Sprache kreist, übt auf einer weiteren Ebene fast permanent Sprachkritik als Erkenntniskritik, und er legt ein Misstrauen gegenüber der Erinnerung an den Tag, das nur scheinbar im Widerspruch dazu steht, dass das ganze Buch als mäandernder Erinnerungsfluss konstruiert ist. Vielmehr tritt auf diese Weise das Kippbare als das Eigentümliche der Erinnerung hervor, die sich vielleicht besser über die Sinne und Gefühle erfassen lässt als über das rationale Bewusstsein. So sind auch die Worte, gleich den Gegenständen aus der Kindheit, die wie der bunt zusammengewürfelte Inhalt einer alten Spielzeugtruhe nacheinander zum Inhalt der einzelnen Kapitel werden, mit ambivalenten Gefühlen, mit Begehren wie mit Angst, verknüpft; auch die zunehmend bedrohlich wirkende Zerstörungswut des Kindes führt den schmalen Pfad vor, auf dem der Erzähler in seiner fragil erlebten Erinnerung wandelt. Das Anarchische hat eine konstruktive und ebenso eine destruktive Seite, es schafft Freiräume und vernichtet; genauso hat die Wut eine Kehrseite, verwandelt sich in manchen Momenten in ein Empfinden von Angst und Verlorenheit.
Durch eine Art mikroskopisches Erzählen, einem Erzählen mit vielen Details und Verästelungen, wird der begrenzte Raum des Kindes, die Bedrückung und Enge, die es verspürt, sprachlich vermittelt; die Beschreibungen sind teilweise minutiös, wie mit der Lupe werden hier einzelne kleinste Szenen und Stillleben aus dem Alltag einer Familie in den 1960er Jahren vergrößert und auf fast ein bisschen unheimliche Weise verlangsamt. Diesem sezierenden Schauen wohnt immer etwas Heimliches, etwas Verbotenes inne, ein Gefühl, das den Jungen von damals im Haus seiner Eltern niemals loslassen mag. Gleichzeitig ist sein Erkundungsdrang übermächtig, akribisch wird der Inhalt einer alten Truhe mit Erinnerungsstücken der Mutter ebenso auseinandergenommen wie ein Regal mit Quittengelee im Keller oder ein Insektengefängnis; und immer wird von da aus sprachlich eine Welt aufgemacht, eine Welt der Erinnerung, der Gefühle, der Beobachtungen und der minimalen Grenzüberschreitungen. Jede dieser mikroskopischen Untersuchungen, für die der Erzähler intensiv das Stilmittel der Metapher einsetzt, zeigt, wie nahe Konstruktion und Destruktion beieinander liegen, wie sie sich in der Psyche des Kindes vermischen, das sich — gewissermaßen noch im exzessiven Lernprozess der symbolischen Formen — aus den Lexika der Erwachsenen komplizierte Wörter „stiehlt“ und das seine eigenen Rachepüppchen herstellt, um die Spannungen in der Familie zu kanalisieren und zu transformieren. Mit der Materialität der untersuchten Gegenstände, mit der Körperlichkeit seiner Metaphern führt Michael Lentz einem die schmerzhafte Körperlichkeit der Einsamkeit vor Augen, mit der sein Erzähler einen Umgang sucht, offenbart er ohne pathetische Affirmationen, einfach mit dem Mittel der Sprache, ein tief verletztes, ein angegriffenes Ich. Ein Ich, das zwischen Enge und Verlorenheit, zwischen Last und Verflüchtigung, zwischen Bedeutung und Bedeutungslosigkeit hin und herpendelt, das einerseits das Gewicht des Vererbten, des transgenerationell weitergegebenen Traumatischen, der überholten Erziehungsstile wie der alten Gegenstände als erdrückende Last verspürt, und andererseits das Verblassen der noch nicht ausreichend verstandenen oder verarbeiteten Vergangenheit wie der Gegenwart, das Unzuverlässige einer sich kontinuierlich entziehenden Erinnerung. Michael Lentz verwandelt in seinem jedoch nicht leicht zugänglichen Buch diese so subjektive wie generationelle Erfahrung in Literatur und schreibt ein mikroskopisches Kapitel der bundesdeutschen Geschichte, indem er anstelle von historischen Fakten die tieferen Schichten der Psyche erforscht und einen Einblick gibt in das Unterbewusstsein einer Generation.
Bibliographische Angaben
Michael Lentz: Heimwärts, S. Fischer Verlag 2024
ISBN: 9783103975185
Bildquelle
Michael Lentz, Heimwärts
© 2024 S. FISCHER Verlag GmbH, Frankfurt am Main