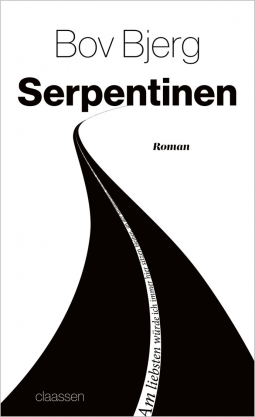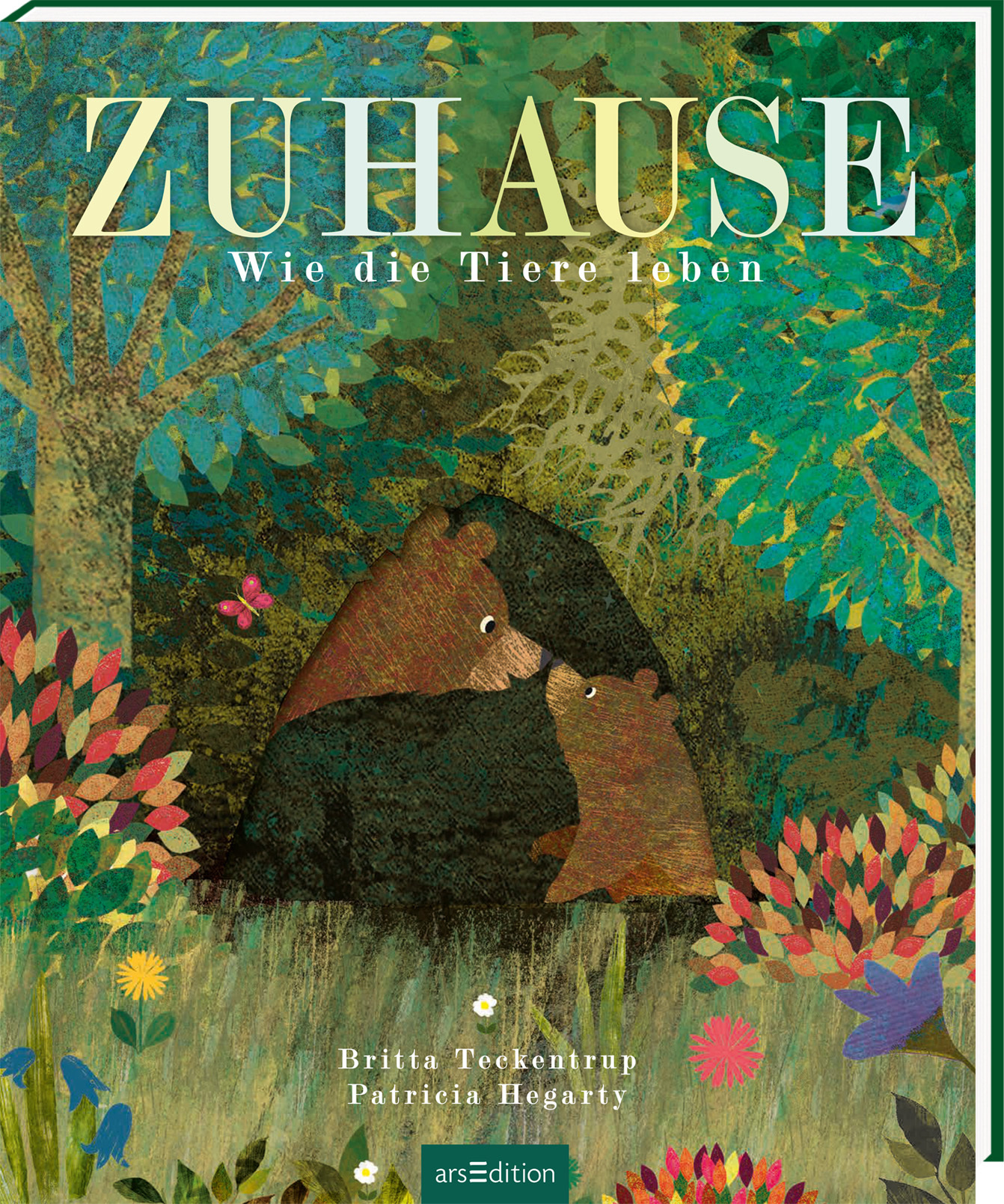Zoë Beck hat sich als Autorin anspruchsvoller Spannungsliteratur in der Vergangenheit bereits einen Namen gemacht, zuletzt in Die Lieferantin und Schwarzblende, in denen sie gesellschaftlich konfliktreiche und komplexe Stoffe der Gegenwart oder einer beunruhigend realistisch erdachten nahen Zukunft auf intelligente und unterhaltsame Weise gestaltet hat. Vielleicht kann man sie ein wenig mit dem französischen Schriftsteller Olivier Norek vergleichen, der in seinen Kriminalromanen ebenfalls sehr überzeugend ein ähnliches Ineinander von Spannung und gesellschaftlicher Wachsamkeit anstrebt. In seinem Roman Entre deux mondes (dt. All dies ist nie geschehen, Blessing 2019) zum Beispiel verarbeitet Norek am Beispiel des „Dschungel“ genannten Flüchtlingslagers in Calais auf vielschichtige Weise das Thema Flucht und Migration, indem er, ähnlich wie das auch Zoë Becks Stärke ist, über die Figurenebene viele ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema psychologisch nachvollziehbar und authentisch ins Geschehen einzubinden versteht.
In Becks neuestem Roman, Paradise City, entspinnt sich die Kriminalhandlung vor dem detailreich und durchdacht geschilderten Hintergrund unserer Gesellschaft, wie sie in einer v.a. medizin- und sicherheitstechnisch konsequent weitergeführten Fortentwicklung der Gegenwart in einigen Jahrzehnten aussehen könnte. Auch diesmal wirft die Autorin viele gesellschaftspolitische und ethische Fragen auf und regt über die vielfach ambivalenten Implikationen eines schon heute relevanten Themas zum Nachdenken an, anstatt moralisch eindeutige Antworten zu geben.
Der Klimawandel und das Sicherheitsbedürfnis der Menschen haben ihre Spuren hinterlassen in dem Deutschland, das Zoë Beck sich für ihren neuen Roman ausgemalt hat. So fliegt schon mal ein Papagei vorbei, es gibt heftige Winterstürme und Sturmfluten, so manche Stadt im Norden ist dem gestiegenen Meeresspiegel anheimgefallen, statt Berlin, das nur noch als historisches Ausflugsziel geschätzt wird, als Museum der Vergangenheit —
Wie alle Kinder war sie (die Hauptfigur Liina) mit ihrer Familie schon mal in Berlin gewesen, gebucht hatten sie die Geschichtserlebniswoche „Berlin 2021“
Beck, Paradise City, S. 45
— ist Frankfurt am Main zur Hauptstadt geworden, man reist auch fast nicht mehr und nur innerhalb eines überschaubaren Radius, exotische Länder besucht man höchstens virtuell, gelten sie doch mehr als Gefahrenquelle denn als attraktives Reiseziel, und auch gesundheitstechnisch hat sich einiges getan: Die Bedrohung durch lebensgefährliche Krankheiten wurde minimiert, nachdem Aids und Krebs nun medizinisch geheilt werden können, die schlimmsten bevölkerungsdezimierenden Infektionswellen hat man bereits hinter sich gebracht, und damit sich am erreichten Fortschritt auch nichts ändert, wird alles engmaschig überwacht und kontrolliert. Ein so genanntes Smartcase, der Nachfolger unseres Smartphones, speichert alle Gesundheitsdaten, registriert die kleinsten Anzeichen medizinischer Gefährdung, auf die der auf Prävention eingestellte Algorithmus unmittelbar reagiert, etwa mit der Anweisung bestimmte Tabletten einzunehmen, der vorbeugenden Erhöhung einer Dosis, mit Vorladungen zum Arzt oder ins Krankenhaus. So praktisch das ist und so sehr es die Gesundheitsvorsorge der Menschen verbessert, erinnert ein solcherart mit eigenmächtigen Algorithmen ausgestattetes Gesundheitssystem doch beängstigend an das Sozialkreditsystem, das in China längst Realität ist. Auch in Becks deutscher Zukunftsgesellschaft gibt es etwa für Sport oder regierungspolitische Konformität Zusatzpunkte und eine schönere Wohnung.
Niemand geht ohne Smartcase raus. Mit dem Smartcase bezahlt man, es dient als Personalausweis, sämtliche Zugangsberechtigungen — ebenso wie die Bereiche, für die man gesperrt ist — sind darauf gespeichert, die Gesundheitsdaten sind darüber im Notfall abrufbar, einfach alles. Das Smartcase ist ein flexibler Körperteil, und seit gefühlten Ewigkeiten reden Tech-Konzerne davon, dass es bald komplett unter der Haut verschwindet.
Beck, Paradise City, S. 37
Wichtig zu wissen ist, dass Beck ihr Buch vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie geschrieben hat, es somit Ausdruck eines sich schon länger abzeichnenden gesellschaftlichen Wandels ist und die Autorin darin längerfristige Strukturen untersucht, die uns von der gegenwärtigen Pandemiesituation nur schlaglichtartig ins Bewusstsein gebracht werden.
Im Zentrum dieser immer wieder erschreckend aktuell wirkenden Geschichte steht die junge Liina. Auf ihre Figur konzentriert sich die Autorin am meisten, in ihr laufen alle Fäden der Handlung, des Kriminalfalls zusammen und in ihr kristallisieren sich auch alle thematischen Konfliktfelder des Romans. Liina ist heimliche Mitarbeiterin der im Untergrund tätigen Agentur Gallus, die von Özlem Gerlach und Yassin Schiller geleitet wird. Sie sind in gewissem Sinne Investigativjournalisten, sie recherchieren unermüdlich, wollen Staub aufwirbeln, sie hinterfragen und überprüfen die staatlich monopolisierten Nachrichten und versuchen auf diese Weise aus dem Untergrund heraus eine Art Opposition zu erzeugen und die Regierung zum Handeln zu zwingen: eine durchaus nicht ungefährliche Form des Widerstands. Yassin, einer der Chefs und außerdem Liinas Exfreund aus Studienzeiten, mit dem sie vor kurzem wieder eine Affäre begonnen hat, landet zu Beginn der Geschichte — vermutlich gewaltsam — auf den Gleisen einer einfahrenden S-Bahn und schwebt nun in Lebensgefahr. Dass trotz strenger Kameraüberwachung genau rund um den angeblichen Unfall verschwommene Gestalten auf den Videobildern zu sehen sind, die sich mit ausgefeiltesten technischen Tricks unkenntlich zu machen wussten, schürt den Verdacht von Liina und ihren Kollegen, zumal kurz darauf ein zweiter Anschlag stattfindet, dem Kaya Erden, eine Investigativjournalistin alten Schlags, zum Opfer fällt. Sie hatte mit Yassin wohl eine Recherche geplant, die irgendwer um jeden Preis verhindern will…
Auch Vergangenheit und Gegenwart werden über die Protagonistin Liina miteinander verbunden. Einige Kapitel sind Rückblenden, in denen Liinas Biographie und damit auch die für die gegenwärtigen Ereignisse wichtige Vorgeschichte Gestalt annimmt. Man erfährt, warum sie damals mit Yassin Schluss gemacht und nach Skandinavien gegangen ist, und dass sie selbst aus einem bestimmten Grund, der hier nicht verraten wird, in höchstem Grad von den Fortschritten des Gesundheitssystems abhängig ist, das nun jedoch eine Entscheidung von ihr erzwingt, die sie so nicht treffen will. Man erfährt auch vom schwierigen Verhältnis zu ihrem behinderten Zwillingsbruder, das einen Schatten auf die ansonsten so couragiert gezeichnete Protagonistin wirft, und von ihrer inzwischen als Gesundheitsministerin amtierenden Freundin aus Kindheitstagen, mit der sie damals im abgelegenen, nicht vom GPS erfassten Frankfurter Hinterland eine merkwürdige Dorfgemeinschaft entdeckte. Die Menschen dort waren irgendwie anders, das spürte Liina, auch wenn sie nicht genau verstand, in welcher Weise. In der Stadt hatte sie von den Menschen dort bereits gehört, die man als „die Parallelen“ bezeichnete:
so nannte man die Menschen, die nicht dazugehören wollten. Es gab nur wenige Informationen über sie, und viele Gerüchte.
Beck, Paradise City, S. 125
Liina, die sich mit dem Desinteresse, den Vorurteilen und auch der unbestimmten Angst der Menschen bereits als Kind nicht zufrieden gibt, will sich selbst ein Bild machen und kehrt noch ein paarmal in das verbotene Dorf zurück. Doch erst viel später wird ihr klar, dass die ihr ungewohnt zutraulich begegnenden Kinder dort zum Großteil behindert waren und in ihrer eigenen Gesellschaft, der sichtbaren, offiziellen, nicht gewünscht und nicht vorgesehen waren. Tatsächlich ist diese aus der Zeit und der Norm fallende Gruppe irgendwann aus dem Hinterland verschwunden, und auch zu ihr führt eine der Spuren des kompliziert gestrickten Kriminalfalls, in den Liina Jahre später verwickelt wird.
Während man gespannt der Entwicklung der Geschichte folgt und mit Liina die Puzzlestücke zusammensetzt, nimmt einen eine andere Art von Spannung fast noch mehr gefangen: eine Spannung, die sich aus den ethischen Ambivalenzen ergibt, mit denen man über die Figuren beim Lesen auch selbst konfrontiert wird. Ohne tendenziös oder auf irgendeine Weise voreingenommen zu sein, macht die Autorin aus der Geschichte heraus die große Verantwortung spürbar, die mit den Entscheidungen der Gesellschaft und des Einzelnen verbunden ist, und sie zeigt die Beeinflussbarkeit und Relativität auch bei ethischen Werturteilen, die je nachdem, ob sich die Waagschale durch das Sicherheitsbedürfnis der Menschen auf der Seite der Vorsorge- und Präventionskompetenz des Staates nach unten senkt oder auf derjenigen der (Entscheidungs-) Freiheit, eine ganz andere Richtung oder Gewichtung nehmen können. Auch die künstliche Intelligenz spielt in diese ethische Unsicherheit mit hinein, wenn ein Algorithmus über Leben und Tod, Abtreibung oder Mutterschaft entscheidet. Und auf einmal stellt sich das moralische Gewissen nicht ein, wenn man über eine Abtreibung nachdenkt, sondern wenn man der Gesundheitssoftware (in Becks Roman heißt sie abgekürzt KOS) wertvolle Daten vorenthält:
Eine Schwangerschaft abzubrechen ist so unkompliziert wie eine Zahnreinigung. Es genügt, einen Termin zu machen. Beratung ist jederzeit möglich, aber anders als noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird den Frauen kein schlechtes Gewissen gemacht. (…) Die allermeisten Schwangerschaften werden sehr schnell festgestellt, weil fast alle jeden Monat standardisiert Blut und Urin zu Hause mit KOS überprüfen und auswerten lassen.
Beck, Paradise City, S. 58
Warum lassen die Menschen in Paradise City das alles so ungefragt mit sich geschehen? Machen sie sich zu unmündigen Bürgern, indem sie ihre Handlungsfreiheit freiwillig begrenzen? Oder gebieten Vernunft und Gemeinschaftssinn eine derartige Unterordnung unter das technisch verwaltete größere Ganze, zumal auf diese Weise bereits eine sichtbare Verbesserung des allgemeinen Wohlstands erreicht wurde? Ist es überraschend, wenn die Mehrheit dafür ist, es zur Pflicht zu machen, sich auf genetisch bedingte Suchtanfällligkeiten testen zu lassen? Immer wieder umkreist die Autorin in ihrem Roman die Frage der Akzeptanz:
Liina kann sich gut vorstellen, wie die Leute massenhaft diesen Tests zustimmen. Alles wissen wollen, alles planen wollen, nichts dem Zufall überlassen.
Beck, Paradise City, S. 107
Kein Zufall ist es jedenfalls, dass man bei der Lektüre mehr als einmal an den französischen Soziologen Jean Baudrillard erinnert wird, der in seinen Schriften über die Verdrängung von Tod und Krankheit aus den zeitgenössischen Gesellschaften geschrieben hat, die mehr und mehr einem reibungslos funktionierenden, technisch perfektionierbaren System gleichen wollen. Bei Beck liest man: „Bedrohliche medizinische Unklarheiten sind nicht erwünscht. Sie sind nicht Teil des Systems“ (S. 145); der technisch-medizinische Fortschritt ist auch in ihrer romanesken Zukunftswelt an das Modellbild eines gesunden, also „normalen“, „funktionierenden“ Menschen gekoppelt, während alle aus der Norm fallenden Außenseiter der Gesellschaft als Störfaktoren betrachtet werden. Auch ein „unnatürlicher“ Tod, ein Mord oder ein Selbstmord, wird hier zum Skandal, da er das Gesellschaftssystem in Frage stellt und in seiner Logik eigentlich nicht vorkommen darf. Schon ein Unfall ist kritisch und das Höchstmaß des Sagbaren:
Sie checkt die Nachrichten, obwohl sie weiß, wie wenig das bringt. (…) „Unfall“ könnte genauso gut „Selbstmord“ bedeuten, aber man spricht nicht gern von Selbstmorden. Weil sich offiziell so gut wie niemand umbringt. (…) Bei allem, was die alltäglichen Abläufe stört, wird erst einmal ein Anschlag vermutet, was sich nie bestätigt. Andere stellen leise die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen in Frage.
Beck, Paradise City, S. 21
Alles, was die reibungslosen Abläufe durcheinanderbringt, wird in Becks erdachtem Zukunftsdeutschland als Gefahr eingestuft, und das geradezu mythische Sinnbild dieser Gefahr ist das Selbstmordattentat, das, so liest man es bei Baudrillard, das System sprengt und dennoch oder gerade deshalb als Angstvorstellung vor dem Unvorhersehbaren, Gewaltsamen, Irrationalen permanent unter der Oberfläche lauert.
Eine weitere Kehrseite besteht darin, zusammen mit allem Systemfremden, Ineffizienten, Unkontrollierbaren auch die Kontroverse, die Kunst, das Andersartige in den Hintergrund zu drängen, ja auszulöschen. Die Existenz der Untergrundorganisation, für die Liina arbeitet, ist ein starker Hinweis auf die autoritären Züge, die diese Gesellschaft angenommen hat. Handelt es sich um eine schleichend eingeführte Diktatur? Es ist nicht die Rede von einem militärischen Übergriff des Staates und die meisten Menschen heißen die staatlichen Maßnahmen gut, die ihr Leben verlängern und seine Qualität verbessern, aber schrauben sie nicht auch ihre Selbstbestimmung zurück…?
Sie haben saubere Luft zum Atmen, sauberes Trinkwasser, gute Lebensmittel, die beste medizinische Versorgung. Es fehlt ihnen an nichts, weil sie daran glauben, dass es ihnen an nichts fehlt, und Freiheit ist ein viel zu abstraktes Konzept.
Beck, Paradise City, S. 173
An einigen Stellen musste ich an Cécile Wajsbrots jüngsten Roman mit dem deutschen Titel Zerstörung denken (vgl. Rezension vom 19.3.2020), ein stilistisch ganz anders gearteter, poetisch-vielstimmiger Text, der aber eine ähnliche Grundstimmung heraufbeschwört und auf ähnliche Tendenzen aufmerksam macht. Wie in Zerstörung werden auch in Paradise City Museen als Orte der Erinnerung und des reflektierten freiheitlichen Bewusstseins zurückgedrängt zugunsten staatlicher Gebäude und eines zweckrationalen Denkens; hier ein Auszug aus einem Dialog Liinas mit einer Freundin:
„Irgendwo musste ja Platz für die ganzen Bundesministerien geschaffen werden. Die Museen sind jetzt im Quartier Bad Vilbel.“ — „Alle Museen auf einem Haufen?“ — „Praktisch und rentabel, heißt es. Ein Highlight für die Freizeitgestaltung. (…)“ — „Aber das Theater steht noch. In dieser Lage. Erstaunlich. “ — „Noch behält man es für Staatsempfänge, um auf Kultur zu machen. (…)“
Beck, Paradise City, S. 92 f.
Paradise City ist vielleicht weniger ein Thriller, wie es auf dem Buchdeckel angekündigt wird, als ein intelligent und unterhaltsam geschriebener Spannungsroman, der nicht zuletzt auch von seinen erfrischenden Dialogen lebt und die vielfältigen ethischen Dilemmata einer „schönen neuen Welt“ glaubhaft zur Sprache bringt. Auch wenn ich manche Nebenfigur gerne noch ein bisschen näher kennengelernt hätte und mir eine tiefere Zeichnung der Charaktere gewünscht hätte, hat mich der Roman durch seine romaneske Aufbereitung eines gesellschaftlich relevanten Stoffes absolut überzeugt!
Bibliographische Angaben
Zoë Beck: Paradise City, Suhrkamp (2020)
ISBN: 9783518470558