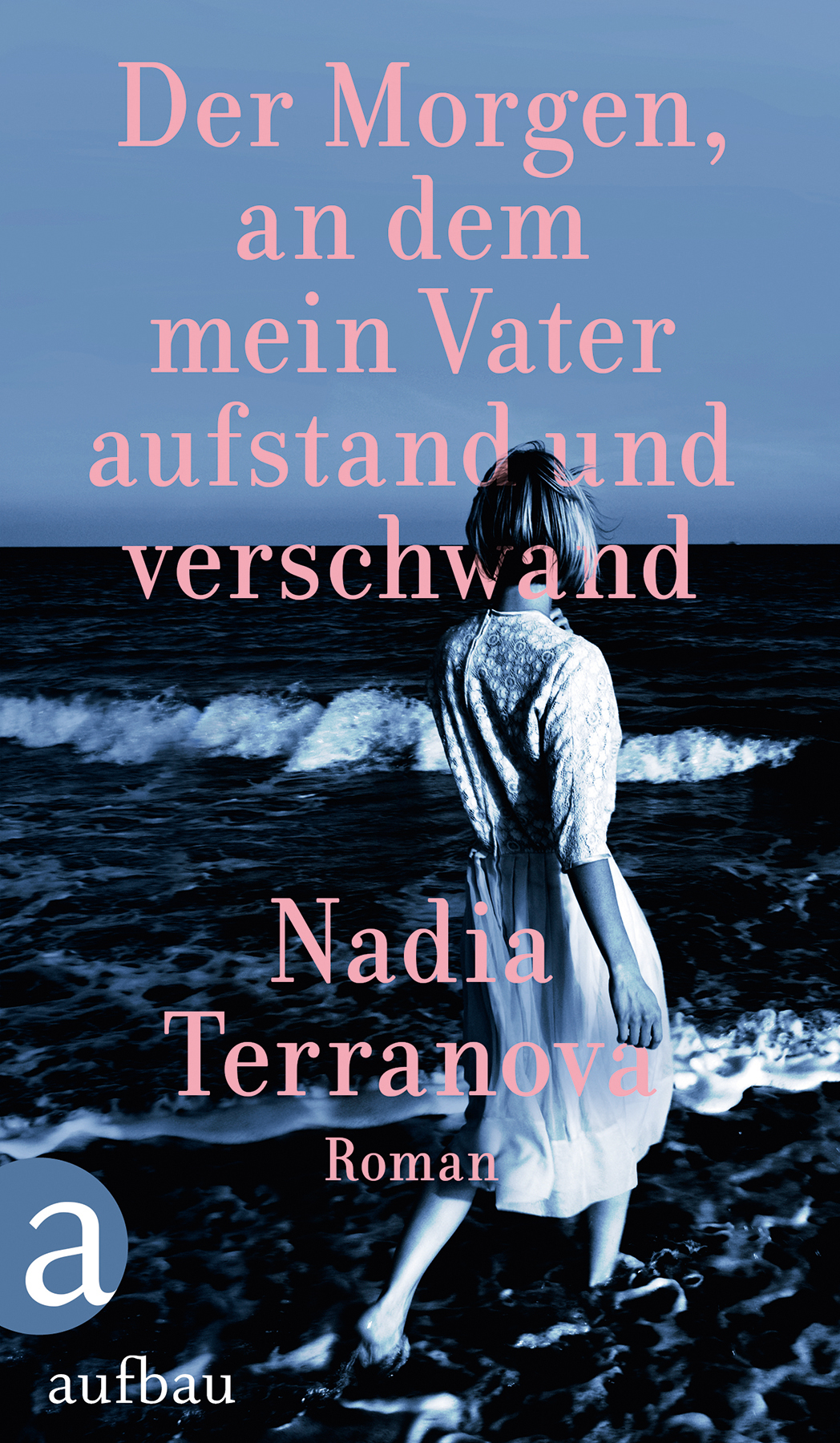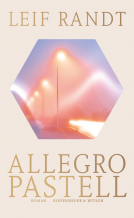Mit den grandiosen Romanen der geheimnisvollen italienischen Schriftstellerin, die sich Elena Ferrante nennt und deren Platz in den Bestsellerlisten wirklich einmal ein auch literarisch verdienter ist, scheint hierzulande die Neugier auf italienische Autorinnen sichtbar gewachsen zu sein. Die sich außerdem trotz ganz unterschiedlicher Handlungsentwürfe doch an bestimmten gemeinsamen Interessenfeldern abzuarbeiten scheinen. Letzes Jahr etwa wurde ein Roman von Rosa Ventrella, Die Geschichte einer anständigen Familie, aus dem Italienischen übersetzt, das deutsche Cover erinnert wohl nicht zufällig an die Neapel-Saga Ferrantes; auch Ventrella betont den Bezug zur regionalen Herkunft, die Geschichte spielt in Bari, wo die Autorin auch selbst aufgewachsen ist, es geht auch bei ihr um die sozio-psychologischen Konflikte einer Familie und um die konfliktreichen emotionalen und intellektuellen Bedürfnisse eines in einengenden Traditionen zur jungen Frau heranwachsenden Mädchens.
Auch die junge sizilianische Schriftstellerin und Kinderbuchautorin Nadia Terranova, Jahrgang 1978, die u.a. für den Premio Strega nominiert wurde, kann man in diesem regionalen, weiblichen literarischen Kontext verorten, gleichwohl sie wieder eine ganz eigene Erzählweise hat. Ihr nun ins Deutsche übersetzter Roman über eine junge Frau aus dem sizilianischen Messina, deren an Depression erkrankter Vater aus ihrem Leben und ihrer Familie verschwand, als sie ein dreizehnjähriges Mädchen war, ist ein ganz schmales Buch, das mich mit seiner großen poetischen und psychologischen Dichte sehr beeindruckt hat.
Der sehr übersichtliche Schauplatz der Geschichte, der aber einen großen Raum in die subjektiv erinnerte Vergangenheit der Ich-Erzählerin, Ida, eröffnet, ist das Haus ihrer Eltern bzw. ihrer Mutter in Messina, das überquillt vor allzu lange aufbewahrten Gegenständen und eben auch Erinnerungen. Dorthin kehrt die inzwischen erwachsene Ida, die sich ein neues Leben mit ihrem Mann in Rom konstruiert hat, zu Beginn der Erzählung zurück, nachdem ihre Mutter ihr am Telefon angekündigt hat, das Haus ausräumen, sanieren und verkaufen zu wollen. Sie kommt ohne ihren Mann an diesen Ort ihrer Kindheit und der schmerzhaften Erinnerung zurück, um ihre beiden so verschiedenen Welten, Gegenwart und Vergangenheit, römische Hauptstadt und sizilianische Heimat, die sie allzu säuberlich auseinander hält, nun doch irgendwie in ein Verhältnis zu setzen. Ida ist — und das ist nicht ganz unwichtig — Autorin, sie schreibt Texte fürs Radion, fiktionalisierte Erzählungen, für die sie auf Erlebtes und Beobachtetes zurückgreift. Auf diese Weise schreibt sich die Aufarbeitung ihrer Kindheit und Jugend auch metaliterarisch in den Text ein — auch etwas, was an Elena Ferrante erinnert –, wenngleich das an der Oberfläche erfüllte Leben der Erzählerin und Texterin bisher eher einer Fluchtbewegung geschuldet ist, einer Vermeidung jeder tieferen Konfrontation mit der Vergangenheit, die sie daher unbewusst umso schwerer zu belasten scheint.
Die Rückkehr nach Messina stellt insofern einen Wendepunkt in Idas Leben dar, der eine gewisse inwendige Notwendigkeit zu haben scheint. Denn als sie sich in ihrem alten Kinderzimmer wiederfindet, kann sie sich der beängstigenden Versuchung des Blickes zurück, dem sie so lange durch ihre Flucht nach vorne entgangen war, nicht mehr entziehen. Schlaflos, zurückgeworfen auf ihr Inneres, setzt sie sich mit den realen und den ideellen, emotionalen Räumen ihrer Vergangenheit auseinander, öffnet sich für das, was in ihrer Erinnerung überdauert hat, sucht nach den Puzzleteilen ihrer eigenen Geschichte und ihres eigenen Selbst, dessen Autonomie nur im Prozesshaften erlangt werden kann und auch auf der bewussten, kreativen Auseinandersetzung mit den Bildern der Erinnerung beruht. Wesentlich ist dabei das Bewusstsein der Subjektivität, die jeder Wahrheit über die eigene Geschichte innewohnt. So stellt Ida eine schöne Reflexion über das unsichere und doch so faszinierende, schillernde, wandelbare Wesen der Erinnerung an, die zugleich auch als metaliterarischer Kommentar zu lesen ist:
Ich habe mich oft gefragt, ob diese Version der Geschichte vielleicht erst beim späteren Erzählen entstanden ist und schon vorwegnimmt, was ich erst am Nachmittag entdeckte, nämlich, dass mein Vater gegangen war; doch selbst wenn, wäre das erfundene Gefühl wahrer als die Wahrheit. Die Erinnerung ist ein kreativer Prozess, sie wählt aus, setzt zusammen, entscheidet, verwirft; der Roman der Erinnerung ist das unverdorbenste Spiel, das wir spielen.
Nadia Terranova
Und so steht das bewusste Rekonstruieren einer Geschichte auch im Zentrum des Romans von Nadia Terranova. Die narrative Logik der Erzählung entspricht der Suche der Erzählerin nach Identität. Es geht darum, ausgewählten Dingen und Episoden nachträglich Bedeutung und Symbolkraft zu geben, so dass die Ereignisse im Nachhinein Prägnanz erhalten, wie der Philosoph Hans Blumenberg sagen würde, der in dieser dem Prinzip des Mythos folgenden Neigung des Menschen eine anthropologische Veranlagung sieht.
Eine solche Mythisierung findet nach dem Verschwinden des Vaters im Haus der auf Mutter und Tochter reduzierten Familie tatsächlich statt, die Gegenstände erfahren eine magische Aufladung durch eine nicht thematisierte, aber im stummen Einverständnis gesetzte unsichtbare Anwesenheit des Vaters, die sich von Zeit zu Zeit in banalen, aber mythisch aufgeladenen Alltagsphänomen wie sickerndem Wasser zu manifestieren scheint. Der Vater ist verschwunden, sein Verschwinden wird bald auch nicht mehr mit Worten thematisiert, aber er bleibt permanent unterschwellig präsent. Er ist eine Leerstelle, die unablässig auf sich selbst zu verweisen scheint, für Ehefrau und Tochter jedes „normale“ Familienleben, wie Ida es bei den Nachbarn oder Schulkameraden beobachtet, forthin unmöglich macht und von ihr als fehlende Unschuld, fehlende Ausgelassenheit erlebt wird: „Mein Leben lang war ich die Tochter von Sebastiano Laquidaras Abwesenheit.“ (Nadia Terranova)
Doch im Unterschied zu damals wagt es Ida nun, diese Verlusterfahrung, die für sie unbestreitbar ein einschneidendes Erlebnis war, zu benennen und die mythische Kontingenz des zeitlichen Zusammenfalls des väterlichen Verschwindens mit ihrer Menarche, dem Beginn ihrer Pubertät, in einem kreativen Prozess erzählerisch miteinander zu verknüpfen. Die Autorin verwendet das Motiv des Vaterverlusts somit auch, um einen Roman über die Konstruktion einer weiblichen Identität zu schreiben. Die konfliktreiche Beziehung von Mutter und Tochter nimmt entsprechend großen Raum in der Erzählung ein, und es ist schön, wie es der Autorin mit leisen Zwischentönen gelingt, auch die tiefe Verbundenheit, die über die Spannungen und Gereiztheiten hinweg zwischen den beiden Frauen besteht, anzudeuten.
Die poetischen, nachdenklichen Töne, das Gespür für feine, aber sinnige Unterschiede und der unprätentiöse, sehr nah am Ich der Figur orientierte Stil, in dem diese zum Ausdruck gebracht werden, macht die literarische Qualität dieses berührenden Buches aus. So denkt Ida, als sie ihren Erinnerungen an die Großeltern und ihren Vater nachgeht, über Tod, Verlust und Verschwinden nach. Allerseelen wurde in ihrer Familie als Fest der Erinnerung gefeiert, was dem Tod seinen Schrecken nahm. Doch wie anders erlebte sie dann das Verschwinden des Vaters:
So war der Tod, wie ich ihn bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr kannte: eine direkte, blinde Linie, die mit Vererbung und Vergänglichkeit zu tun hatte, ein Ort, von dem die Menschen nur einmal im Jahr zurückkehrten, ein unschönes, aber letztlich fruchtbares Fest. Das war er, und vor ihm hatte ich keine Angst.
Nadia Terranova
Dann, eines Morgens, war mein Vater verschwunden. (…) Der Tod ist ein Fixpunkt, doch das Verschwinden ist das Fehlen eines Punktes oder jedes anderen Satzzeichens am Ende der Wortreihe. Wer verschwindet, schreibt die Zeit um, und ein Reigen aus Obsessionen umgibt die Überlebenden.
Der Roman hat drei Teile, die mit „Der Name“, „Der Körper“ und „Die Stimme“ überschrieben sind und sowohl auf die Erzählerin selbst als auch auf den Vater bezogen werden können. Die Re- und Dekonstruktion der Vergangenheit ermöglicht Ida erst, sich von unbestimmten, unterdrückten Schuldgefühlen freizumachen, die auch die Beziehungen zu anderen Personen, ihrer früheren Freundin, ihren Mann, beeinflussen. Der sakralisierte Raum des abwesenden Vaters, den bildhaft gesprochen nur ihre Mutter und sie selbst betreten durften, machte es schwer, wenn nicht unmöglich, jemanden von außen hereinzulassen. Daher die Rebellion der Tochter, als ihre Mutter eine neue Beziehung eingeht, daher die fehlende Empathie für die beste Freundin, als diese Schmerzhaftes erlebt. Erst unfreiwillig, dann mutiger verlässt Ida allmählich ihre Schutzzone und öffnet die Augen auf ihre Außenwelt, auf andere Schicksale und Erfahrungen.
Es ist ein schmerzhafter Prozess der Erkenntnis, des Sich-Annehmens, den die Erzählerin durchläuft und wir Leser ganz nah mit ihr. Und so wohnt diesem wunderbaren Roman eine von jedem Kitsch befreite Poesie von Schmerz und Hoffnung inne, die einen nachdenklich stimmt und auf magische Weise ganz intensiv berührt.
PS:
Der allzu ausgedehnte deutsche Titel, der für das schlichte italienische „Addio Fantasmi“ gefunden wurde, ist, wie ich finde, etwas irreführend, da er Assoziationen zu Büchern wie von Jonas Jonasson weckt, mit denen Terranovas Erzählung nun so gar nichts zu tun hat.
Bibliographische Angaben
Nadia Terranova: Der Morgen, an dem mein Vater aufstand und verschwand, Aufbau Verlag (2020)
Aus dem Italienischen übersetzt von Esther Hansen
ISBN: 9783351034849
Bildquelle
Nadia Terranova, Der Morgen, an dem mein Vater aufstand und verschwand
© 2020 Aufbau Verlag GmbH & Co KG, Berlin