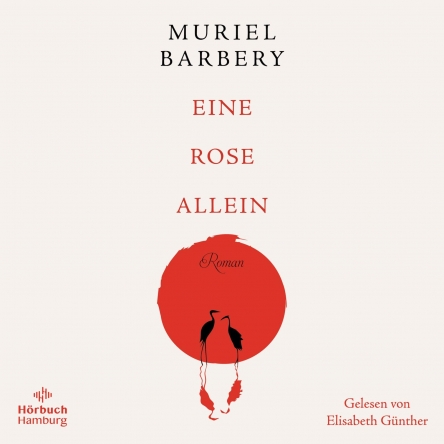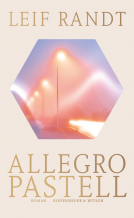Wie aufregend! Da entdeckt der Sohn im Nachlass ein bisher unbekanntes Romanmanuskript seiner berühmten Mutter, der französischen Schriftstellerin Françoise Sagan (1935-2004), die sich 1954 als 18-Jährige mit Bonjour tristesse auf einen Schlag einen Namen machte und von da an mit einer Vielzahl an Romanen, Theaterstücken und Drehbüchern zur skandalumwitterten Bestsellerautorin wurde. Und er veröffentlicht es, zur Freude aller neugierigen Sagan-Leser, denen damit ein neuer Stoff zugänglich gemacht wird: jedoch nicht als kritische Textausgabe, sondern durchaus auch mit kleinen Eingriffen und Ergänzungen, wie er im Nachwort schreibt, im Stile und im Sinne seiner Mutter.
Doch ist diese — trotz aller Bemühungen, den Lesern einen möglichst unverfälschten und dennoch flüssig lesbaren Text zu präsentieren — zwangsläufig bruchstückhaft bleibende Veröffentlichung wirklich im Sinne der Autorin? Und der Leser?
Einiges Amüsement beschert einem der Roman auf jeden Fall, und wer Sagan kennt, wird auch einiges von ihrem unvergleichlich freimütigen, humorvollen und zugleich gefühlsbetonten Stil wiedererkennen. Um die im Zentrum der Geschichte stehende reiche Industriellenfamilie Cresson zu porträtieren, ihre zur Schau gestellte Bürgerlichkeit, die nach innen so einige „dunkle Winkel“ vergeblich zu verbergen sucht, nimmt die Schriftstellerin kein Blatt vor den Mund. Die Figuren und ihre Handlungsmotive werden mit großer Lust an böser Satire und provozierender Übertretung von Anstand und Konventionen geschildert, die immer wieder auch Raum lässt für unterschwelligere melancholische, gefühlvolle Töne.
Trotzdem wirkt alles, wenn man denn den Maßstab ihrer vollendeten Romane, etwa Aimez-vous Brahms oder das bereits erwähnte Bonjour tristesse, anlegt, hier doch noch ziemlich plakativ und nicht ganz so rund. Der Eindruck, dass man es mit einer unvollendeten Erzählung nicht nur in Bezug auf die Handlung zu tun hat, die, ehe sie sich so richtig entfalten kann, auch schon wieder unvermittelt abbricht, sondern auch in Bezug auf den stellenweise recht holprigen Stil, verlässt einen kaum während der Lektüre und macht sie entsprechend beschwerlicher, als es einzelne äußerst fesselnd und vergnüglich geschriebene Passagen darin verheißen, die dann allerdings etwas unverbunden nebeneinander zu stehen scheinen.
Dabei hat Sagan einen durchaus vielversprechenden Stoff gewählt und eine konfliktreiche Ausgangslage geschaffen, die einen gespannt in die Handlung eintauchen lässt: Ludovic Cresson, der einzige überlebende Sohn kehrt nach langwierigen, kräftezehrenden Krankenhaus- und Rehabilitierungsaufenthalten heim aufs väterliche Anwesen, wo er jedoch nicht von allen so begeistert erwartet wird, wie anzunehmen wäre. Befürchten doch alle, einen debilen und so gar nicht vorzeigbaren Invaliden zu ihrem eigenen Schaden wieder in ihre bürgerliche Mitte aufnehmen zu müssen. Doch Ludovic ist in besserer Form als vermutet, was allerdings erst als Wirklichkeit anerkannt werden kann, wenn er sich in der guten Gesellschaft von dem ihm vorauseilenden Ruf des Invaliden befreit hat.
Im Hause der Cressons hatte man sich angewöhnt, Ludovic nicht direkt anzusprechen, da der wahre Ludovic für sie gestorben war. Also redeten alle in seinem Beisein so ungeniert über ihn, als wäre er gar nicht da. Ludovics Blick schweifte dabei ohnehin stets über die Landschaft draußen vor den Fenstern.
Sagan, Die dunklen Winkel des Herzens
Besonders missgestimmt ob seiner unerwarteten Rückkehr ist seine junge Frau, die übrigens jenen fatalen Autounfall überhaupt verursacht hat, der Ludovic zuerst zum Totgeglaubten, dann zum Schwerverletzten und schließlich zum scheinbar unheilbar Versehrten gemacht hat. Sie ist alles andere als erfreut, ihren Mann, den der unattraktive Ruf des Invaliden umweht, wieder in ihre verwöhnten Arme zu schließen. Sein Vater hingegen ist mehr um die Männlichkeit des Sohnes besorgt und leitet ein großes Fest in die Wege, auf dem dieser zur vollständigen Reintegration in die Gesellschaft der gesunden Bürgerlichkeit beweisen soll, dass er keine dauerhafte Beeinträchtigung davongetragen hat.
Diesen Beweis erbringt Ludovic allerdings auf ganz andere, unvorhergesehene, in sich bereits wieder skandalöse Weise. Denn während die Tochter ihn, der nach Liebe und Romantik hungert, verschmäht, findet er umso leidenschaftlichere Erfüllung bei ihrer Mutter, deren Witwentrauer sie mit einer Melancholie umweht, die sich von der Oberflächlichkeit der übrigen Gesellschaft abhebt und ein Versprechen der Innigkeit enthält, das die Grenzen der Konvention zu sprengen scheint…
Es herrschte ein umgekehrter Puritanismus, der sich Freiheit nannte und sie (Fanny, Quentins Witwe und Mutter von Ludovics Frau) sehr erstaunte, als sie ihn entdeckte, denn Quentin und auch ihr eigener Horizont hatten sie bisher davor bewahrt. Heute erschreckte sie der Gedanke einer solchen inneren Leere: die Unfähigkeit zu lieben, verbunden mit der Besessenheit, seine Liebschaften öffentlich zur Schau zu stellen.
Sagan, Die dunklen Winkel des Herzens
Wer Sagan kennt und mag, für den ist das Buch ein interessanter und an vielen Stellen genüsslicher Einblick in ein weiteres Element ihres Schaffens. Wer jedoch noch nichts von ihr gelesen hat, sollte doch besser zu einem von ihr autorisierten, zu ihren Lebzeiten erschienenen Roman greifen, um ein Bild ihres köstlichen Schreibens zu bekommen, das ihr tatsächlich gerecht wird.
Bibliographische Angaben
Françoise Sagan: Die dunklen Winkel des Herzens, Ullstein (2019)
Aus dem Französischen — Les Quatre Coins du Coeur, Plon (2019) — von Waltraud Schwarze und Amelie Thoma
ISBN: 9783550200915
Bildquelle
Françoise Sagan, Die dunklen Winkel des Herzens
© 2019 Ullstein Buchverlage GmbH