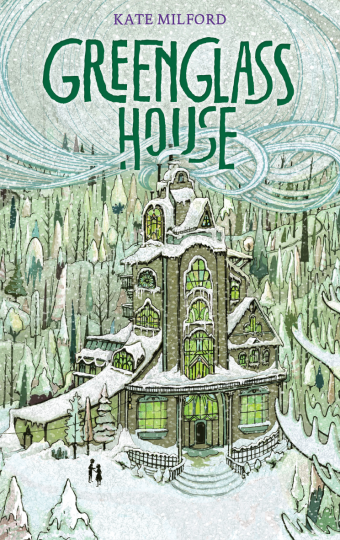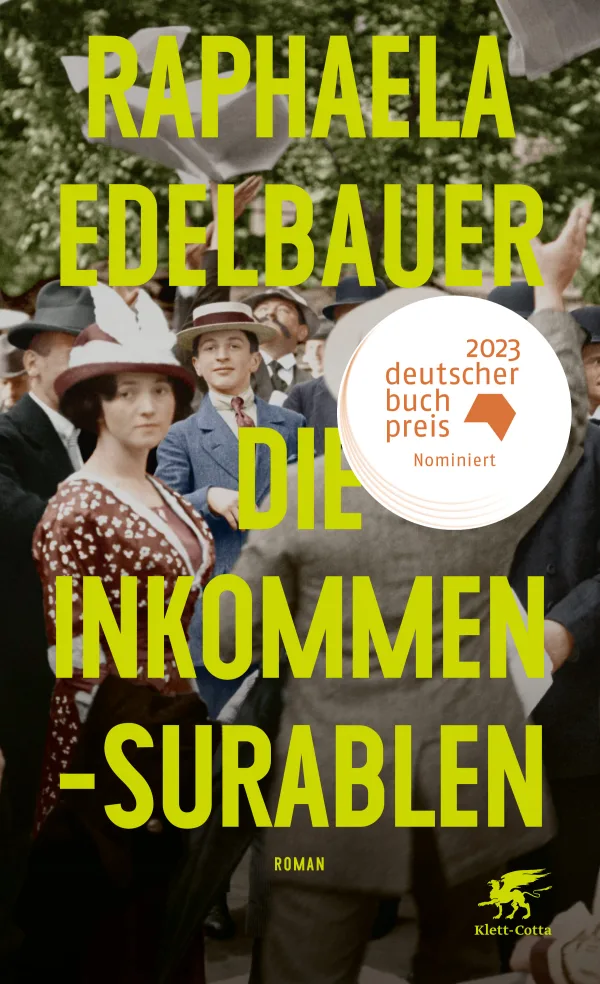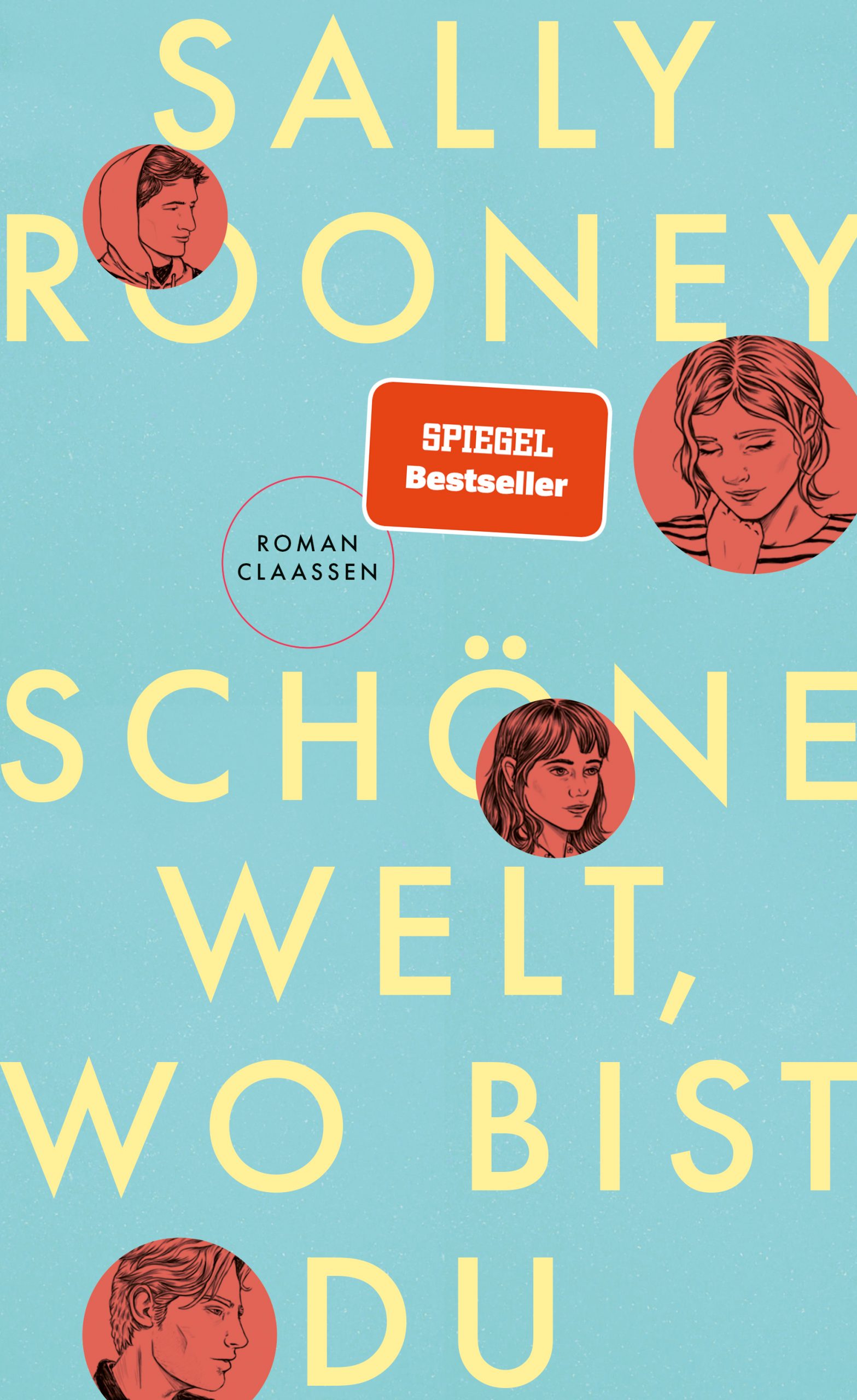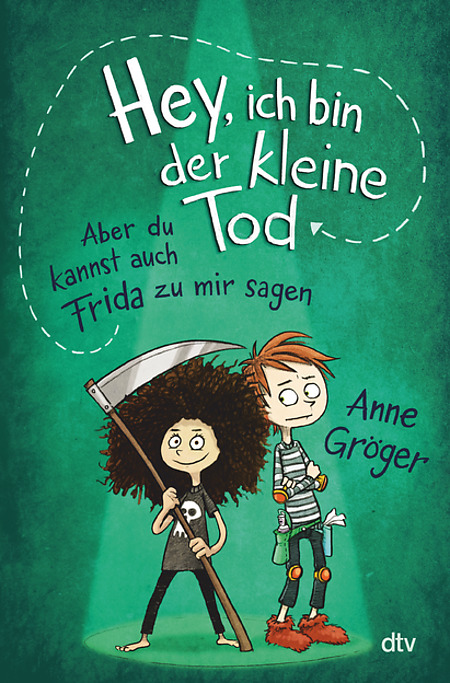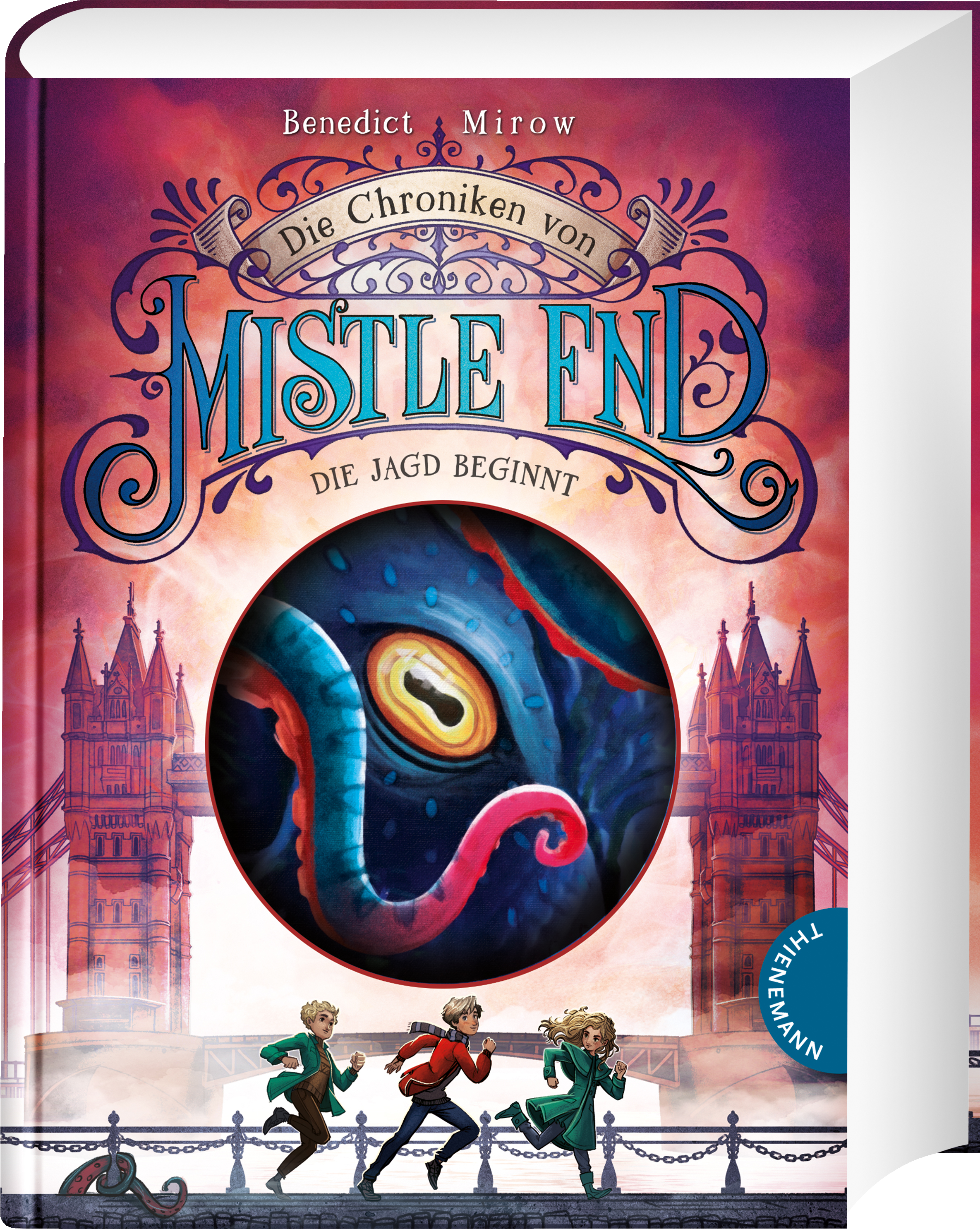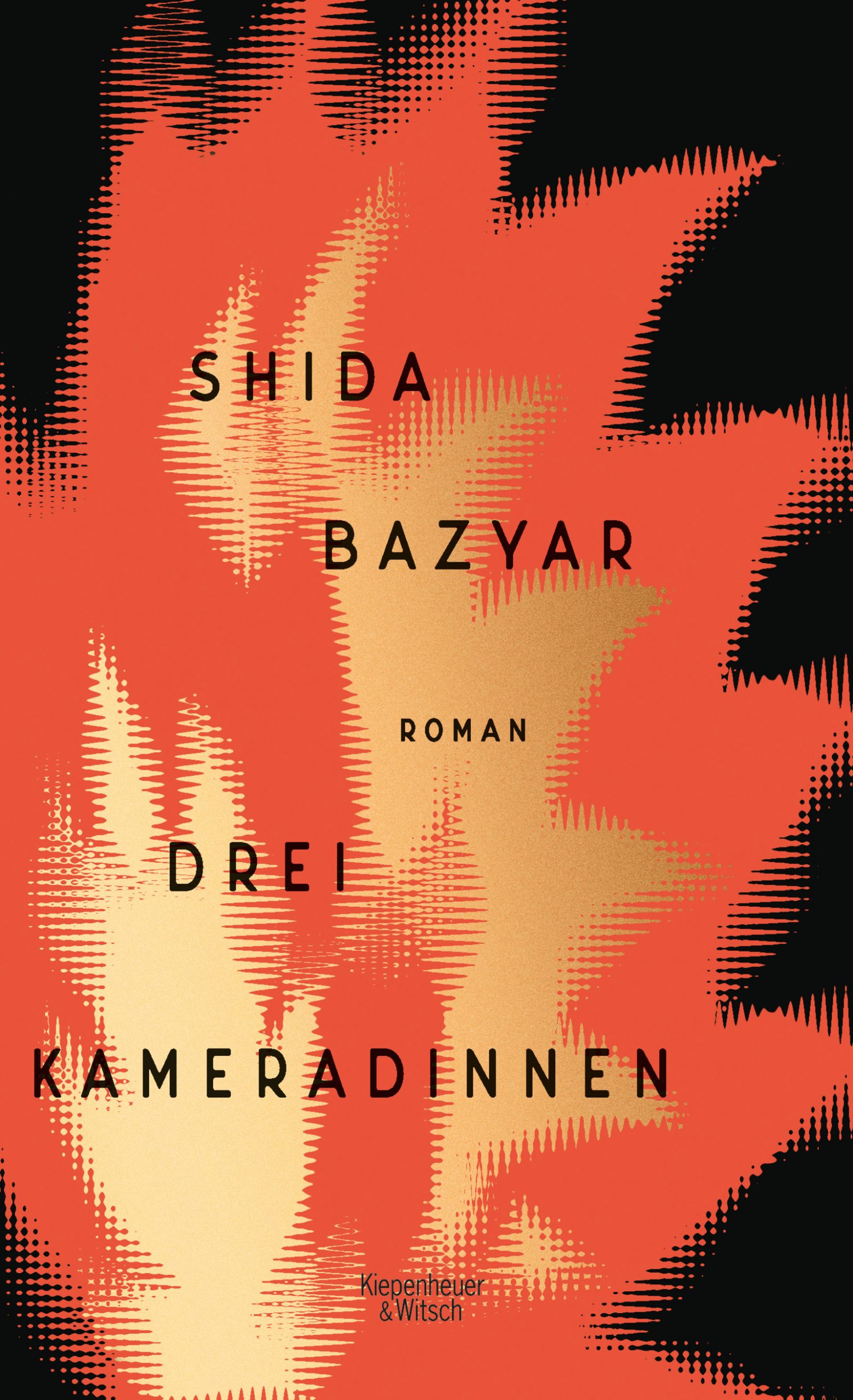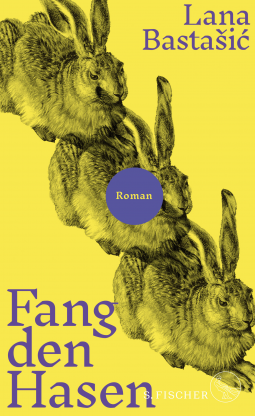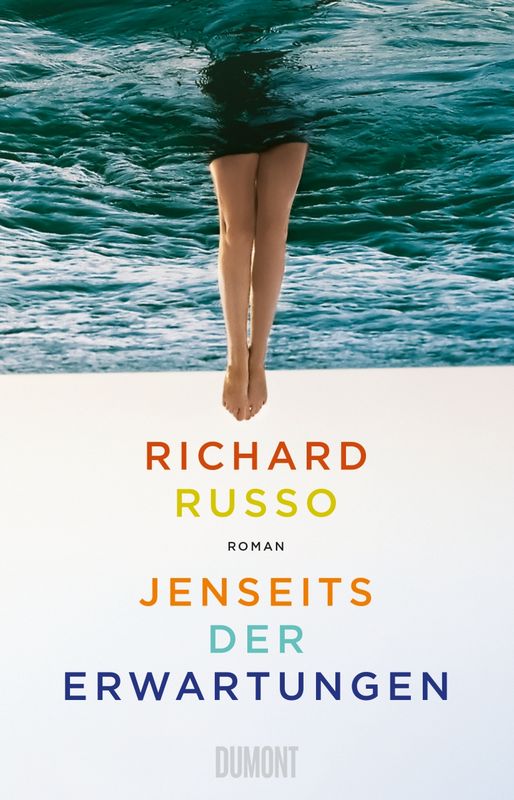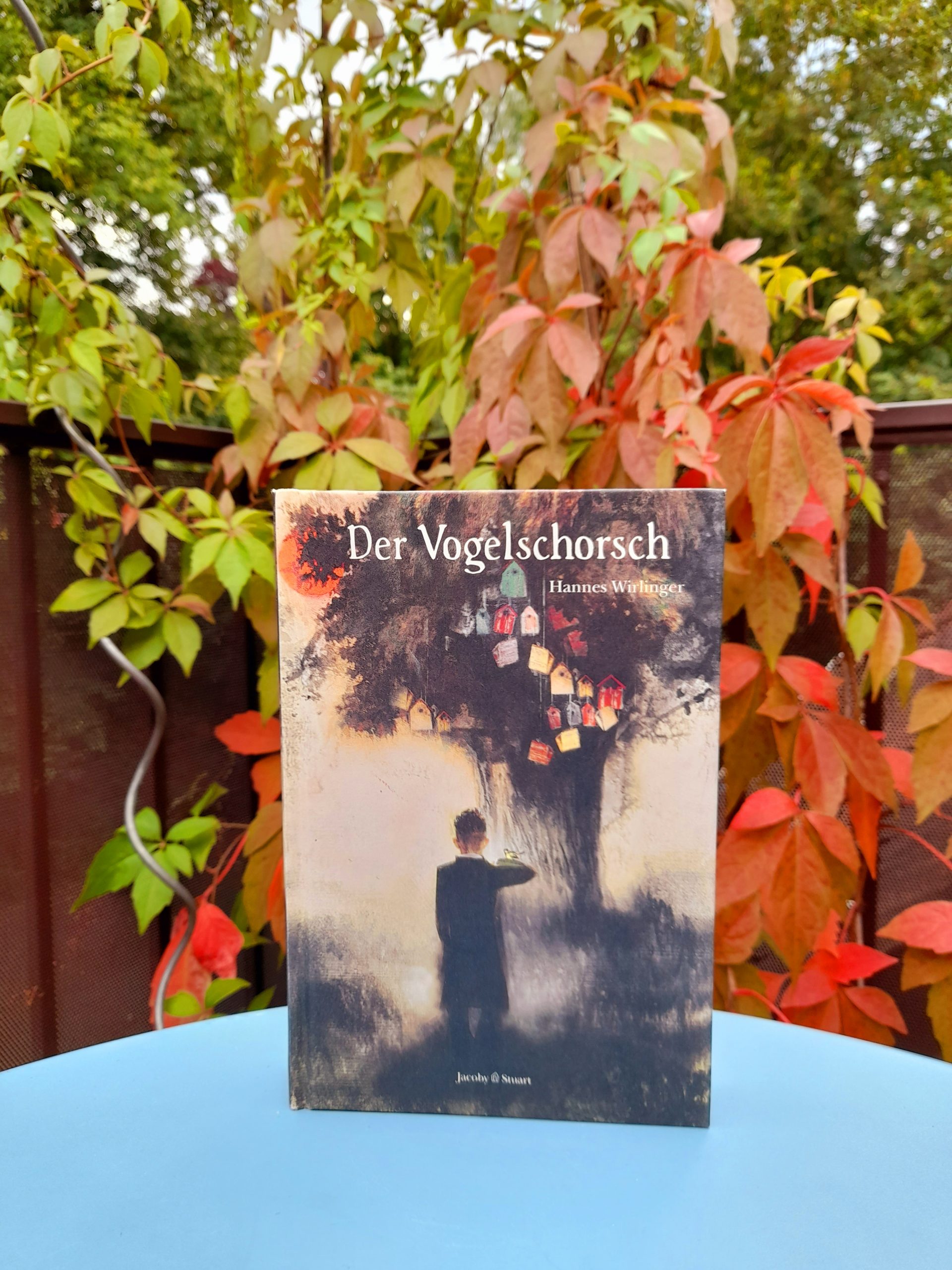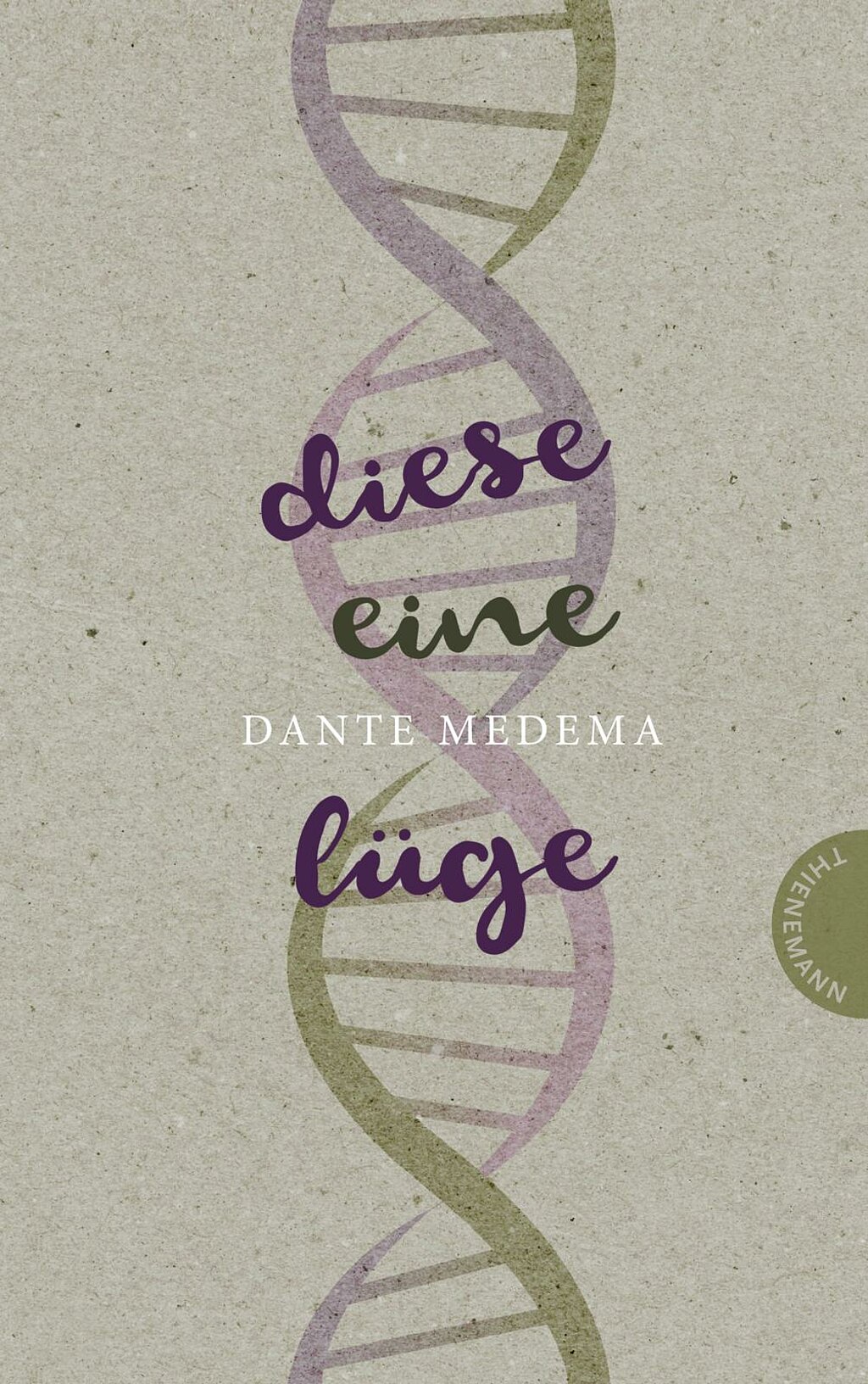Dürers Hase ist so etwas wie das versteckte Symbol dieses aufwühlenden Romans, der die konfliktreiche Geschichte zweier Kindheitsfreundinnen aus Banja Luka ebenso leidenschaftlich wie bildgewaltig erzählt und ihre später so divergierenden Lebenswege in Beziehung zu den Nachwirkungen der Gewalt und der ethnischen Konflikte im früheren Jugoslawien setzt. Ein tückisches Symbol allerdings, eines, in das sich der Zweifel an der scheinbar so realitätsgetreuen Abbildung eingeschlichen hat, und mit ihm die von der Autorin immer wieder mit einem fiktionsironischen Augenzwinkern aufgeworfene Frage nach dem Einfluss der Emotionen, der subjektiven Bilder des eigenen Innenlebens auf die Erzählung und ihre Verwobenheit mit dem immer nur bruchstückhaft funktionierenden Prozess der Erinnerung.
Dürers Hasen erwähnt, so erinnert sich die Ich-Erzählerin Sara, ihre Freundin Lejla das erste Mal, als die beiden Lejlas weißen Hasen, strenggenommen ein Kaninchen, beerdigen. Ihr Bruder Armin habe als kleiner Junge fasziniert das berühmte Kunstwerk angefasst und so im Museum den Alarm ausgelöst. Zu dem Zeitpunkt, als Lejla das erzählt, ist Armin bereits einige Jahre verschwunden, Schmerz und fehlende Worte haben die Beziehung der beiden heranwachsenden Freundinnen aus dem ohnehin nie vollkommenen kindlichen Gleichgewicht gebracht. Diese Szene ist eine der vielen eingeschobenen Erinnerungen Saras an ihre gemeinsame Vergangenheit mit Lejla, die sie in diesen Einschüben stets in der Du-Form anredet, was der Lektüre eine große Intensität und Eindringlichkeit verleiht und durch die fingierte Dialogizität auch das enge, wenngleich sehr strapazierte Band zwischen den beiden Freundinnen spürbar macht.
Eigentlicher Ausgangspunkt der Erzählung ist ein Anruf Lejlas bei Sara, nachdem sie zwölf Jahre nichts mehr voneinander gehört hatten. Sara ist während des Studiums nach Dublin gezogen und dort geblieben, sie lebt mit einem Iren zusammen und arbeitet als Schriftstellerin und Übersetzerin, zu ihrer Familie sowie zu ihrem Heimatland Bosnien besteht so gut wie keine Verbindung mehr. Heimat ist für sie ein englisches Wort geworden:
Home war nicht Bosnien. Bosnien war etwas anderes. Ein verrosteter Anker in irgendeinem verpissten Meer. Man schürfte sich auf und bekam Tetanus, auch nach so vielen Jahren.
Lana Bastašić, Fang den Hasen
Auch zwischen ihr und ihrer ehemals besten Freundin Lejla muss in der Vergangenheit etwas vorgefallen sein, so sehr wirft Sara dieser Anruf aus der Bahn. Doch obwohl sie gerne abweisend reagieren und Lejla mitsamt der ganzen bosnischen Vergangenheit vergessen würde, lässt sie sich von ihr zurück in das Land ihrer Herkunft dirigieren: Sara soll Lejla in Mostar abholen und mit dem Auto nach Wien fahren — wo Lejlas Bruder Armin nach all den Jahren wieder aufgetaucht sein soll. Der abwesende Armin, das wird im Verlauf der Erzählung deutlich, ist noch immer latentes Bindeglied und wunder Kristallisationspunkt so vieler unausgesprochener Ängste und unverarbeiteter Erinnerungen im Leben der beiden jungen Frauen; er ist ein gegenseitiges unausgesprochenes Versprechen, das gebrochen wurde, und das nun viele Jahre später vielleicht wieder erneuert werden kann?
Wir wussten, dass Armin am Leben war. Dieses Wissen verband und mehr als die gemeinsame Schulbank. Jetzt war es unsere Pflicht, bis ans Ende zusammenzubleiben, so lange, bis dein Bruder wieder auftauchte. Wenn wir uns zerstritten, wenn wir uns trennten, würde sich mit uns auch dieses fragile Wissen auftrennen. Als wäre im Stoff unserer Freundschaft sein ganzes Leben eingewebt. Es gab ihn nur noch dort.
Lana Bastašić, Fang den Hasen
Die Reise von Lejla und Sara ist eine Reise in die gemeinsame Vergangenheit und in die Vergangenheit ihres Landes. Die Ich-Erzählerin formuliert es einmal so:
Durch Bosnien zu fahren verlangte eine andere Dimension: die eines verkehrten Wurmlochs, das nicht zu einem äußeren, wirklichen Bestimmungsort führt, sondern in die düsteren, kaum begehbaren Tiefen des eigenen Wesens.
Lana Bastašić, Fang den Hasen
Die Wiederannäherung der beiden Frauen gestaltet sich dabei genauso schmerzhaft, verletzend und widerborstig wie Saras Wiederannäherung an das von ihr zurückgelassene Heimatland, auf das sie auch körperlich geradezu mit Abwehr reagiert und das doch mit aller Macht wieder von ihr Besitz ergreift. Sie stellt sich vor, wie Lejla ihr neues Dubliner Leben abschätzig begutachtet, und in diesem imaginierten Blick liest sie ihren eigenen schonungslosen Blick auf sich selbst, den sie in Bosnien, in Lejlas Anwesenheit nicht mehr unterdrücken kann:
Sie [Lejla] würde nicht mal etwas sagen, nur mit den Augen würde sie mir Europa ausziehen wie einer Neureichen den Pelzmantel und die Narben des Balkans schamlos an die Öffentlichkeit zerren.
Lana Bastašić, Fang den Hasen
Die individuelle Geschichte der einander in Hassliebe verbundenen Freundinnen erinnert nicht nur wegen der vielschichtigen Gefühlsebenen, sondern auch wegen der selbstreflexiven Elemente des Textes an Elena Ferrantes neapolitanische Protagonistinnen; in beiden Texten ergibt sich eine wesentliche erzählerische Spannung daraus, dass die eine der Freundinnen, die schriftstellernde, das immer wieder sich entziehende und so faszinierende Wesen der anderen, daheim und arm gebliebenen, einzufangen versucht. Das ist bereits für sich literarisch und emotional überzeugend erzählt. Doch in diesen individuellen Lebens- und Gefühlswegen der Figuren spiegelt sich, ohne dass diese Überlagerung überstrapaziert würde, die Geschichte des von einem schrecklichen Krieg noch immer versehrten Landes sowie die Geschichte einer ganzen Generation, die das Erbe dieser Gewalt auf ihren Schultern trägt und sich zwangsläufig zu diesem irgendwie verhalten muss.
Die politischen und religiösen Konflikte sind in Bastašićs Text auf unterschwellige Weise omnipräsent; sie kommen nicht in der direkten Darstellung kriegerischer oder verbrecherischer Handlungen, sondern eher andeutungsweise und sekundär, oft auch in den psychischen und gleichwohl ganz realen Auswirkungen auf die Menschen zum Vorschein. So ist die Gewalt latent vorhanden, wenn Lejlas Bruder verschwindet, während ein gleichfalls muslimischer Freund von ihm später tot aus dem Fluss gefischt wird. Oder wenn Lejlas Familie ihren Namen ändert, das Muslimische daraus tilgt, so dass aus Lejla Begić auf einmal Lela Berić wird. Der gewaltsame Mechanismus von Inklusion und Exklusion wird auch von Sara unbewusst imitiert, als sie sich, anders als ihre Freundin Lejla, der stärkeren Schülergruppe anschließt und ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen tötet, was in ihr ein Scham- und Schuldgefühl gegenüber Lejla hervorruft, das sie lange nicht recht einordnen kann. Doch vor dem Hintergrund einer anderen Szene im Elternhaus von Sara, an die sie sich gleichfalls später wieder erinnert, bekommt dieses brutale Kinderspiel noch eine ganz andere Dimension: Etwa zur gleichen Zeit nämlich, als Lejla zu Lela wird, feiert man bei Sara zuhause zum ersten Mal Slava, das traditionelle orthodoxe Fest zu Ehren des Familienheiligen, doch in der eigentlich nicht sehr gläubigen serbischen Familie, die auf diese Weise ihre Zugehörigkeit zur staatstragenden Mehrheit nach außen zur Schau tragen will, wirken die festlichen Handlungen unbeholfen, aufgesetzt. Die Polarisierung und Politisierung des Glaubens deutet sich in solchen Szenen und Bildern immer wieder an, ohne explizit als solche benannt zu werden.
Aus all diesen Szenen, die vor dem inneren Auge der sich erinnernden Erzählerin wieder aufleben, setzt sich die Geschichte der beiden jungen Frauen erst andeutungsweise und dann in immer größerer Dichte zu einem komplexen und spannungsreichen Erinnerungsbild zusammen. Dabei wird das Prozesshafte des Erzählvorgangs immer wieder herausgestellt, es ist ein Erzählen, das seine Subjektivität hervorkehrt, das zweifelnd, suchend, verwerfend, fragend, tastend vorgeht. Sara ist sich der Subjektivität und Lückenhaftigkeit ihrer Erinnerung bewusst:
Vielleicht ist das Erinnern für mich wie ein zugefrorener See — trüb und glatt –, an dessen Oberfläche sich von Zeit zu Zeit ein Riss auftut, durch den ich meine Hand stecken und ein Detail, eine Erinnerung im kalten Wasser fassen kann. Doch zugefrorene Seen sind heimtückisch. Mal erwischt man einen Fisch, ein anderes Mal bricht man ein und ertrinkt. Aus Erfahrung weiß ich, dass fast alle Erinnerungen an die die Tendenz zu Letzterem haben. Deshalb hatte ich mich auch zwölf Jahre lang bemüht, mich nicht zu erinnern.
Lana Bastašić, Fang den Hasen
Und ebenso bewusst ist ihr die Schmerzhaftigkeit, die in der Erinnerung mit eingeschlossen oder, um im Bilde zu bleiben, eingefroren ist und die mit Wucht über einen hereinbricht, wenn der zugefrorene See des Vergessens Risse zeigt.
Eine weitere Protagonistin des Romans ist somit die metaphernreiche Sprache, mit der die Autorin die vielschichtigen Gefühle und Gedanken ihrer Figuren zugleich intensiv und doch mehrdeutig zum Ausdruck zu bringen versteht. Lana Bastašić neigt ein wenig dazu, sich von ihren schillernden Sprachbildern hinreißen zu lassen, doch sind diese stets auch durchdacht, tauchen an anderen Stellen leicht verändert wieder auf und machen den Text zu einer fortwährenden Metamorphose, die auch einen großen Lesesog erzeugt und einen davor bewahrt, in einem vorgefertigten Urteil über die Figuren und ihre Geschichten zu verharren. Trotzdem sucht die Ich-Erzählerin, für die Sprache Beruf und Berufung ist, natürlich nach der Wahrheit in den Erinnerungen an die gemeinsame Vergangenheit. Und war die Literatur nicht früher auch eine Art sinnstiftender Code der Freundschaft der beiden Mädchen? Über Jahre hinweg spielten sie immer wieder das Spiel, anhand eines Zitats den Buchtitel zu erraten, aus dem dieses entnommen war. Dieses Spiel war auch ein Code des gegenseitigen Verstehens, eine Art uneigentliches Sprechen, wie es ja auch die Sprache der Literatur kennzeichnet. Doch gerade von Lejla kommt der Vorwurf, Sara konstruiere eine Geschichte, die so nur in ihrer Fantasie stattgefunden habe; und tatsächlich streut die Autorin bzw. die Ich-Erzählerin selbst, indem sie punktuell auch Lejlas Gegenerzählungen wiedergibt, immer wieder Unsicherheitsstellen in den Text ein. Liegt die Wahrheit wirklich in den Worten? Und liegt das wahre Wesen Lejlas wirklich in ihrem alten Namen, mit dem nur Sara sie noch anredet, ihn symbolisch aufladend, ja fast magisch überhöhend?
Letztlich verhandelt der Roman nichts weniger als die Frage nach dem Verhältnis von Kunstwerk und Wahrheit, und folgerichtig stehen die beiden Frauen am Ende ihrer gemeinsamen Reise, die eigentlich kein konkretes erreichbares Ziel haben kann, sondern therapeutischer und metaphorischer Art ist, in Wien vor Dürers Hasen. Wird Sara hier den verschollenen Armin wiedersehen? Oder ist auch er zu einem Bild in ihrer Erinnerung geworden, das sich längst von der Wirklichkeit entfernt hat? So sehr sie die Wiederbegegnung mit diesem früher so faszinierenden Jungen herbeisehnt, der im gewaltsamen Chaos der ethnischen Auseinandersetzungen verschwunden ist, so sehr fürchtet sie sich auch vor der Konfrontation mit ihrer Vergangenheit in einer Familie, in einem Land, in einer Zeit, die unübersehbare Narben hinterlassen hat, die auch nicht verschwinden, wenn man wie Sara Bosnien den Rücken gekehrt hat.
Sie [Lejla] erinnerte mich daran, dass der natürliche Zustand dieser Welt Unordnung war und dass unsere Leben, die um die Anstrengung herum organisiert waren, Ordnung in all dieses Chaos zu bringen, eigentlich nichts anderes waren als ein Spiegelbild endloser Arroganz.
Lana Bastašić, Fang den Hasen
Sicher geht man nicht zu weit, wenn man die Autorin selbst ein bisschen in ihrer Ich-Erzählerin wiederzufinden meint; auch die in Bosnien aufgewachsene Lana Bastašić ist ausgewandert, hat in Irland gelebt, dann in Spanien, und auch sie verwandelt ihre Erfahrungen in Kunst, transponiert das Chaos der Welt in die alles andere als arrogante, vielmehr komplexe und ambivalente Sprache der Literatur.
Bibliographische Angaben
Lana Bastašić: Fang den Hasen, S. Fischer (2021)
Aus dem Bosnischen von Rebekka Zeinzinger
ISBN: 9783103970326
Bildquelle
Lana Bastašić, Fang den Hasen
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main