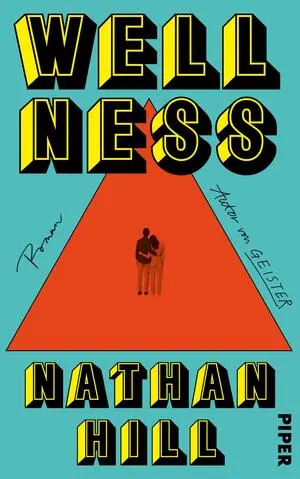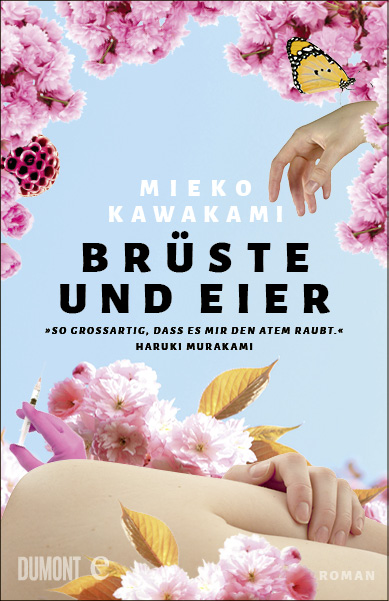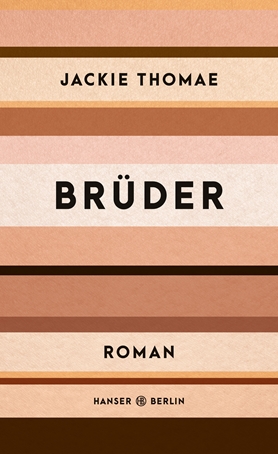Ein junger Mann und eine junge Frau, jeweils auf ihre Weise in den dunkleren Vierteln im Chicago der 1990er Jahre gestrandet, beobachten sich heimlich gegenseitig in den mal erleuchteten, mal abgedunkelten Fenstern ihrer gegenüberliegenden Wohnungen. Er heißt Jack und ist ein junger Kunststudent, der sich seiner ländlichen Wurzeln zu entwinden versucht, sie heißt Elizabeth und stammt aus einer reichen Familie, zu der sie ebenfalls jeden Kontakt abgebrochen hat. Wie es der Zufall will, oder das Schicksal…, begegnen sich diese beiden Seelen, die trotz ihrer so unterschiedlichen Charaktereigenschaften und Herkunftmilieus so gut zusammenzupassen scheinen, in der subkulturellen Szene Chicagos. Es ist der romantische Beginn einer Liebe, deren Geschichte Nathan Hill auf vielen ungemein spannenden und psychologisch wie gesellschaftlich tief grabenden Seiten entfaltet. Wo jedoch eine traditionelle Liebesgeschichte wohlweislich endet, nämlich mit der Eheschließung, setzt der Autor nun erst so richtig an, um aus der vor Jahren verfassten Kurzgeschichte über zwei sich liebende Voyeure einen großangelegten Roman zu spinnen, der um die Geschichte einer Ehe herum ein ganzes Gesellschaftspanorama entwirft.
Nach dem Eingangskapitel, in dem sich Jack und Elizabeth kennenlernen, springt die Erzählung um viele Jahre nach vorn und zeigt das Paar, das inzwischen einen Sohn im Grundschulalter hat, in ihrer Ehe, in die eine nicht mehr übersehbare Unzufriedenheit eingezogen ist. Ein wichtiger Meilenstein in ihrem Leben als Familie steht bevor, der Umzug in eine Eigentumswohnung, die, als Teil eines bisher noch in der virtuellen Planungsphase steckenden ambitionierten Wohnprojekts, in einem der wohlhabenderen Viertel Chicagos liegen wird und, unter anderem mit zwei getrennten Schlafbereichen, auch alle Unsicherheiten moderner Ehe- und Familienplanung zu berücksichtigen versucht. Es folgen in weiteren Kapiteln immer wieder Rückblicke in die Kindheit von Jack und Elizabeth, in ihre Studienjahre, und auch in die Vorgeschichte ihrer Familien. So wenig hier linear erzählt wird, so wenig unternimmt Nathan Hill, ohne deshalb allzu große stilistische Experimente einzugehen, mit denen er von den für den amerikanischen Gesellschaftsroman gegenwärtig geltenden Erzählkonventionen abweichen würde, den Versuch, seine Figuren als lineare Persönlichkeiten mit fest umrissenen Identitäten anzulegen. Und doch lernt man Jack und Elizabeth mit ihren facettenreichen Ichs, deren zeitliches Ineinanderfließen Marcel Proust in seiner Recherche du temps perdu so unvergleichlich, unübertroffen als literarische Wahrheit herausgearbeitet hat, mit all ihren schwankenden Gefühlen, Ängsten, Hoffnungen, Vorstellungen sehr gut kennen. Diese auf ihre je eigene Weise sensiblen und reflektierten Menschen werden einem bald sehr vertraut und offenbaren einem gleichwohl bis zum Schluss immer wieder neue Seiten.
Der Roman ist voll von Psychologie, was ihm gelegentlich schon vorgeworfen wurde, was sich aber eigentlich sehr stimmig in die Fiktion fügt, die mit der Psychologin und fast obsessiven Wissenssammlerin Elizabeth eine Figur ins Zentrum stellt, die alles durch eine psychologische Brille betrachtet. Mindestens ebenso sehr nimmt der Roman auch eine soziokulturelle Analyse vor, er ist eine fein beobachtete und literarisch komplex aufgearbeitete soziologische und kulturgeschichtliche Darstellung der letzten 20, 30 Jahre. Es wird hier den zahlreichen in der gegenwärtigen Gesellschaft auftretenden Differenzen nachgespürt, eindrücklich zum Beispiel der wachsenden Kluft zwischen amerikanischer Provinz und Weltläufigkeit, zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Zu letzterer gehört etwa Jacks Vater, der in der Prärie beheimatet ist und sich, als alternder, erkrankter Mann von den Algorithmen des Internets in die Irre und in so manche obskure Verschwörungstheorie (ent)führen lässt. Auch Herkunft und Verwurzelung sind ein wichtiges Thema des Romans und damit verbunden die Frage der Gruppenzugehörigkeit, die die Angst vor dem Ausschluss ebenso beinhaltet wie den Wunsch, anders, ja besonders zu sein. Die Figuren, und allen voran natürlich Jack und Elizabeth, sind hier auch symptomatisch für die Zeit und die Gesellschaft, der sie erwachsen. Trotz ihrer Unterschiede haben sie nämlich ein gemeinsames Lebensthema, das sie mit unzähligen Menschen heute teilen dürften: Beide sehnen sich nach einer irgendwie gearteten Gewissheit im Leben, die der permanenten Veränderung der Umwelt und des Ichs abzuringen ist, beide erleben seit ihrer Kindheit, welchen Kraftakt es bedeutet, sich immer wieder an neue Umstände anpassen zu müssen. Die vielen Seiten, die ihrem Aufwachsen eingeräumt werden, sind also nicht nur der psychologischen Herleitung der Charaktere und ihrer sozialen Bedingtheit geschuldet, sondern zeigen auch das Potential, das der charakterlichen Entwicklung trotz allem innewohnen kann.
Elizabeth hat während ihres Studiums an einem Institut für Placeboforschung zu arbeiten begonnen; später wird sie dort die Leitung übernehmen. Das Institut, dessen Tarnname, Wellness, mit einer gewissen Ironie den Zeitgeist aufs Korn nimmt, ist im Grunde das metaphorische Zentrum des Romans. Denn Nathan Hill veranschaulicht an der zwangsläufig im Halbdunkel zwischen Lüge und Wahrheit stattfindenden Arbeit der Placeboforschung, welche Macht die Verpackung einer geschickt erzählten Geschichte auf uns Menschen ausübt, wie bereitwillig wir uns täuschen und manipulieren lassen, wenn wir im Gegenzug etwas serviert bekommen, an das wir glauben können. Das Ritual ist in unserer heutigen Zeit längst nicht ausgestorben, sondern bedeutsam wie eh und je. Placebos zeitigen nämlich vor allem dann signifikante Effekte, wenn sie mit einer Sinn stiftenden Geschichte aufgeladen, mit einem bildhaften Kontext angereichert werden, der den Glauben stärkt — an die Heilung ebenso wie an das Produkt. Diesen psychologischen Mechanismus, seine ethische Ambivalenz und seine gesellschaftliche Brisanz, führt uns der Autor in seinem Text immer wieder vor Augen; in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zeigt sich das Fortdauern des Glaubenwollens, das Nathan Hill als eine anthropologische Grundkonstante herausarbeitet. Ob es um technische Phänomene wie den Erfolg von Hypertext und Algorithmus geht, um esoterische Selbsthilfegruppen, um den Immobilienmarkt, um Ernährungsfragen, Fitness, Kindererziehung, Kunst und Ästhetik — das Verhalten der Menschen erscheint in seiner ideologischen Anfälligkeit als gefährlich manipulierbar, der Erfolg eines neuen Trends, eines neuen Mediums dann garantiert, wenn es ihm gelingt, wenig oder nichts zu etwas Bedeutungsschwerem aufzublasen und die Menschen mit einer möglichst emotionalen Geschichte zu ködern, die sie in ihrer Einsamkeit, in ihrer Wut, in ihrer Angst zu verstehen scheint. Und während ehedem der Satan als Gegenspieler Gottes herhalten musste, um das menschliche Gewaltpotential aufzufangen, entstehen heute allerorten neue Teufelsbilder, gegen die mit Hass und Hetze gepredigt wird. Das Gewaltsame des Rituals, seine auf Exklusion beruhende Funktionsweise, wirkt auch in den Weiten des kaum regulierbaren Internets mit umso größerer Zerstörungskraft weiter fort.
Als Elizabeth die Leitung von Wellness übernimmt, verändert sie die Ausrichtung des Instituts verstärkt auf die praktische Anwendung der Placebos, in denen sie anfangs noch in gutem Glauben ein Heilmittel gerade für die durch Stress, Überforderung, Unübersichtlichkeit ausgelösten chronischen Krankheiten unserer Zeit sieht, das den Menschen vorzuenthalten ethisch noch weniger vertretbar sei, als es ihnen unter Vorgaukelung falscher Tatsachen anzubieten. Vielleicht kann ein ernährungstechnisch harmloser Placebo-Liebestrank sogar Beziehungen retten? Oder unterstützt man damit auf unethische Weise einen Prozess, in dem der Schmerz darüber, betrogen und belogen worden zu sein, einfach in eine neue Lüge, diesmal sich selbst gegenüber, verkehrt wird? Während Elizabeth also, wie es eine Romanfigur einmal etwas hinterhältig auf den Punkt bringt, mit ihren Placebos nichts verschreibt, fotografiert Jack mit seiner scheinbar abstrakten Fotokunst das Nichts, beide frönen sie der Abwesenheit, der Leere — ein Ausdruck unserer gegenwärtigen Haltlosigkeit? Doch so, wie Elizabeths Placebos zwar substanzlos sind, aber nicht unbedingt folgenlos, wird, so tief wurzelt das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit, auch Jacks Kunst mit allerlei „content“, wie man heute so schön sagt, versehen, ja es blitzt am Ende gleichsam als Ausdruck literarischer Gerechtigkeit sogar eine Form von Wahrheit auf, die zumindest für ihn eine Bedeutung hat, die nicht konstruiert ist. Davor jedoch wird auch die Kunst im Verlauf des Romans immer wieder als ein gesellschaftliches Spielfeld vorgeführt, auf dem, abgekoppelt von der Wirklichkeit, eine Bedeutung, eine Sinnhaftigkeit konstruiert wird, mit der sich die Menschen selbst etwas vormachen. Jacks plötzliche Wertschätzung als ernstzunehmender Künstler entsteht, wie es in einer der satirisch entlarvenden Szenen geschildert wird, in denen Nathan Hill mit feinem erzählerischem Witz Lebenslügen, Ideologien und sonstige gesellschaftlich verbreitete Verhaltensweisen ad absurdum führt, durch eine einzige Notlüge in einer ziemlich peinlichen Situation: Um zu verschleiern, dass er seine Befugnisse als studentische Hilfskraft auf ziemlich dilettantische Weise dazu missbraucht hat, auf den damals noch langsam arbeitenden Universitätsrechnern Pornographie herunterzuladen, verleiht Jack den verräterischen Bildern, von denen er Abzüge gemacht hat, kurzerhand eine Metaebene, um sie als künstlerisches Projekt auszugeben. Ohne diese nachträglich aufgepfropfte höhere Ebene, ohne den sinnstiftenden Kontext, ohne die Fiktion droht alles reine Materialität zu bleiben, in der Kunst, in der Liebe, in allem, was man im Leben angeht.
Dieses durch den gemeinsamen Nenner des Placebohaften zusammengehaltene Ineinander von Kunst, Ästhetik, Gesellschaft und Psychologie, die Fülle der Motive, Symbole, Spiegelungen, die sich durch die Erzählung ziehen, das geschmeidig in die Handlung integrierte Wiederaufgreifen und Variieren von Verhaltensmustern ebenso wie von gesellschaftlichen und kulturellen Phänomen ist der Grund, weshalb ich Wellness, auch wenn der Text kein dekonstruktivistisches Formexperiment ist, sondern eine jederzeit verständliche klassische Erzählung, für mehr als einen Unterhaltungsroman halte.
Bibliographische Angaben
Nathan Hill: Wellness, Piper 2024
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Stephan Kleiner und Dirk van Gunsteren
ISBN: 9783492605496
Bildquelle
Nathan Hill, Wellness
© 2024 Piper Verlag GmbH, München