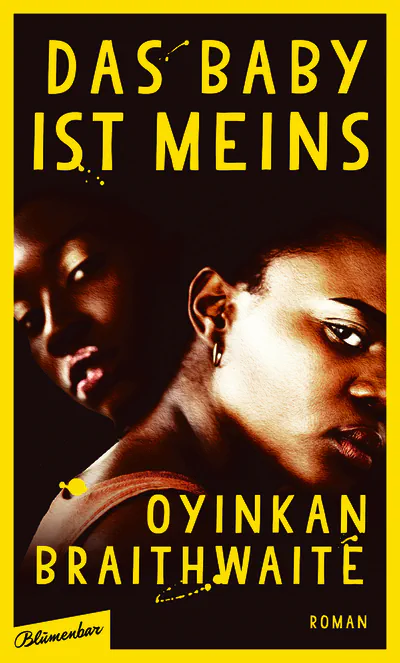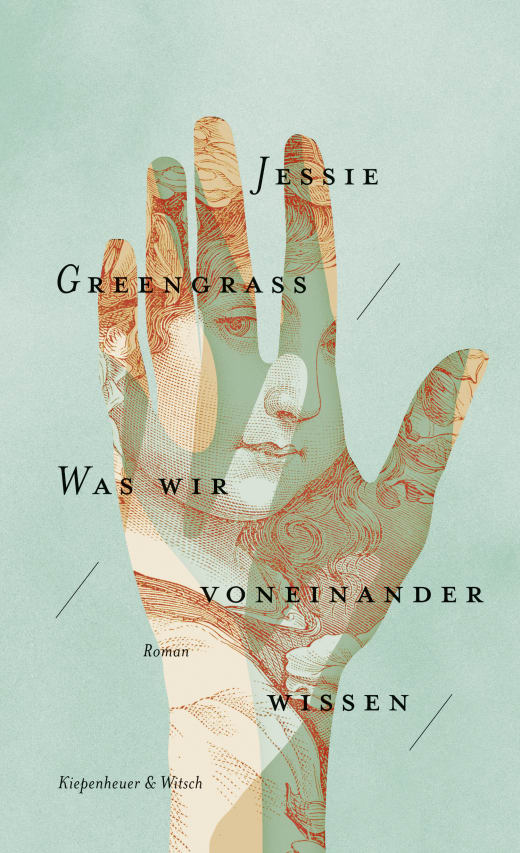Für mich ist Brüste und Eier die literarische Überraschungssensation aus Japan! Mit jeder Seite hat mich das Buch, bei dem natürlich zuerst der auffällig-amüsante Titel ins Auge sticht, thematisch und stilistisch mehr fasziniert.
Der Roman bebildert eine ganze Palette tradierter und neuer, provozierender und miteinander kollidierender weiblicher Rollenbilder, die Mieko Kawakami, die Autorin, im Laufe der Handlung in ihrem ganz eigenen Stil aus den verschiedenen sehr lebensecht gezeichneten Figuren herausarbeitet. Auf diese Weise entsteht ein differenziertes Gesellschaftsportät, das alle so unterschiedlich gearteten Lebensentwürfe und die Individuen, die dahinter stehen, zugleich ernst nimmt und doch immer wieder auch mit einem humoristischen, entlarvenden Blick bedenkt. Es geht — und hier kann man sich ganz wunderbar mit den Figuren identifizieren — um die tastende, experimentierende, sich vergleichende Suche nach einem Ort für das (v.a. weibliche) Ich in der Gesellschaft.
Dabei ist der Roman alles andere als ein Selbstfindungsratgeber oder ein so genannter „Frauenroman“, er gerät auch nicht in die Nähe eines feministischen Manifests oder eines Thesenromans, sondern er bleibt auf jeder Seite richtig gute fiktionale Literatur, ein polyvalenter Text, der relevante soziale und allgemeinmenschliche Fragen aufwirft und sie in eine spannende Geschichte einbettet.
Los geht diese mit dem titelgebenden ersten Teil, der auf einer Novelle basiert, für die Kawakami 2008 bereits den wichtigsten japanischen Literaturpreis bekam. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive von Natsuko, einer 30-jährigen Schriftstellerin aus armen Verhältnissen, die noch nichts veröffentlicht hat und sich mit verschiedenen Jobs in der Großstadt Tokyo über Wasser hält. Im Sommer, in dem die Geschichte beginnt, bekommt sie Besuch aus ihrer Heimat Osaka: von ihrer älteren Schwester Makiko, die mit ihrem alternden Körper hadert und von der Idee besessen ist, sich in Tokyo die Brüste vergrößern zu lassen, und deren junger Tochter Midoriko, die den Beginn ihrer Pubertät wie einen Schock durchlebt und seit kurzem aufgehört hat, mit ihrer Mutter zu sprechen. Stattdessen kommuniziert sie, soweit nötig, über ein Notizbuch. In ein weiteres Buch schreibt sie ihre Tagebucheinträge, die im Text mit abgedruckt werden. Sie verraten die Empörung und Verunsicherung, ja die Verzweiflung, mit der Midoriko ihre hormonelle Veränderung vom Kind zur Frau und die damit verbundenen genderspezifischen Zuschreibungen beobachtet. Beim Wiedersehen eines Spielzeugroboters, in den kleine Kinder zum Spaß hineinschlüpfen können, gewinnt ihre Erinnerung an ein solches Erlebnis in ihrer eigenen Kindheit plötzlich eine ganz neue, erschreckende Dimension:
Die Hand bewegt sich. Die Beine bewegen sich auch. Komisch, wenn man, ohne zu wissen, wie es geht, einzelne Teile bewegen kann. Ich bin plötzlich in meinem Körper, und der Körper verändert sich, ständig und ohne mein Zutun. Warum kann mir das nicht einfach egal sein? Der Körper verändert sich weiter. Das ist düster. Diese Düsternis füllt meine Augen, am liebsten würde ich sie zumachen. Aber ich habe Angst, dass ich sie dann nicht mehr aufmachen kann. Meine Augen quälen mich.
Kawakami: Brüste und Eier, Teil I, Eintrag Midoriko
Das Verhältnis Midorikos zu ihrer Mutter ist nicht nur dadurch gestört, dass sie entsetzt über die geplante Schönheitsoperation ihrer Mutter ist, die sie als einen verheerenden Eingriff in die ohnehin beunruhigende weibliche Körperlichkeit empfindet, sondern auch durch ein sozial bedingtes Gefühl der Ohnmacht, hilflos zusehen zu müssen, wie ihre Mutter sich als billige Arbeitskraft in einem Nachtclub ausbeuten lässt, um sich und ihrer Tochter gerade so ein bescheidenes Leben zu ermöglichen.
Natsuko beobachtet die sich zuspitzende und schließlich kathartisch entladende Anspannung zwischen Mutter und Tochter, und macht sich — und hier deutet sich bereits die Schriftstellerin an, die sie im Begriff ist zu werden — ihre eigenen Gedanken über die tieferen Ursachen der Krise:
Oje, dachte ich, den beiden fehlen die Worte. Mir fehlten in dem Moment natürlich auch die Worte. Worte, Worte, wiederholte ich im Geist, aber sagen konnte ich nichts.
Kawakami: Brüste und Eier, Teil I
Die Suche nach Worten, ihre kontextuelle Einordnung und Gewichtung sowie ihre folgenreiche, sich mitunter verselbständigende Wirkung setzt sich auch im zweiten Teil des Romans fort, der etwa ein Jahrzehnt später spielt. Natsuko hat inzwischen recht erfolgreich einen Roman veröffentlicht und arbeitet an einem zweiten, mit dem sie jedoch nicht wirklich gut vorankommt. Die Berufswelt drängt sich nun in den Vordergrund, während im ersten Teil Familie und Herkunft im Zentrum standen. Natsuko trifft sich mit ihrer Agentin, mit Kolleginnen, geht leicht befremdet zu Autorenlesungen, schreibt Essays und denkt eher lustlos über die Weiterentwicklung ihres Romankonzepts nach. Doch unversehens ergreift ein neues Thema Besitz von ihr, schiebt sich mit einem immer nachdrücklicheren Kinderwunsch das Thema der familiären Gestaltung des eigenen Lebens nach vorne, und auch das Thema der eigenen Herkunft lässt sich in diesem Zusammenhang nurmehr schwer verdrängen.
So besucht die inzwischen Ende 30-jährige, allein lebende Natsuko Vorträge und Diskussionsrunden zum Thema Samenspende, wo sie den gleichaltrigen Jun Aizawa kennenlernt, der sich als Betroffener engagiert: Mit einer Samenspende gezeugt, ist er seit langem vergeblich auf der Suche nach seinem leiblichen Vater. Es entwickelt sich zunächst etwas holprig und dann doch ganz behutsam eine Freundschaft zwischen den beiden; Jun und Natsuko kommen sich emotional näher, doch Natsukos Asexualität und Juns als traumatisch empfundene Vaterlosigkeit stellen so einige Hürden bereit, in denen sich persönliche Ängste und gesellschaftliche Tabus zu scheinbarer Unüberwindlichkeit auftürmen.
Die beiden Romanteile erscheinen auf den ersten Blick fast wie zwei eigenständige Geschichten, die sich aber dann sehr stimmig zu einem romanesken Gesamtwerk fügen, verbunden durch die Stimme der Ich-Erzählerin, für die die junge japanische Autorin einen sehr überzeugenden, eigenwilligen und zugleich sympathischen Stil gefunden hat. Denn Natsuko stellt sich permanent infrage, sie lebt ihr Leben reflektiert, beobachtet und sinniert, wie sie sich und ihre Bedürfnisse im Verhältnis zur Gesellschaft, zur Familie, zu den Kollegen und Freunden positionieren soll. Sie macht schmerzhafte Erfahrungen, leidet unter großen Unsicherheiten und Zweifeln, erlebt aber auch intensiv die schönen Momente und durchlebt sehr bewusst die immer wieder an die Oberfläche drängenden Erinnerungen an ihre früh verstorbene Mutter und ihre Großmutter.
Da sich die Handlung an den so vielfältigen Fragen der Weiblichkeit entzündet, steht die Frage nach dem Selbstverständnis der Frau, ihrer Unterdrückung und den in Japan noch immer einflussreichen starren Rollenbildern im Spannungsfeld mit den immer größeren Möglichkeiten der Technik sowie mit generellen Erwartungen und Ansprüchen wie körperlicher Schönheit und Mutterschaft. Ohnehin ein komplexes Gefilde wird es, so zeigt die Autorin anschaulich, umso komplizierter, wenn man in irgendeiner Form aus der Rolle fällt, wie die asexuelle Erzählerin Natsuko, die auch ohne eheliche, sexuelle Bindung ein Kind großziehen möchte.
Über die Form des Dialogs, den Kawakami meisterlich beherrscht, lernt man auf fast beiläufige, aber zugleich sehr direkte und intensive Weise eine Vielzahl verschiedener hauptsächlich weiblicher Biographien kennen. Die Charaktere, die in den Gesprächen, aber auch durch die feinen Beobachtungen der Ich-Erzählerin ganz rund und plastisch hervortreten, haben alle ihre ganz eigene Geschichte, ihre eigene Haltung, und verfolgen, auch wenn das Schicksal mit voller Wucht zugeschlagen hat, doch mehr oder weniger hartnäckig ihren eigenen Weg, der jedoch für jede ein ganz anderer ist.
In Beziehungsfragen genauso wie bei der Frage, ob man sich dafür oder dagegen entscheidet, ein Kind zu bekommen, gibt es keine allgemeine Richtlinie. Und man kann so viele rationale Abwägungen vornehmen, wie man will, letztlich ist es eine Entscheidung, die jede Frau, jeder Mensch immer von neuem für sich treffen muss und die immer auch ein Sprung ins Ungewisse ist, wie es gegenwärtig etwa auch die amerikanische Philosophin L.A. Paul in ihrer Forschung zu Rationalität und Mutterschaft skizziert (vgl. Dies.: Was können wir wissen, bevor wir uns entscheiden? Von Kinderwünschen und Vernunftgründen, Reclam 2020). Und das erahnt nach vielen Gesprächen, Enttäuschungen und Ermutigungen auch die Romanfigur Natsuko immer deutlicher und trifft deshalb am Ende des Romans tatsächlich eine Entscheidung — eine Entscheidung, die ihre eigene ist, und zugleich das Spiel des Lebens, des Zufalls, der Begegnung zulässt…
So vielstimmig hier ein komplexes Thema behandelt wird, so faszinierend ist die écriture, der stilistische Ton der Autorin, der von einem tiefen, anschaulichen und sehr flüssig lesbaren Realismus geprägt ist, sich jedoch manchmal leicht satirisch zuspitzt und mitunter ins Surreale, ins Traumhaft-Psychologische gleitet, poetisch ins Innenleben der Erzählerin eintaucht und insgesamt eine unvergleichlich fesselnde Erzählung hervorbringt, die lang und intensiv in einem nachklingt, ob man nun aus Japan kommt oder aus einem anderen Land, ob man sich über einen Kinderwunsch den Kopf zerbricht oder unsicher in seinem Körper fühlt. Die Entscheidung, den Roman zu lesen, ist in jedem Fall ein Wagnis, das ich unbedingt empfehle einzugehen!
Bibliographische Angaben
Mieko Kawakami: Brüste und Eier, DuMont 2020
Aus dem Japanischen übersetzt von Katja Busson
ISBN: 9783832170431
Bildquelle
Mieko Kawakami, Brüste und Eier
© 2020 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Köln