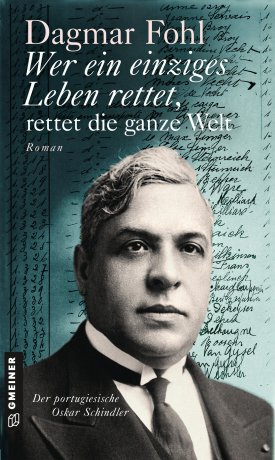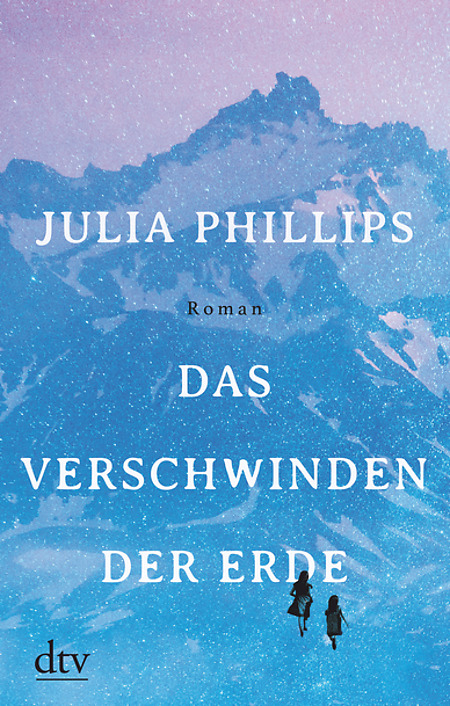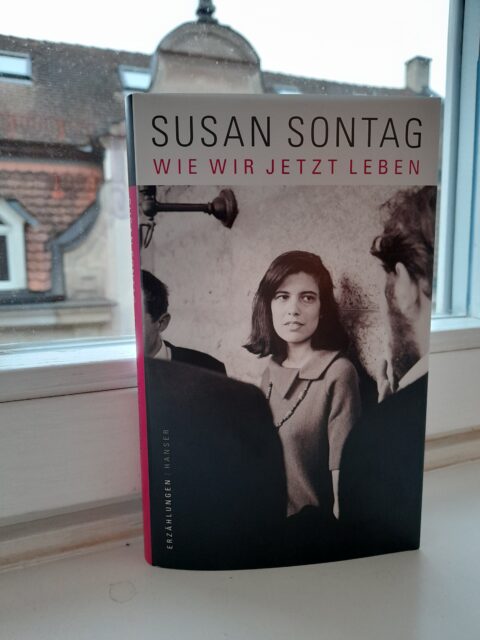„Wer ein Leben rettet, rettet die Welt.“ Diese Worte, die auch als Inspiration für den Titel des neuen Romans der Schriftstellerin und Historikerin Dagmar Fohl dienten, sind heute als Epitaph auf dem Grabstein des Portugiesen Aristides de Sousa Mendes zu lesen und erinnern an sein mutiges Engagement während eines der düstersten Kapitel der europäischen Geschichte. Der portugiesische Generalkonsul, der zur Zeit des Nationalsozialismus in Bordeaux in Frankreich tätig war, rettete wohl etwa 30.000 Menschen das Leben, indem er denen, die sich auf der Flucht vor dem nationalsozialistischen Regime befanden, unterschiedslos und bald auch gegen die ausdrücklichen Anordnungen des faschistischen Herrschers im eigenen Lande, António de Oliveira Salazar, Visa ausstellte und Berufsethos und Menschenwürde über den eigenen Vorteil und die eigene Sicherheit erhob. Doch obwohl Sousa Mendes das Ende des Zweiten Weltkrieges um einige Jahre überlebte, starb er einsam, verarmt und ohne von dem Regime, dessen autoritäre Herrschaft in Portugal noch bis zur Nelkenrevolution 1974 fortdauerte, rehabilitiert worden zu sein. Dies geschah auch unter demokratischen Vorzeichen erst in den späten 1980er und 1990er Jahren.
Die Autorin lässt in ihrer gut recherchierten Romanbiographie Sousa Mendes selbst in der Ich-Form sprechen und macht seine letzte Lebensphase zur Erzählsituation, aus der heraus ihr Protagonist auf sein Leben und seine Taten zurückblickt. Die chronologisch strukturierten Erinnerungen dieses zu diesem Zeitpunkt schwer kranken und gebrochenen Mannes sind zugleich Lebensbeichte und Testament. Und sie sind, neben (auto)biographischen Schilderungen und historischen Einordnungen von vielen Zweifeln und Reflexionen durchzogen, mit denen er bzw. in Wahrheit natürlich die Autorin sein Handeln von mehreren Seiten beleuchtet, seinen Beweggründen nachgeht und seine auch von Sorgen und Ängsten begleiteten Entscheidungsfindungen einer selbstkritischen Prüfung unterzieht. In dieser Form kann Dagmar Fohl einerseits die keineswegs selbstverständliche Menschlichkeit dieses Mannes würdigen und andererseits der Gefahr einer allzu unkritischen Heldengeschichte entgehen.
Indem die Autorin die Selbstanalyse in die subjektive Ich-Perspektive ihres Protagonisten verlagert, kann sie dessen Geschichte auch ohne äußere moralisch-ethische Bewertungen seines Verhaltens erzählen, das keineswegs zu jeder Zeit tadellos und vorbildlich war. Es gibt durchaus auch dunklere Seiten und einen inneren Zwiespalt in ihm. Das zeigt sich vor allem an Sousa Mendes‘ streng christlicher Lebensweise, die bei ihm einerseits mit einem bestimmten Menschenbild einhergeht, das ihn in seinem Handeln für die Verfolgten bestärkt, andererseits jedoch eine gewisse Bigotterie nicht ausschließt, wenn er trotz seiner kinderreichen Ehe mit einer liebenden, treuen und loyalen Frau an seiner Seite eine geheime Beziehung mit einer viel jüngeren französischen Geliebten führt. Sousa Mendes, der aus einem alten portugiesischen Adelsgeschlecht stammt und weitläufige Ländereien besitzt und noch einige Zeit monarchistische Ansichten vertritt, steht außerdem nicht von vornherein auf der Seite der Armen und Deklassierten. Umso eindrücklicher wirkt aber vielleicht auch sein Eintreten für die Flüchtlinge, die durch politische Willkür als Staaten- und Rechtslose ganz nach unten gedrängt wurden.
Ich will aufrichtig sein und nichts verschweigen. Auch ich besaß Ländereien. (…) Es gab immerhin eine Schule, und ich wies den Verwalter an, die Bauern gut zu behandeln. Aber was bedeutet das? Auch ein Teil meiner Einkünfte speiste sich aus der Arbeit der Bauern. Ich war niemals ein Landreformer, auch ich beließ alles, wie es war. Daran hatte selbst meine Tolstoi-Lektüre nichts geändert. Ich gab Almosen an die Armen, von denen ich lebte, und fühlte mich dabei als guter Mensch. (…)
Wie widersprüchlich kann ein Mensch sein? Der Mann, der ich hätte sein mögen, lehnte den Mann ab, der ich war, und doch lebten die beiden unzertrennlich zusammen.
Dagmar Fohl, Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt
Nachdem Sousa Mendes von den Vertretern des trotz vorgeblicher Neutralität mit den Nazis kollaborierenden Regimes nach Lissabon zurückbeordert worden war, dauerte es nicht lange, bis er seines Dienstes enthoben und angeklagt wurde. Es folgten viele verzweifelte und zunehmend bittere Jahre eines vergeblichen Kampfes gegen die Verarmung und für seine Rehabilitierung. Die Verstrickung des Regimes in den Krieg, ein persönliches Ressentiment Salazars gegen den befehlsverweigernden Aristokraten, das Fortdauern des Polizeistaates in Portugal — dagegen hatten Sousa Mendes, seine Familie und seine Freunde, keine Chance, dagegen prallte jedes seiner in vielen Briefen niedergeschriebenen ethischen Argumente gnadenlos ab. Trotzdem, so entnimmt man dem Zweifeln und Ringen des hadernden, leidenden Mannes, der fast am Ende seines Lebens und seiner Hoffnung angekommen ist, blieb ihm doch eine unerschütterliche Gewissheit. Sein sozialer Abstieg und seine politische Desillusionierung waren ein zweifellos hoher Preis, den zu zahlen er — auch auf Kosten seiner Familie — jedoch in seiner seelenforschenden Rückschau für sich als alternativlos (an)erkennt: Er musste so handeln, wenn er sich selbst und seine Menschlichkeit nicht verraten wollte.
Zwar zwingt die Ich-Form die Autorin bisweilen in ein selbst gewähltes Korsett, in dem manche Selbstbeschreibung etwas aufgesetzt und ungewollt eitel wirkt, etwa wenn sie Sousa Mendes selbst sein gutes Aussehen schildern lässt. Doch außer dieser kleinen Einschränkung wird hier ein menschliches Schicksal in seiner Zeit insgesamt glaubwürdig erzählt. Und vor allem auch mit viel historischem Hintergrundwissen, das einen sehr differenzierten Blick ermöglicht, der sich hinter den meist ganz einfachen und scheinbar locker herunterzulesenden Sätzen verbirgt. Man muss sich bewusst sein, dass diese Romanbiographie weniger handlungsreiche, schillernde Szenen bereithält als nachdenkliche Reflexionen, und sich darauf einlassen, dass das Romaneske an vielen Stellen von einem verständlich geschriebenen Geschichtsbuch verdrängt wird, das sich in die komplexeren Bereiche dieser historischen Epoche vorwagt und zeigt, wie sich auch andere Länder durch Kollaboration, Wegschauen oder Profitgier an den Verbrechen des Faschismus mitschuldig gemacht haben. Doch daran wird man, genauso wie auch an das vor diesem Hintergrund umso eindringlicher wirkende Beispiel von Sousa Mendes, noch lange, nachdem man das eher schmale Buch zuende gelesen hat, mit Erschütterung denken.
Bibliographische Angaben
Dagmar Fohl: Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt – Der portugiesische Oskar Schindler, Gmeiner (2020)
ISBN: 9783839227718
Bildquelle
Dagmar Fohl, Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt
© 2020 Gmeiner-Verlag GmbH, Meßkirch