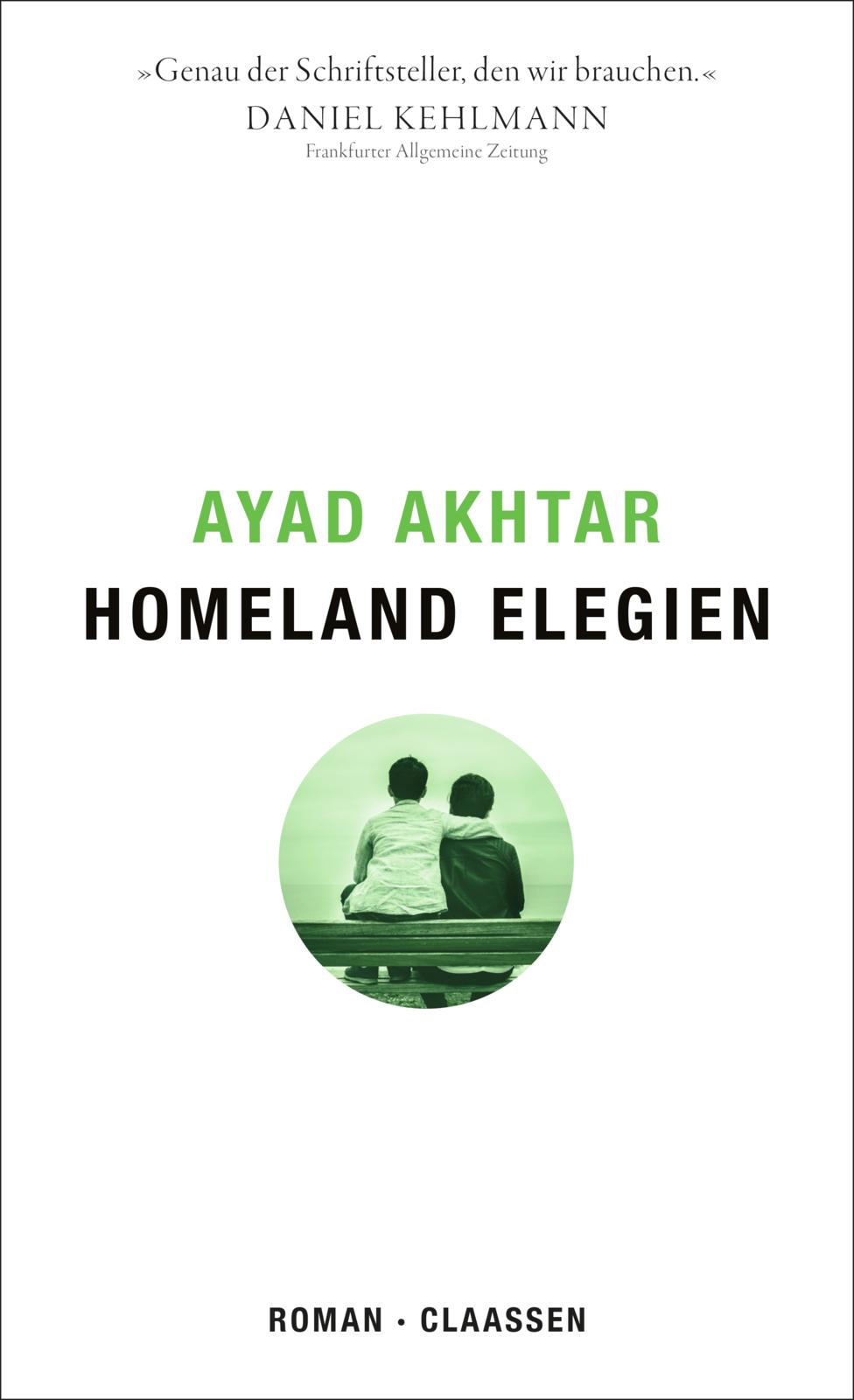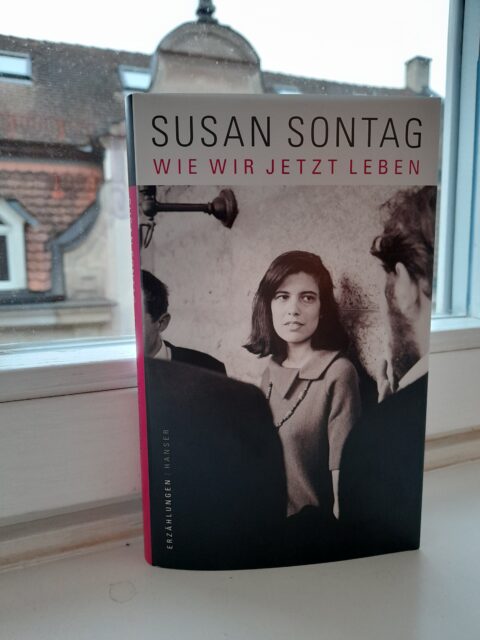Auch literarische Gattungsbezeichnungen dienen natürlich dazu, dem Leser Orientierung zu geben und ihm eine Wiederkehr an einen vertrauten Ort zu versprechen. Ganz besonders ist das bei der gegenwärtig wohl beliebtesten Gattung „Roman“ der Fall, zu welcher auch Ayad Akhtars neues Buch gehören soll. Doch die Literatur als Kunstform entzieht sich nicht selten einer solch eindeutigen Zuordnung, ja kann vielmehr gerade durch einen stilistisch gewandten individuellen, ästhetisch freien Umgang mit Sprache und Struktur an literarischer Bedeutung gewinnen.
Der Autor der Homeland Elegien erweist sich nun gerade in diesem Buch als ein Schriftsteller, der sich Einordnungen aller Art immer wieder entzieht, ein natürliches Misstrauen gegenüber einfachen Zuschreibungen hegt und mit Genuss die Widersprüche und die mal staunenswerte, mal irritierende Vielfalt, die sich dahinter verbergen, zu Tage treten lässt. So wäre, obwohl Akhtar seinem Ich-Erzähler seinen eigenen Namen gegeben hat, auch die Bezeichnung „Autobiographie“ zu kurz gegriffen, da eine Herzensangelegenheit des Autors gerade darin besteht, Fiktion und Realität, Autor und Werk, nicht vorschnell in eins zu setzen, wie das bei seinen Theaterstücken in der Vergangenheit bereits passiert ist. Nicht zuletzt ist der Text auch eine künstlerisch freie Stellungnahme zu all den in der geschwätzigen (sozialen) Medienwelt kursierenden Spekulationen über den Autor preisgekrönter und zugleich umstrittener Dramen (v.a. Disgraced aus dem Jahr 2012 über muslimische Einwanderer in Amerika). Man könnte nun eine ganze Weile weitersuchen und Begriffe wie Autofiktion, literarischer Essay, anekdotenhafte Memoiren, humoristisch-philosophisches Tagebuch gegeneinander abwägen, um sich der Besonderheit seines Textes zu nähern. Vielleicht aber kommt man diesem intellektuell erfrischenden Buch, das einen immer wieder zum Lachen bringt und charmant provokant und hellsichtig auch den empörendsten Verhaltensweisen auf den Grund geht, eher mit den folgenden Zeilen aus dem Text selbst auf die Spur. Das autofiktionale Ich beschreibt hier, welcher Art die Notizen sind, die es sich — vielleicht ähnlich wie der Autor — immer wieder über die Erlebnisse und Eindrücke des Tages macht:
Die Technik, die ich für diese Aufzeichnungen anwendete, verdankte viel dem Traumtagebuch, das ich jahrelang geführt hatte. Ich kümmerte mich nicht um die Chronologie und legte großen Wert auf Details. Je lebendiger ein Fragment, ein Geräusch, ein Bild war — und je gründlicher ich es sprachlich verarbeitete –, desto ergiebiger war das Assoziationsfeld, das es erzeugte. Der Prozess war nicht intuitiv; es war, als würde ich die ursprünglichen Sedimentschichten auf einem zutage geförderten Erzklumpen identifizieren. Der Geist erinnerte sich an das Wesentliche und vergaß die Schlacke, doch gerade die enthielt so viel Leben.
Ayad Akhtar, Homeland Elegien
Eben diese chronologische Freiheit und diese tief unter der scheinbar glatten Oberfläche grabende Detailversessenheit sind charakteristisch für den Stil des ganzen Buches, das in großen thematischen Kapiteln einzelne Episoden aus der Vergangenheit des Ich-Erzählers, seiner Freunde und insbesondere seiner eigenen Familie enthält, in denen das Dialogische stark in den Vordergrund tritt und den intelligenten, alles hinterfragenden und sehr oft (selbst)ironischen Reflexionen des Erzählers eine bestechende Anschaulichkeit verleiht. In dieser komplexen und unorthodoxen Form gelingt dem Autor ein tiefer, subtiler und einfach hochinteressanter Einblick in die latenten psychologischen und gesellschaftlichen Antriebe und Widersprüche, Bedürfnisse und Ängste der amerikanischen Bevölkerung der Gegenwart. Ob es um Verwerfungen im Bereich des Gesundheitssystems, des Finanzsektors oder um die himmelschreiende Ungleichheit zwischen ländlichen und städtischen Regionen geht, immer wieder dringt er am ganz individuellen menschlichen Beispiel auch zu ökonomischen Strukturen vor, die das Denken, die (Vor-)Urteile und Verhaltensweisen der Menschen nachhaltig beeinflussen.
Bei all seinen Beobachtungen, die in einem Ton verfasst sind, in dem frech und ernsthaft, Anteil nehmend und kritisch entlarvend, involviert und analysierend, schmerzhaft und ironisch-witzig keinen Widerspruch bilden, stehen die einzelnen Menschen und ihre individuellen Geschichten im Vordergrund. Letztlich werden auch die abstrahierenden Schlüsse, die der sich gleichfalls immer wieder selbst in seinen Motiven und Urteilen erforschende Ich-Erzähler daraus zieht, nicht als endgültige Wahrheiten präsentiert. Allen porträtierten Verhaltensweisen liegen Biographien zugrunde, die zwar einiges erklären, doch sowohl in sich Brüche und Widersprüche aufweisen, so dass ein gebildeter muslimischer Kardiologe wie sein Vater eine Zeitlang Donald Trump verfallen ist, als auch untereinander kaum pauschal miteinander verglichen werden können. Es steht dem Autor fern, sich von einer bestimmten Gruppe oder einem Kollektiv vereinnahmen zu lassen. Gleichwohl er durchaus intensiv ergründet, inwiefern auch seine eigene Herkunft ihn in seinem Denken und Fühlen beeinflusst und gleichwohl er zahlreiche scheinbar alltägliche Situationen eines schmerzhaft am eigenen Leibe erfahrenen Rassismus schildert, erhebt er das Thema „race“ nicht zur identitätsstiftenden Maxime. Der Blick bleibt konsequent auf den einzelnen Menschen gerichtet und erreicht doch gerade dadurch eine umso ausgeprägtere Differenziertheit und Diversität, die der Autor schon in den so divergierenden Ansichten in seiner eigenen Familie erlebt.
Wenn ich überhaupt etwas in der albernen Schwärmerei meines Vaters für Trump sah, dann ein menschliches Element — schwach und irrational –, und das passte nicht in das klare Bild, das Mike vom Geist Amerikas zeichnete. Als Künstler vertraute ich eher dem Durcheinander.
Ayad Akhtar, Homeland Elegien
Gerade diese widerspenstige Detailversessenheit aber macht das Buch so sympathisch und so bereichernd! Und vor allem auch zu einem großen literarischen Kunstwerk, das — so die selbstverständlich auch keineswegs unhinterfragte These der Literaturprofessorin des Ich-Erzählers — die Welt vielleicht nicht gleich besser macht, aber doch bestimmt ein wenig die Augen zu öffnen vermag und so die beste Illustration dieser in die Kunst vertrauenden These darstellt.
Bibliographische Angaben
Ayad Akhtar: Homeland Elegien, Claassen (2020)
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
ISBN: 9783546100144
Bildquelle
Ayad Akhtar, Homeland Elegien
© 2020 Claassen in der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin