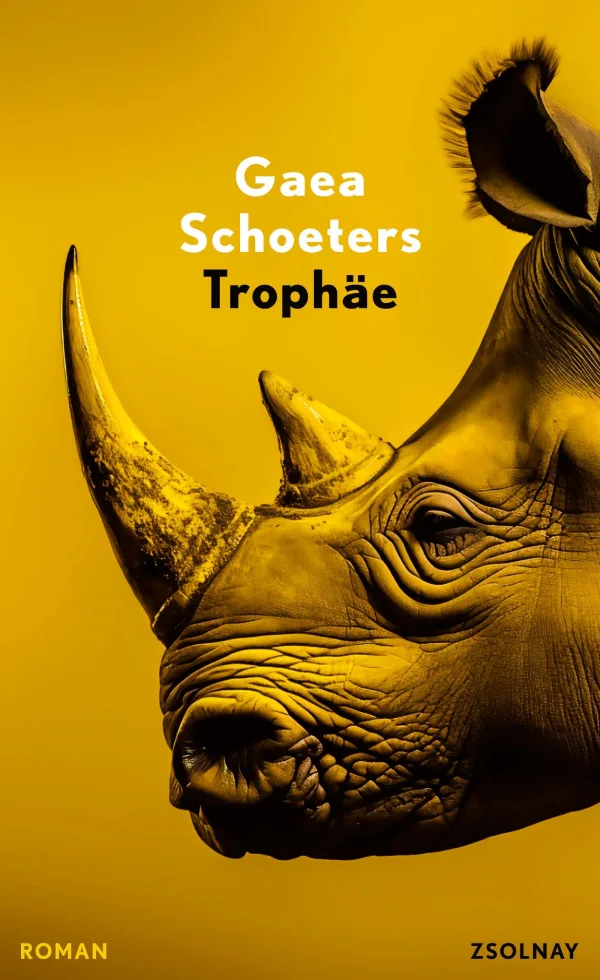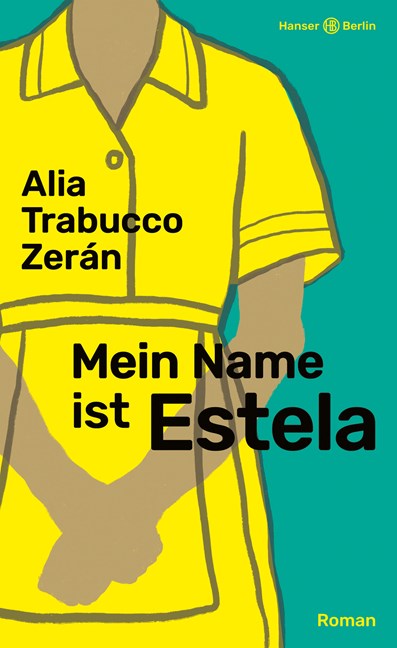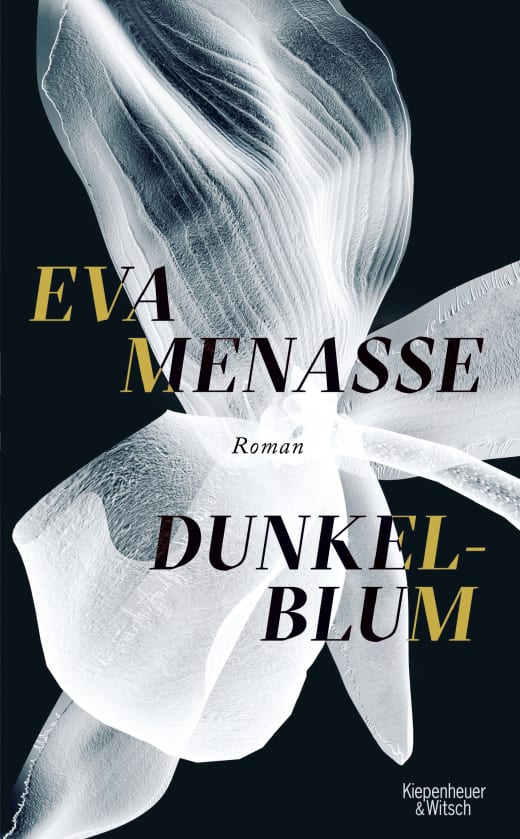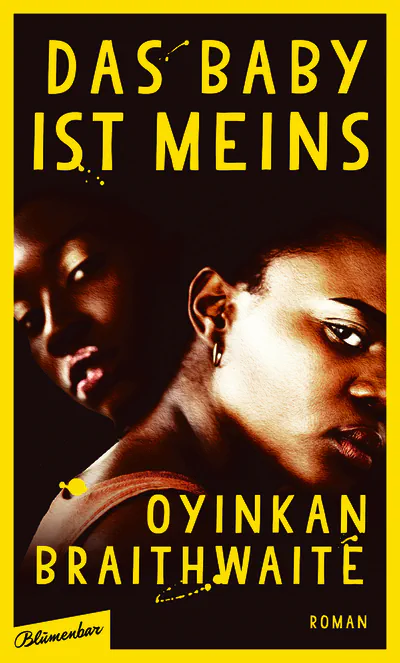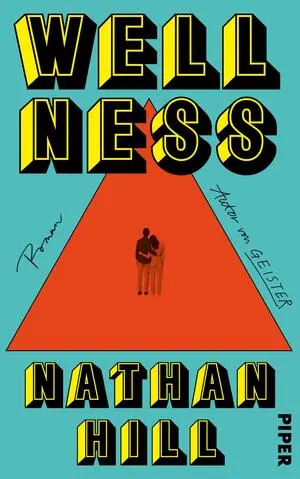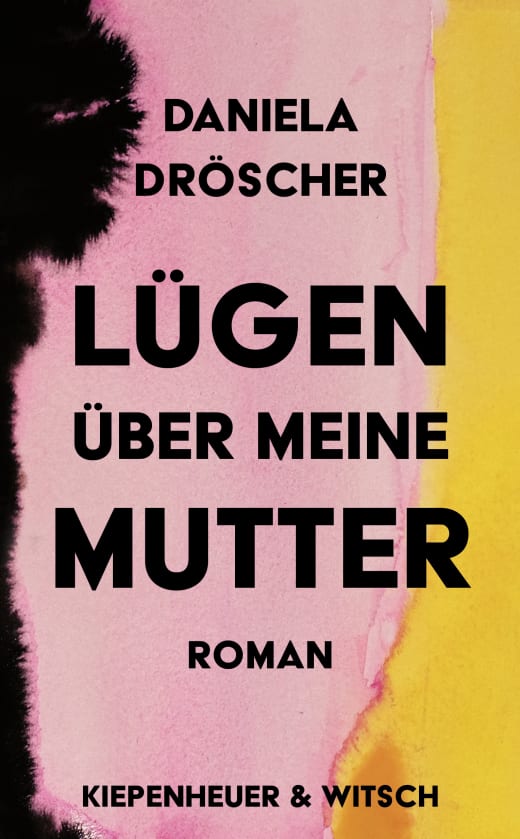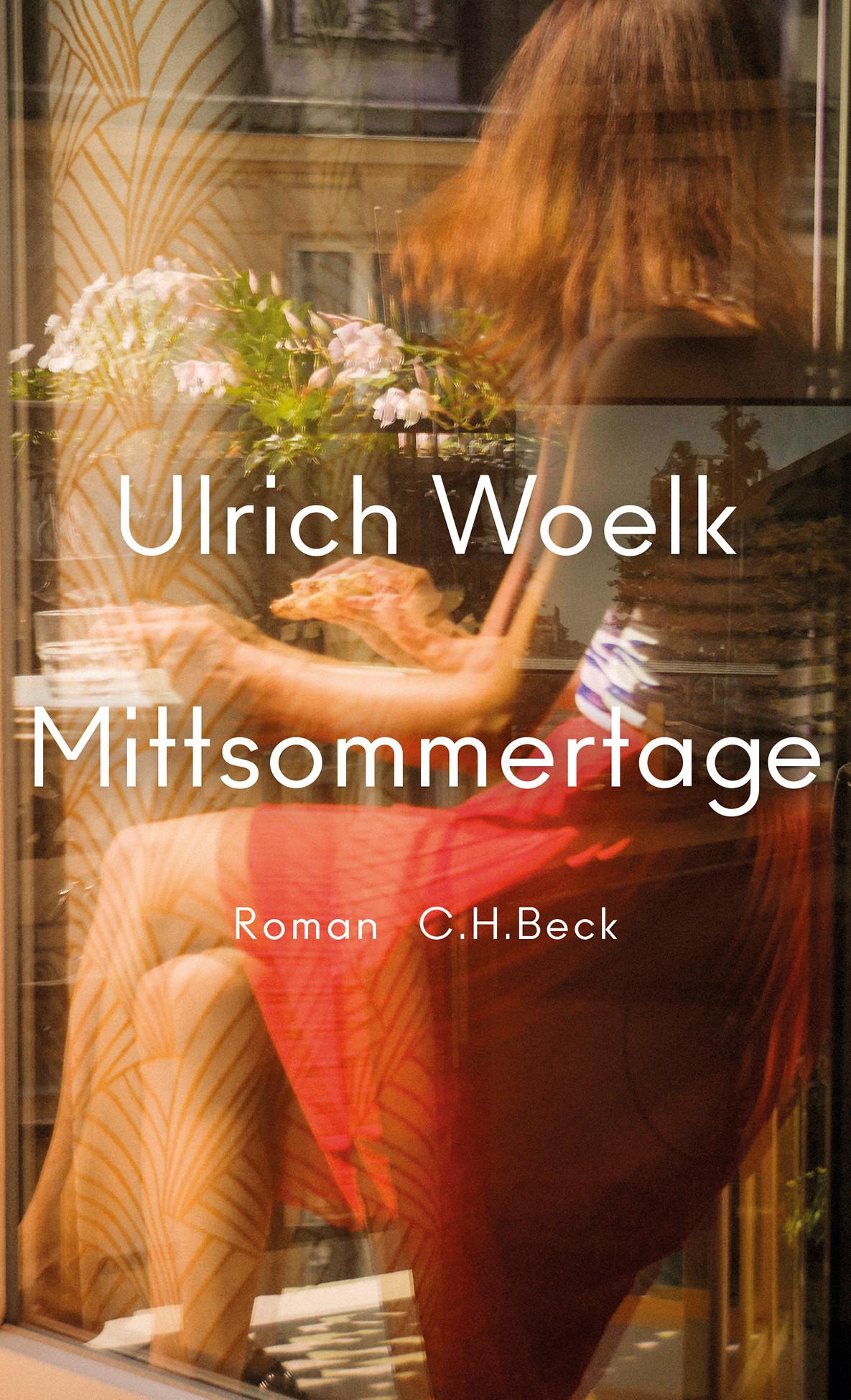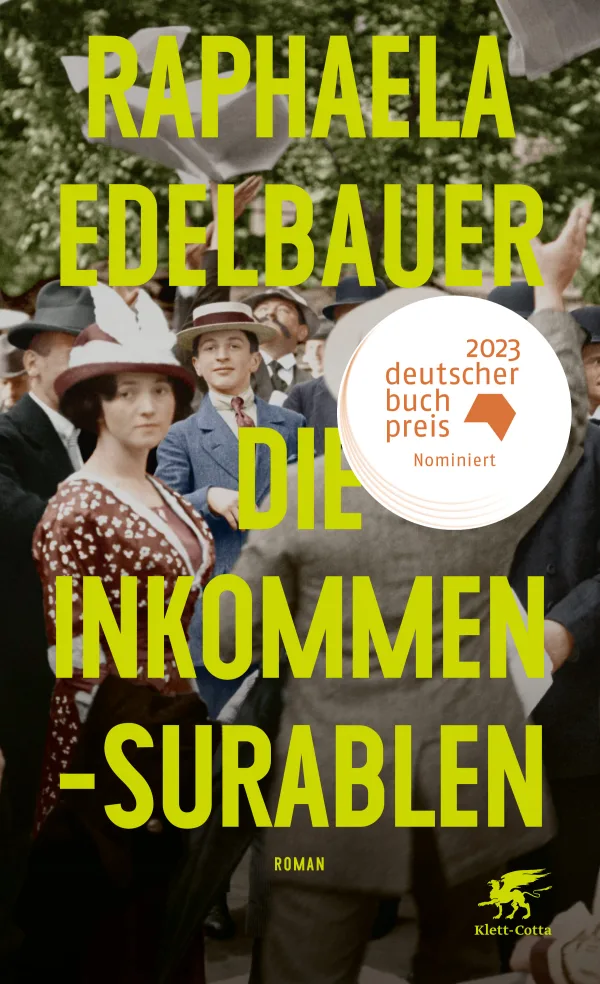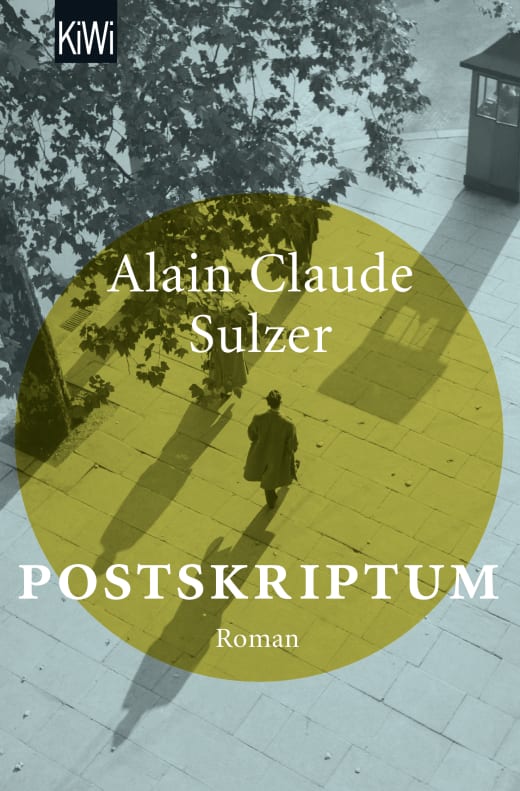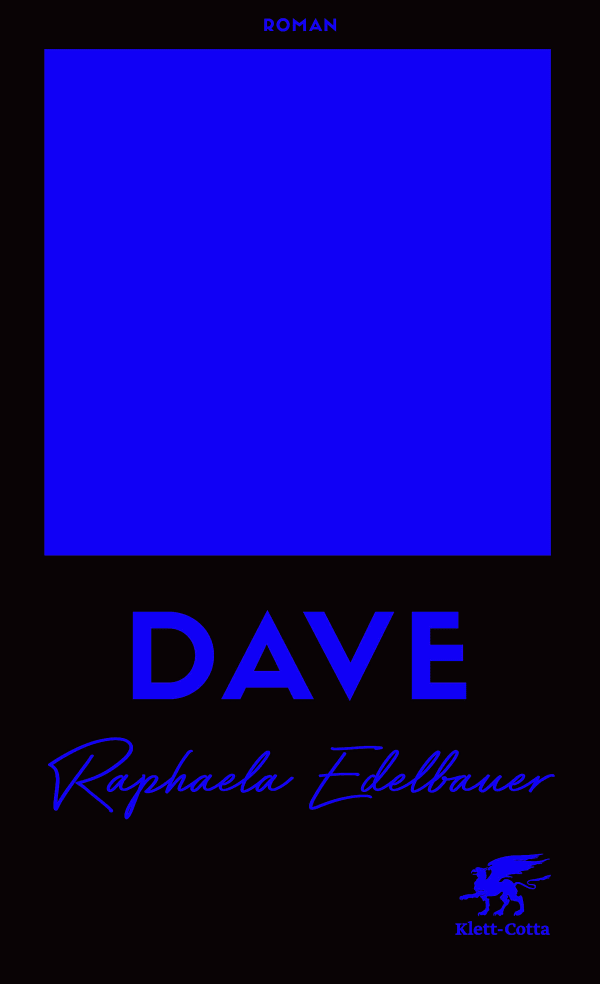Trophäe ist eine von der ersten bis zur letzten Seite so irritierende wie fesselnde Erzählung über Afrika, über die Natur, über Gerechtigkeit — und über das Sich-Entziehen dieser historisch und kulturell vielfach aufgeladenen Begriffe. In intertextueller Auseinandersetzung mit Ernest Hemingway und Joseph Conrad greift die niederländische Autorin Gaea Schoeters auch auf ein koloniales Genre zurück, der „colonial hunting literature“, in der sich männliche Abenteuergeschichten und anthropologische Erkundungen kreuzten, und erzählt von einer Jagd in Afrika, um sowohl dem Mythos Afrika als auch dem Mythos Männlichkeit und ihrer Verwobenheit mit Macht und Trieb und so manchen westlichen Moralvorstellungen auf den Grund zu gehen.
Der Jäger in dieser Geschichte ist ein Amerikaner, wie Hemingway, und erinnert in seinen ethischen Grundsätzen, mit denen er die Natur und die Jagd betrachtet, nicht wenig an den berühmten Schriftsteller, der selbst ein leidenschaftlicher Jäger war. Gaea Schoeters Jäger nennt sich auch „Hunter“, was den gleichnishaft-philosophischen Charakter der Erzählung noch unterstreicht. Er wurde schon als Kind von seinem Vater und Großvater ans Jagen herangeführt. Nun, als reicher Steuerberater und Investor mit einem Hang zur Bewahrung der letzten Reste von der Zivilisation noch nicht berührter Natur, geht er seiner Leidenschaft zur Großwildjagd in den scheinbar exotischen, aber vom Westen und der Moderne alles andere als unbeeinflussten Gefilden Afrikas nach. Er ist ein so genannter Trophäenjäger, von seinen „Big Five“ fehlt ihm nur noch ein Nashorn, das ihm nun zur Jagd angeboten wird. Doch diese Jagd nimmt ein unerwünschtes und vorzeitiges Ende, da Hunter Wilderer zuvorkommen, die das Nashorn bei ihrem Beutezug auf das Horn lebensgefährlich verwunden. Der enttäuschte Hunter bekommt jedoch ein ebenso verführerisches wie schockierendes alternatives Angebot, das man auch als Leser anfangs kaum zu begreifen wagt. Denn anstatt des Nashorns wird Hunter in Aussicht gestellt, einen jungen Afrikaner zu jagen, einen der Buschmänner, der von seiner Gruppe dafür ausgewählt und rituell vorbereitet werden soll. Das Geld, das Hunter für diese Jagd bezahlen wird, soll dem in ihrem Lebensraum arg bedrängten Naturvolk zugute kommen. Die Autorin spinnt mit dieser Menschenjagd einen in der konsequenten Fortführung bestehender „Handelsbeziehungen“ gar nicht so abwegigen Gedanken weiter und entlarvt damit die Grausamkeit, die der Natur und ihren tierischen und menschlichen Bewohnern in Afrika längst angetan wird, sowie das zerbrechliche moralische Gerüst, auf dem unser westliches Verhältnis zu dieser Region — und mehr noch: zur uns alle umfassenden Natur — gebaut ist. Mit der Trophäenjagd werden heutzutage tatsächlich Naturschutzprogramme und Bildungseinrichtungen für Ureinwohner finanziert. Und auch wenn der Kolonialismus Geschichte ist, sind seine Nachwirkungen für Natur und Menschen, ob in Gestalt fortbestehender Machtstrukturen oder der das soziale und biologische Gleichgewicht gefährdenden Ausbeutung natürlicher Ressourcen, weiterhin vorhanden.
Hunter selbst, der Protagonist der Erzählung, entscheidet sich nach einigen moralischen Skrupeln für das Angebot, das ihm fair und zudem bestechend „authentisch“ erscheint. Die Vorstellung einer solch „urtümlichen“ Jagd, bei der er sein Geschick und seinen Mut unter Beweis stellen und in jungfräuliche Gefilde vordringen kann, beginnt ihn immer mehr zu faszinieren. Im Text scheint immer wieder die Erotisierung der Jagd und der mit ihr einhergehenden Macht auf. Für Hunter scheint der einzig denkbare Naturbezug die Unterwerfung zu sein, auch wenn er im gleichen Atemzug überzeugt ist, auf der richtigen Seite zu stehen. Doch als er sich tatsächlich auf diese Menschenjagd einlässt, wird sein Glaubensgerüst nachhaltig erschüttert. Die moralische Rechtfertigung, mit der er sich als Jäger versteht, ja die Grundfesten seines Denkens und Fühlens, seines Weltbildes und all seiner Wertvorstellungen erweisen sich als unhaltbar. Er dringt mitten ins Herz der Finsternis vor, in der die Grenzen zwischen Jäger und Gejagtem, Mensch und Tier, gut und böse, Tod und Leben sich immer weiter aufzulösen drohen. Indem er, sich auf dieses Angebot einlassend, von seinem „gezähmten Denken“ in einem entscheidenden Punkt abgewichen ist, hat er, ohne sich dessen deutlicher als durch ein zunehmendes Gefühl der Bedrohung seines Ichs bewusst zu werden, die Schwelle zum „wilden Denken“ überschritten, in dem der Einzelne mit der Gruppe zu verschmelzen, sich in ihr aufzulösen beginnt. Er nimmt, ohne es ganz zu begreifen, an einem Opferritual teil, bei dem fundamental andere Regeln gelten. Das Opfer wird zugleich ausgestoßen und auserwählt, es verwandelt sich im Tod und wird heilbringend für die Gemeinschaft. Hunter ist deutlich überfordert von der von ihm erwarteten Rolle, im Grunde wird diese Jagd zu seiner eigenen Initiation in eine Welt, die fern von dem modernen Amerika ist, in dem er aufgewachsen ist.
Es ist beeindruckend, wie die Autorin auch sprachlich diese Grenzregionen für den Leser spürbar macht. Mit der Schilderung der rituellen Tänze, die diese besondere Jagd vorbereiten, beginnt für Hunter — und den Leser — der Eintritt in eine andere Erfahrungswelt, in der andere Spielregeln gelten, in eine andere Art der Wahrnehmung, die zunehmend etwas Alptraumhaftes bekommt. Je mehr die Jagd fortschreitet, desto mehr werden Hunters Gewissheiten erschüttert, desto mehr beginnt der Zweifel und das Misstrauen von ihm Besitz zu ergreifen, und schließlich gerät er in ein Delirium, in dem Kindheitserinnerungen, Rituale, Todesangst und Todessehnsucht miteinander verschmelzen. Trophäe ist ein so rasant und eindringlich erzähltes wie nachdenklich machendes Buch, in dem erzählerische Unmittelbarkeit und Einfühlung auf erweckende, aber niemals moralisierende Weise mit einer hellsichtigen Infragestellung vieler unserer Gewissheiten und Überzeugungen einhergehen, ein Buch, das uns dazu anhält, unser Verhältnis zu Afrika, zur Natur, zu unseren Gerechtigkeitsvorstellungen zu überdenken.
Bibliographische Angaben
Gaea Schoeters: Trophäe, Zsolnay 2024
Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing
ISBN: 9783552073883
Bildquelle
Gaea Schoeters, Trophäe
© 2024 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München