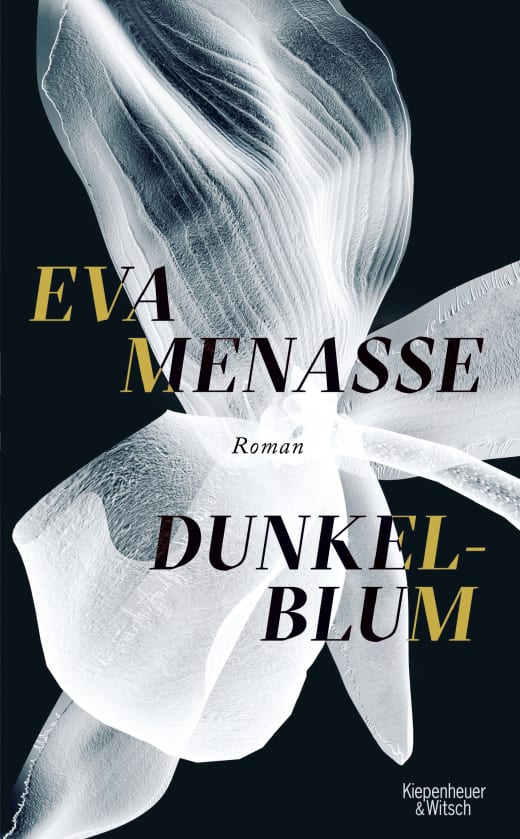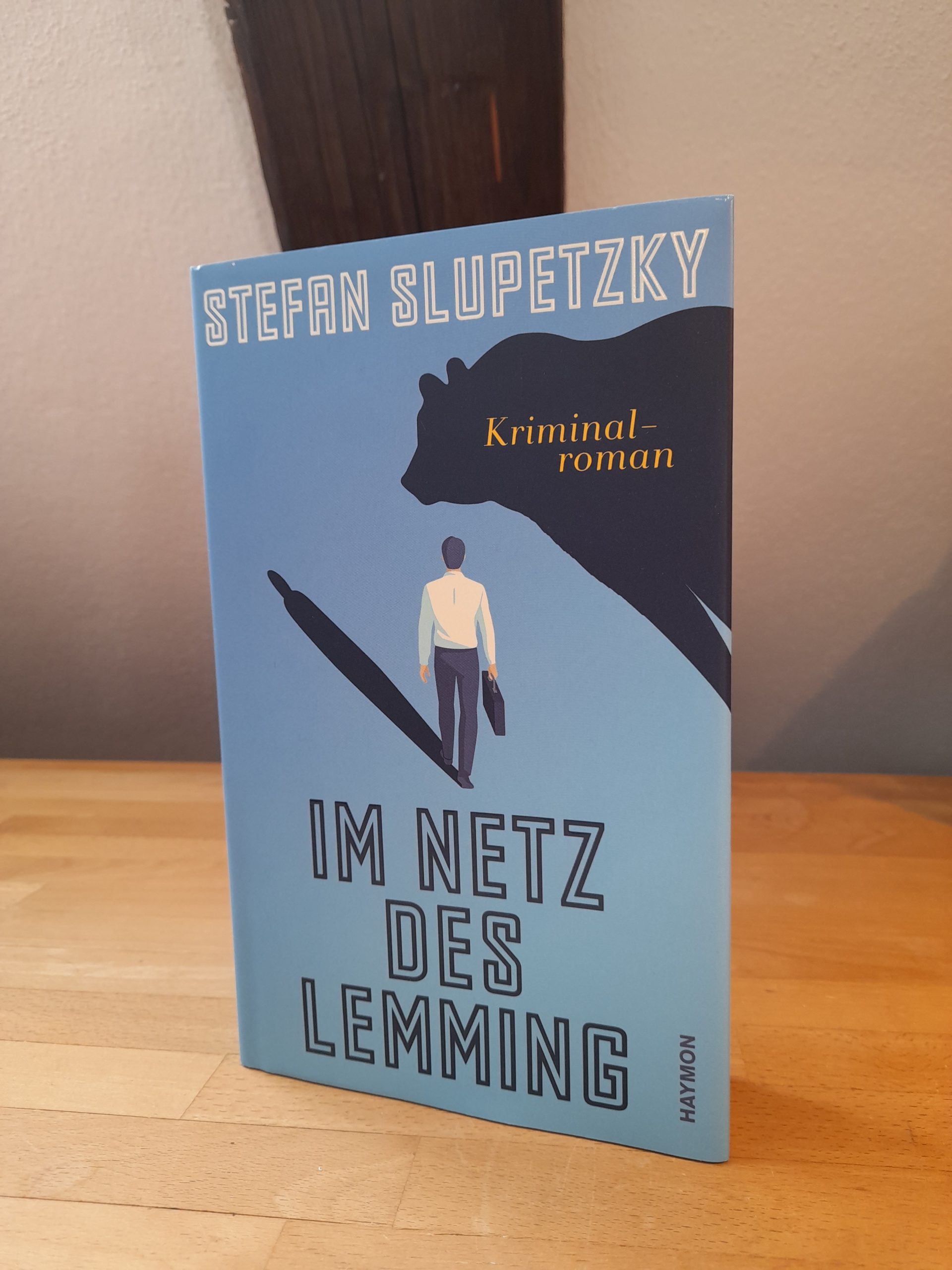Mit ihrem grotesk-pointierten Stil und den (aber)witzigen Dialogen, die den Roman Das flüssige Land zu einer überaus sinnlichen und sehr intelligenten Lektüre machen, hat mich die junge Wiener Autorin Raphaela Edelbauer sofort für sich eingenommen. Und das Beste: Sie hält diesen stets zwischen bissig, resigniert und belustigt changierenden Ton, der ihrer durchaus im Düsteren grabenden Geschichte einen äußerst erfrischenden Charakter gibt, das ganze Buch über durch! Man amüsiert sich königlich und ist im gleichen Moment zutiefst entsetzt über das, was in dem kleinen, von den offiziellen österreichischen Landkarten getilgten Örtchen mit dem stolzen Namen Groß-Einland in der Vergangenheit alles so vor sich gegangen ist — und munter weiter vor sich geht.
Zu Beginn der Geschichte, die aus der Perspektive von Ruth Schwarz, einer jungen, in Wien lebenden Physikerin erzählt wird, ist Groß-Einland jedoch noch weit entfernt, nichts weiter als eine schwer greifbare Erinnerung aus zweiter Hand, vererbt in Form loser Anekdoten von den Eltern, die schon vor Ruths Geburt in die Großstadt weggezogen waren. Ruth, deren Habilitation sich wegen wiederkehrender Schreibblockaden in die Länge zieht, wird durch den überraschenden Unfalltod ihrer Eltern aus ihrem mit Medikamenten bekämpften depressiven Zustand herausgerissen und trifft kurzerhand den Entschluss, ins sagenumwobene Groß-Einland aufzubrechen, wo ihre Eltern geboren und aufgewachsen sind und ihrer Ansicht nach nun auch bestattet werden sollen.
Die Autofahrt nach Groß-Einland ist bereits eine kleine Odyssee, ist der Ort doch auf keiner aktuellen Karte unter diesem Namen verzeichnet, und so landet sie schließlich mehr durch Zufall an ihrem Zielort, der sich in mehrfacher Hinsicht als äußerst bizarr entpuppt…
Was mich hingegen gefangen nahm, war etwas anderes: Dass neben all diesen Geschäften, neben diesem scheinbar florierenden Einzelhandel, in einer kaum sichtbaren Straßeneinfahrt der Asphalt fehlte. Zu dieser Stelle, die sich unsichtbar im Schwarz verlor, führte der Gehsteig hinab, als hätte ein riesenhafter Mund aus dem Untergrund an der Befestigung der ganzen Straße gesaugt.
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
Das auf den ersten Blick hübsch rausgeputzte Städtchen weist so einige nur auf den ersten Blick gut getarnte Abgründe auf. Doch Ruth lässt sich durch den auf sehr bedenkliche Weise baufälligen Zustand des Ortes nicht verunsichern, ebenso wenig durch das merkwürdige Verhalten der Dorfbewohner, die anfangs abweisende, sie dann aber recht bald in ihren Kreis aufnehmende verschworene Stammkneipenkundschaft, die seltsamen Gerüchte und alten Mythen oder durch die undurchsichtige historische Vorgeschichte des Ortes, die ebenso porös zu sein scheint wie sein geologisches Fundament. Der Gipfel der Kuriosität ist aber die sich ihr nach ihrer Ankunft recht bald aufdrängende und sehr dominant auftretende Gräfin, die parallel bzw. in Konkurrenz zur bürgerlichen Gemeindestruktur auf prädemokratische, feudalistische Weise zu herrschen scheint; so hat sie, wie Ruth irgendwann begreift, nach und nach fast alle Grundstücke aufgekauft und ihre Bürger bzw. Untertanen durch Darlehen in ihre Abhängigkeit gebracht und veranstaltet nun exklusive Soiréen, auf denen sie Lokalpolitik in ihrem Sinne betreibt und mit der Zustimmung der versammelten Dorfbewohner ihre eigene Wahrheit kreiert, so dass ihren Worten ebenso wie ihrem Adelstitel nicht so recht zu trauen ist:
„Sehen Sie, in dieser Gemeinde gibt es, ebenso wie in unserem Staat als Ganzem, zwei Körperschaften, die voneinander getrennt agieren. Da ist die alte Ordnung, wie wir sie hier praktizieren, und dann die neue, die an einem gewissen Stichpunkt einfach über die erste gebreitet wurde, ohne auf die gewachsenen, organischen Strukturen Rücksicht zu nehmen. Diese beiden schmirgeln nun aneinander, was eine ganze Reihe an Problemen erzeugt.“
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
Dauerhaft auf der Tagesordnung der Gräfin befinden sich die vielen Maßnahmen, die quasi permanent unternommen werden müssen, um von der baulichen Hinfälligkeit des Ortes abzulenken; immer wieder muss repariert und saniert werden, um die unaufhaltsam unterirdisch sich ausbreitenden Risse zu kitten und den Abgrund, auf dem der ganze Ort zu schweben scheint, zu vertuschen und überhaupt den Bewohnern ein Weiterleben in ihrem äußerst fragilen Dorf zu ermöglichen.
Aufgrund dieses ganz klar metaphorisch eingesetzten Bildes, das die ganze Erzählung strukturiert, wurde der Roman bereits als Parabel bezeichnet; ich würde vielleicht eher von einer Allegorie im Sinne einer fortgesetzten Metapher sprechen, die das von Stollen unterhöhlte, immer weiter absackende Dorf und die oberflächlichen, fast schon absurden Versuche, die Löcher zu stopfen, um zumindest die Fassade des Ortes aufrechtzuerhalten, in Zusammenhang mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs setzt. Die Verschönerungs- und Beruhigungsmaßnahmen, die unter der Leitung der Gräfin im Dorf angestrengt werden und eher oberflächlicher Natur sind als echte Tiefenarbeit, werden in diesem Sinne vergleichbar mit einem auf Verdrängung oder Vertuschung beruhenden Umgang mit den unaufgearbeiteten Stellen der geschichtlichen Vergangenheit. Hinzugefügt werden muss aber auch, dass die nationalsozialistische Vergangenheit im Text durchaus thematisiert wird, so dass ein geschickt gesponnenes Ineinander von Fiktionalem, Realhistorischem und Metaphorischem entsteht, weshalb ich auch den Begriff der Parabel für nicht ganz zutreffend halte.
Das alles [nämlich die Vorgeschichte der Schächte unter Groß-Einland bis hin zu ihrer Funktion im Dritten Reich als an ein KZ angebundene Produktionsstätte für Munition] war aufgearbeitet, eingerahmt und zu Infotafeln zusammengefasst in den Boden gestemmt worden — es gab eine Gedenkstätte, die dem Erinnern einen exakt bezirkelten Radius zuwies, in dessen Orbit man etwa zwei Dutzend Gladiolen pflanzen konnte. Das Loch hatte also eine klar umrissene Biographie, an die zu rühren sich niemand scheute, nur dass das gesamte poröse, wabenartige Land unter dieser Berührung zu zerfallen drohte.
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
Die Ich-Erzählerin wird von der Gräfin eigentlich gegen ihren Willen engagiert: Sie soll die Expertise, über die sie als Physikerin verfügt, für die Belange der Gräfin einsetzen, im Gegenzug wird ihr genug Zeit eingeräumt, um ihre Habilitation zu Ende zu schreiben, sowie ein eigenes Häuschen übereignet — das sich als das frühere Haus ihrer Großeltern und Eltern erweist –, so dass sich Ruth nun endgültig in Groß-Einland niederlässt. Mit durchaus ambivalenten Gefühlen: Einerseits genießt sie das Dorfleben, in das sie sich mehr und mehr eingebunden fühlt, den beständigen Rhythmus, eine gewisse Bequemlichkeit, die mit ihrem neuen Leben einhergeht, doch andererseits ist sie auch immer wieder irritiert über die vielen Ungereimtheiten, auf die sie stößt und die ihren von Skepsis und Neugier genährten Forschergeist wecken.
Es gab hundertfache winzige Unstimmigkeiten. (…) Es waren kleine Verschiebungen, doch je tiefer man bohrte, desto flüssiger wurde das, woran man sich noch festhalten konnte.
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
Während Ruth mit der höchst wichtigen Aufgabe betraut wird, eine Formel für ein Füllmittel zu finden, mit dem der durchlöcherte Untergrund ein für alle Mal zugeschüttet werden soll, stellt sie heimlich ihre eigenen Nachforschungen an, um die schwarzen Löcher in der Geschichte des Ortes ans Tageslicht zu bringen.
Über meinem Schreibtisch hing eine Tafel, die drei Schlagworte auflistete, an denen sich meine Arbeit zu orientieren hatte: Schönung, Streckung, Auffüllung.
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
Bei der inoffiziellen Aufdeckungsarbeit, die Ruth parallel zu ihrer offiziellen Auffüllungsarbeit betreibt, stößt sie immer wieder auf seltsame Leerstellen, Inkongruenzen und Hindernisse. Das gilt sowohl für das Rätsel ihrer Eltern, deren Unfalltod sie mehr und mehr in Zweifel zieht, als auch für die kollektive Vergangenheit der Groß-Einländer, in deren Chroniken angesichts des spurlosen Verschwindens von etwa 750 Zwangsarbeitern eine auffällige Leerstelle klafft.
Das große Ziel der Gräfin und ihrer Experten, Groß-Einland mit Ruths Füllmittel zu konservieren, wird von langer Hand geplant und soll schließlich in einem Festakt gebührend zelebriert werden. Für die langwierige Vorbereitung dieser pompösen Veranstaltung, die mit vielerlei absurden Attraktionen auch ein großes Publikum von außerhalb anziehen und der Zuschüttung der Löcher mit dem von Ruth nur widerstrebend entwickelten — sich in seiner physikalischen Zusammensetzung nämlich als biologisch verheerend für Flora und Fauna erweisenden — Füllmaterial einen denkwürdigen, sensationellen Rahmen geben soll, verwendet die Erzählerin den Begriff der „Parallelaktion“. Die Reminiszenz an Musils ähnlich sich ins Absurde versteigende kakanische Parallelaktion, die aufgrund des Ersten Weltkriegs ins Wasser fällt, ist sicher kein Zufall.
Ich dachte bei der Arbeit an dieser Parallelaktion stets, die anderen müssten ihre Lächerlichkeit ebenso bemerken wie ich und würden mich verlachen dafür, an welchen Hirngespinsten ich mitwirkte. Zu meiner Überraschung tat das aber niemand.
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
Edelbauers entlarvender und humoristischer Tonfall klingt tatsächlich ein wenig ähnlich wie der des großen Schriftstellers, der im Mann ohne Eigenschaften den Untergang des alten Habsburgerreiches thematisierte, und auch mit der Verflechtung von Wissenschaft und fiktiver Handlung — die Protagonistin erforscht für ihre Habilitation die physikalisch-philosophische Dimension der Zeit — greift sie eine charakteristische Vorgehensweise Musils auf. Ruths Zeitgefühl gerät in Groß-Einland, diesem österreichischen Nicht-Ort, der alle Symptome eines schwarzen Lochs aufzuweisen scheint, ziemlich durcheinander. Obwohl sie ursprünglich nur einen kurzen Aufenthalt geplant hatte, um die Beerdigung ihrer Eltern vor Ort zu organisieren, bleibt sie letztlich sechs Jahre dort hängen, während die Beerdigung ohne ihr Wissen und ihre Beteiligung längst in Wien stattgefunden hat.
So erfährt Ruth am eigenen Leib — und wir Leser vermittelt über ihre Eindrücke und Reflexionen –, welches Ausmaß der Erfindungsreichtum der Menschen annehmen kann, wenn es darum geht, an angenehmen Überlieferungen oder Erklärungen festzuhalten, auch wenn diese sich nachweislich als falsch herausstellen. In immer wieder zum Lachen anregenden, natürlich überspitzten Bildern werden auch der Drang zu Anpassung, Euphemismus und Opportunismus, sowie hartnäckige Strategien des Verdrängens und Verschweigens entlarvt.
Wenn vom einen Tag auf den anderen ein Gehsteig fehlte (…), fand man am nächsten Tag ein dazu parallel laufendes Seil an zwei Laternenmasten geknüpft, das alle auf ihren täglichen Wegen ergriffen, als wäre es vollkommen normal, ein Leben zu führen wie im Basiscamp des Mount Everest.
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
So wie das monumentale Projekt der Parallelaktion nichts weiter als groteske Dimensionen annehmende Makulatur ist, scheint es ein menschliches Wesensmerkmal zu sein, mit großem Aufwand und Inkaufnahme fataler Risiken Probleme aufzuschieben. Man könnte hier etwa auch ganz aktuell an den Klimawandel denken, wenn man sich folgendes Zitat durch den Kopf gehen lässt:
Was sie alle gemeinsam hatten, war das: Sie weigerten sich zu begreifen, dass wir es mit einem organischen, wenngleich durch den ehemaligen Bergbau beschleunigten, Naturgeschehen zu tun hatten.
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
Ein absolut überzeugender und in all seiner Desillusionierung erfrischend humorvoll erzählter Roman mit einer irgendwie ungemein sympathischen, wenn auch ziemlich verplanten Anti-Heldin, deren Entdeckungen, Erkenntnisse und Rückschläge man sich mit großem Gewinn erzählen lässt!
Bibliographische Angaben
Raphaela Edelbauer: Das flüssige Land, Klett-Cotta (2019)
ISBN: 9783608964363
Bildquelle
Raphaela Edelbauer, Das flüssige Land
© 2019 Klett-Cotta Verlag, Stuttgart