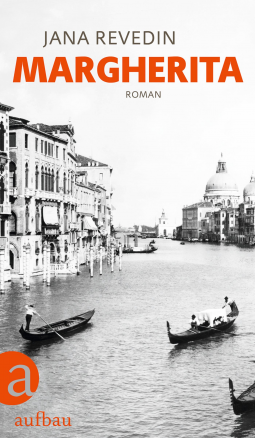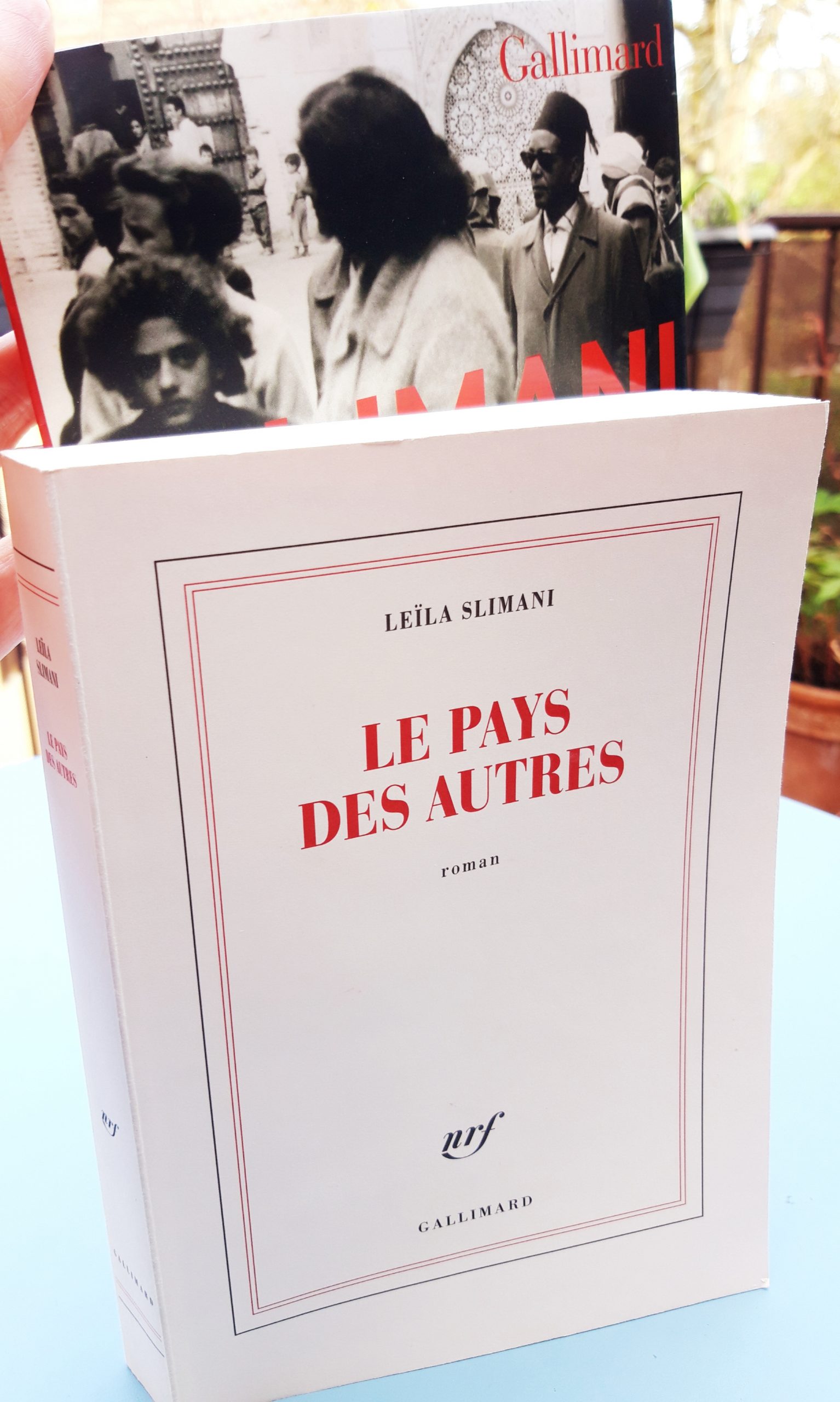Im ersten Teil ihrer auf drei Bände angelegten marokkanischen Familiensaga zeigt Leïla Slimani eindrucksvoll, was für eine großartige Erzählerin sie ist. Ich habe das Buch kaum auf die Seite legen wollen, so mitreißend und einfühlsam entfaltet die Autorin die Auswirkungen der großen, von geschichtlichen Tumulten erschütterten Welt auf die kleine marokkanisch-französische Familie, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem kargen Land bei Meknès niederlässt. Wer Slimanis mit dem Goncourt 2016 ausgezeichneten Roman Chancon douce (dt. „Dann schlaf auch du“) gelesen hat und von dieser zutiefst schockierenden und zugleich behutsam erzählten Geschichte begeistert war, wird zunächst vielleicht überrascht sein. Denn mit ihrem neuen Roman betritt sie ein Terrain, das von der Tragödie, die sich zwischen einer modernen Pariser Familie und ihrem in prekären Verhältnissen lebenden, vereinsamten Kindermädchen abspielt, Welten entfernt zu sein scheint. Doch was man sofort wiedererkennt, ist die schlicht-poetisch schöne, sofort vereinnahmende Sprache, mit der Slimani ihre Leser ab der ersten Seite in ihre Geschichte hineinzuziehen versteht.
Le pays des autres (dt.: „Im Land der anderen“), der nun auf Französisch erschienene erste Teil der Trilogie, umfasst den Zeitraum von 1944 bis 1956 und ist zum Teil autobiographisch inspiriert; Slimanis aus dem Elsässer Bürgertum stammende Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg einen algerischen Soldaten der französischen Kolonialarmee kennenlernte und mit ihm nach Marokko ging, war wohl das Vorbild für die Elsässerin Mathilde, die im Roman den Marokkaner Amine heiratet, mit ihm in seine Heimat zieht und dort ihre beiden gemeinsamen Kinder Aïcha und Selim aufzieht.
Mathilde und Amine sind ein zunächst leidenschaftlich verliebtes und optisch schönes, wenn auch sehr ungleiches Paar: Sie ist groß und blond, er ist dunkel und attraktiv und um einiges kleiner als sie. Sie verlässt ihre kriegsversehrte Heimat Frankreich, um mit ihrer großen Liebe im exotischen Marokko eine eigene Familie zu gründen, er kehrt nach dem Kriegseinsatz in Frankreich mit einer französischen Frau an seiner Seite zu seinen Wurzeln zurück und möchte das Land, das sein verstorbener Vater ihm als ältestem Sohn hinterlassen hat, modern bewirtschaften und zum Blühen bringen. Doch so wie Mathilde bald bewusst wird, dass ihre romantischen Erwartungen in der marokkanischen Realität enttäuscht werden und sie mit ihrem modernen Verständnis der Rolle der Frau und auch in ihrer ambivalenten Rolle als Französin und Frau eines Marokkaners zu kämpfen hat — bei den Gattinnen der französischen Kolonialbeamten fühlt sie sich nicht minder als Außenseiterin als unter ihren einheimischen Nachbarn und der marokkanischen Familie ihres Mannes –, wachsen auch Amine die Herausforderungen, die nicht nur landwirtschaftlicher, sondern auch kultureller und gesellschaftlicher Natur sind, zunehmend über den Kopf und bedrohen den inneren Frieden seiner Familie.
Rund um Mathildes und Amines kleine Familie entwirft die Autorin einen vielfältigen, aber stets überschaubaren Figurenkosmos, der auf sehr literarische Weise, nämlich über die narrative und dialogische Schilderung von Szenen, die Einblick in den Charakter und das von den äußeren Ereignissen geprägte Innenleben der Figuren geben, ein differenziertes Panorama der marokkanischen Gesellschaft der 1940er und 1950er Jahre vermittelt. Überhaupt zeigt sich in den vielen Szenen, in denen Slimani die Gedanken und Gefühle ihrer Figuren in großer Lebendigkeit und Poesie aufleben lässt, ihre Kunst, den Leser zum Mitfühlen zu bewegen, ohne sich deshalb mit dem oft ambivalenten Verhalten der Figuren kritiklos zu identifizieren. Ohne textliche Ausschweifung arbeitet sie das Wesentliche heraus, gibt den Figuren Raum und den Lesern die Möglichkeit, für einen Moment in ihre Empfindungen und ihre sehr unterschiedlichen Lebenswelten einzutauchen. Besonders nahe gehen einem dabei die Ängste, Sorgen und Hoffnungen von Mathildes und Amines Tochter Aïcha, etwa wenn sie voll furchtsamem Widerwillen das erste Mal die französische katholische Schule in der Stadt besucht, in der sie mit den auf sie zugleich fremd und faszinierend wirkenden Töchtern der Algerienfranzosen zusammenkommt, unter denen sie ein spöttisch belächelter Fremdkörper bleibt. Zwar macht sie in der Schule rasch Fortschritte und findet in einer der Schwestern eine ihr wohlwollende Beschützerin, doch ihre halbmarokkanische Herkunft, ihr auf die Mitschülerinnen rückständig wirkendes Zuhause auf dem Land weitab der kolonial geprägten Stadt und ihr introvertierter Charakter scheinen sie in ihrer Außenseiterposition festzunageln. Slimani zeichnet ein sehr sensibles Porträt des innerlich zerrissenen kleinen Mädchens, dessen mystisch veranlagte, sehnsüchtige, sehr intelligente Persönlichkeit auch eine grausame Seite aufweist, die aus dem Schmerz erwächst.
Immer wieder kreist die Geschichte um die konfliktreiche Frage der Zugehörigkeit und Herkunft, deren Ambivalenz sich am Beispiel einer halbfranzösischen-halbmarokkanischen Familie eindrücklich entfalten lässt. Es geht um Fragen von Herrschaft und Macht, um rassistische Arroganz, aber auch um Einsamkeit, Wut, Unverständnis, Verletzung und Verletzlichkeit. Der hybride Zitrusbaum, der „citrange“, eine Kreuzung aus Zitronen- und Orangenbaum, den Aïcha mit ihrem Vater pflanzt, nimmt in der Geschichte die Funktion einer Metapher ein. Die hybriden Früchte sollen ihrer Umwelt resistenter gegenüberstehen, doch haben sie auch einen fast ungenießbar bitteren Geschmack. In diesem Sinne ist auch Aïcha, die als Tochter einer Französin unter den marokkanischen Landarbeitern fernab des europäisch geprägten Stadtlebens aufwächst, aber zugleich Weihnachten unter einem aus dem Nachbargrundstück gestohlenen Nadelbaum feiert, eine solche Frucht, die ihre hybride Herkunft teils bitter zu spüren bekommt, ebenso wie ihre Eltern, die als „couple mixte“ von allen Seiten misstrauisch beäugt werden: Amine, der mit seiner blonden Frau und seiner Vergangenheit im Dienst der Kolonialarmee den Marokkanern zu französisch, seiner Frau hingegen zu stark den marokkanischen Traditionen verhaftet ist, und Mathilde, die immer wieder als Europäerin auffällt, wenn sie sich etwa sehr zum Unbehagen Amines dem traditionellen Teetrinken der Männer anschließt, wenn sie darauf besteht, dass ihre Schwägerin in die Schule geht oder ihr Hausmädchen von oben herab behandelt, und als Frau eines marokkanischen Bauern zugleich keinerlei Status bei der französischen Bevölkerung hat.
Le pays des autres ist somit auch ein (post)kolonialistischer Roman, der vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Konflikte zwischen den französischen Besatzern und den marokkanischen Unabhängigkeitskämpfern spielt. Die Autorin schildert, wie die politischen Unruhen und die zunehmende Gewalt Zwietracht und Schmerz auch innerhalb von Familien säen. Nach dem Tod des Vaters herrscht zwischen den Söhnen eine unterschwellige Konkurrenz, die Omar, den jüngeren Bruder Amines, in den bewaffneten Kampf treibt. Eifersüchtig auf die Auszeichnungen seines älteren Bruders im Zweiten Weltkrieg, entwickelt er einen umso größeren Hass auf die französischen Besatzer, für die sein Bruder einst gekämpft hat, überwirft sich mit Amine und verlässt sein Elternhaus, um sich den Unabhängigkeitskämpfern anzuschließen. Das Ineinander von persönlicher Biographie einerseits und dem mächtigen Einfluss der Geschichte andererseits, die bei Omars Rebellion zum Ausdruck kommt, tritt im Verlauf des Romans immer wieder zum Vorschein.
Vor dem Hintergrund der anderen Texte der Autorin ist es nicht überraschend, dass Kolonialismus und Sexualität hier eng miteinander verwoben werden und das Verhältnis von Männer- und Frauenrollen Machtstrukturen aufdeckt, die mit den kolonialen Herrschaftsbeziehungen verwandt sind. Isabela Figueiredo, deren literarisierte Erinnerungen an ihre Kindheit im portugiesischen Kolonialreich unter dem Titel Roter Staub vor kurzem ins Deutsche übersetzt wurden, schildert übrigens genau diesselbe Verflechtung der Unterwerfung der Frau und der kolonisierten Afrikaner in Bezug auf das portugiesische Kolonialsystem. Slimani selbst hat in ihrem Essay Sexe et mensonges (2017) die Situation der Frauen in Marokko untersucht und tritt für die Legalisierung der Abtreibung in dem Land ein, in dem sie geboren wurde. Dem Zusammenhang von weiblichem Begehren und Freiheit ging sie auch in ihrem Roman Dans le jardin de l’ogre (2014) nach. Wenn sie nun in Le pays des autres Beziehungen zwischen Männern und Frauen darstellt, wirkt das nie thesenhaft, sondern wird stets mit viel Gespür für die feinen Töne erzählt. Besonders unter die Haut geht die Geschichte von Selma, der bildhübschen jüngeren Schwester Amines, die sich in einen jungen Franzosen verliebt und erste Anstalten macht, sich aus dem für sie vorgesehenen gesellschaftlichen Rahmen zu lösen.
Selma, la veille, avait embrassé un garçon. Et depuis, elle ne cessait de se demander comment il était possible que les hommes qui l’empêchaient, qui la dominaient, soient aussi ceux pour qui elle avait tant envie d’être libre. (…) Depuis hier, sans cesse, elle avait besoin de fermer les yeux pour vivre encore, avec une excitation jamais tarie, ce moment délicieux. (…) Elle était comme prisonnière de ce souvenir (…). À chaque fois qu’il avait posé ses lèvres sur sa peau, il lui avait semblé qu’il la délivrait de la peur, de la lâcheté dans laquelle on l’avait élevée.
Était-ce à ça que servaient les hommes? Était-ce pour cela qu’on parlait tant d’amour? (…) Comme ils ont raison de se méfier et de nous mettre en garde car ce que nous cachons là, sous nos voiles et nos jupons, ce que nous dissimulons est plein d’un feu pour lequel nous pouvons tout trahir.
Selma hatte am Vortag einen Jungen geküsst. Und seitdem fragte sie sich unablässig, wie es möglich sein konnte, dass dieselben Männer, die ihr im Weg standen, die sie beherrschten, auch die waren, für die sie so große Lust verspürte, frei zu sein. (…) Seit gestern musste sie immerzu ihre Augen schließen, um wieder und wieder, mit einer nie versiegenden Erregung, diesen köstlichen Moment zu erleben. (…) Sie war wie gefangen von dieser Erinnerung (…). Jedesmal, wenn er mit seinen Lippen ihre Haut berührt hatte, war es ihr vorgekommen, als ob er sie von der Angst, von der Feigheit, in der sie erzogen worden war, befreite.
Waren die Männer dazu gut? War das der Grund, weshalb man so viel von Liebe sprach? (…) Wie Recht sie doch haben, dem zu misstrauen und uns davor zu warnen, denn was wir dort verbergen, unter unseren Schleiern und unseren Unterröcken, was wir dort verbergen, enthält ein Feuer, für das wir alles verraten können.
Slimani: Le pays des autres, S. 283 f. (Übersetzung der Rezensentin)
Doch in dem gewaltsamen gesellschaftlichen Kontext der 1950er Jahre ist der Konflikt vorgezeichnet. Als ein Fotograf von dem schönen jungen Paar ein Foto macht und es in seinem Laden ausstellt, fliegt die Liebesgeschichte ebenso auf wie die heimlichen Ausbrüche, die Selma während ihrer Schulzeit in die Freiheit der Stadt unternimmt. Amine, der ja selbst mit einer Französin verheiratet ist, entdeckt das Foto durch Zufall im Schaufenster, rastet aus und die erträumte Freiheit der jungen Frau endet in einer überstürzten Zwangsheirat.
Slimani gelingt es, das Auf und Ab der Sehnsüchte und Enttäuschungen in ihrer ganzen Ambivalenz in einer so gelungenen Balance aus mitreißender Unmittelbarkeit und reflektierender Distanz darzustellen, dass man nach der letzten Seite dieses ersten Bandes unbedingt nach einer Fortsetzung verlangt. Die ist auch geplant, jedoch erst für 2022 mit dem zweiten Teil, der die Zeit von 1970-1980 umfassen soll, in dem die Tochter Aïcha als junge Erwachsene im Zentrum steht, während Marokko von den Attentaten auf den König Hassan II. erschüttert wird, und für 2024 mit dem dritten Teil, in dem mit der Generation von Aïchas Kindern die globalisierte und vom islamistischen Terror geprägte Gegenwart erreicht wird. Wir brauchen also noch etwas Geduld, aber wenn die Autorin dem Stil des ersten Teils treu bleibt, wird sich das Warten auf jeden Fall lohnen!
Leïla Slimani: Le pays des autres, Gallimard (2020)
ISBN: 9782072887994