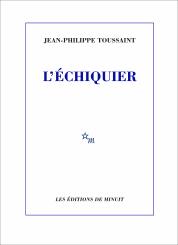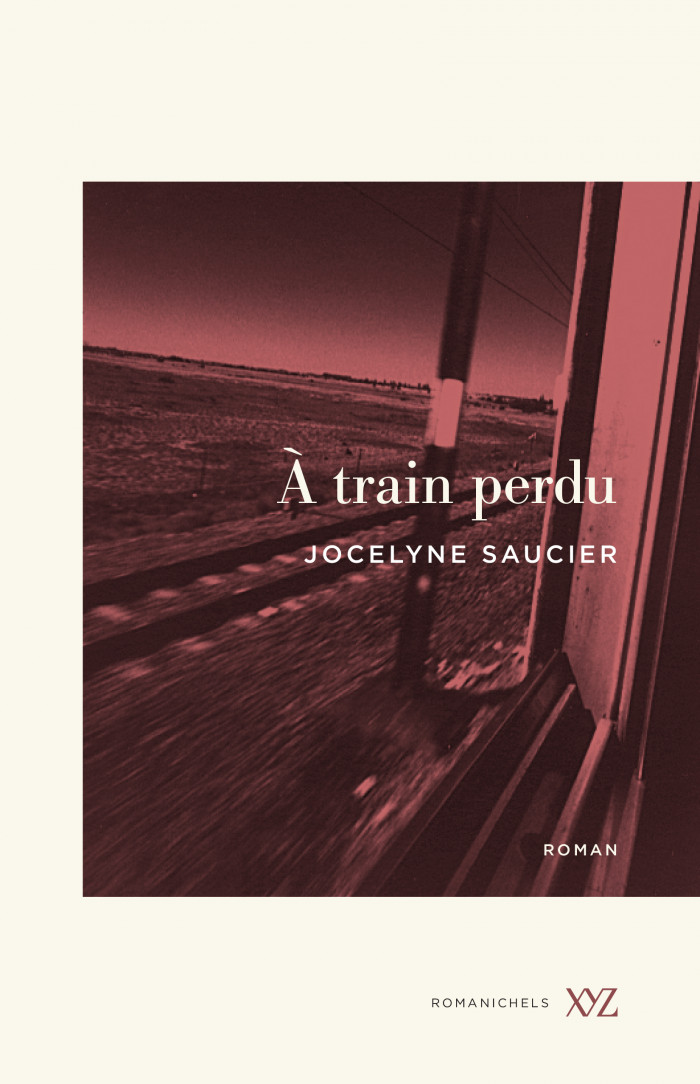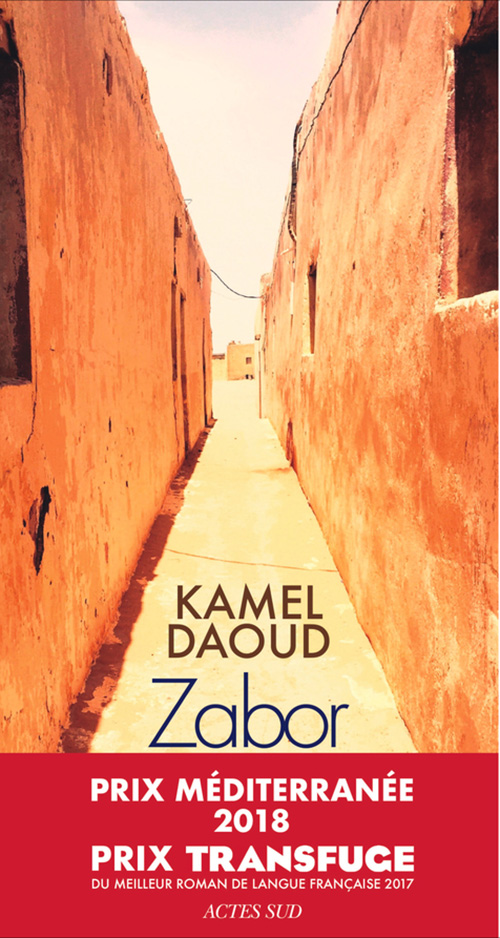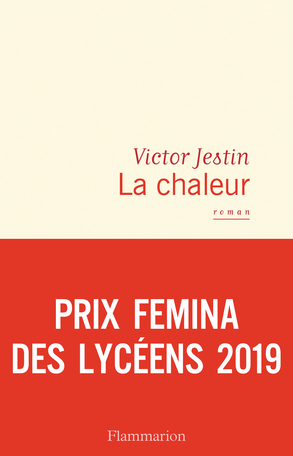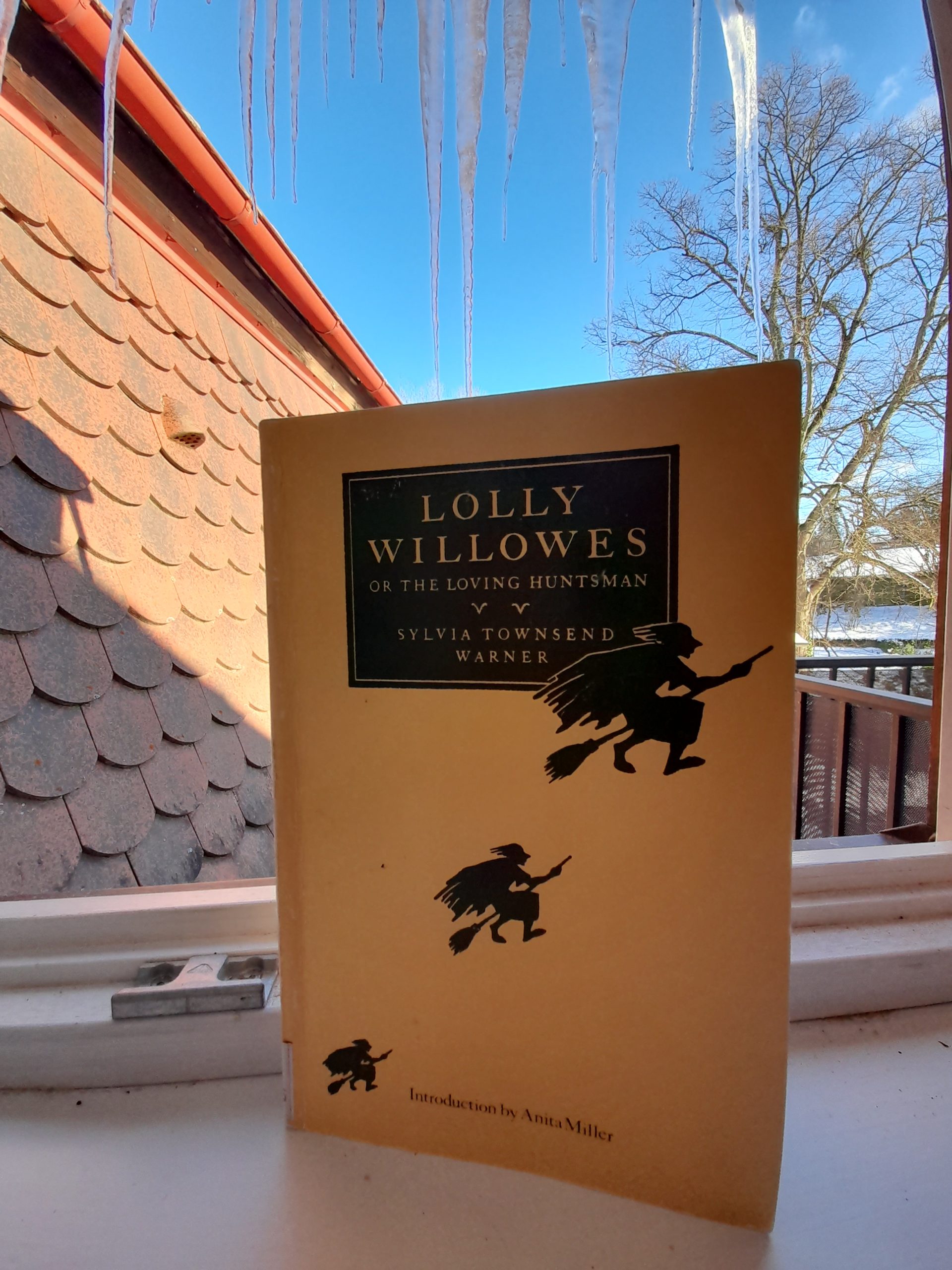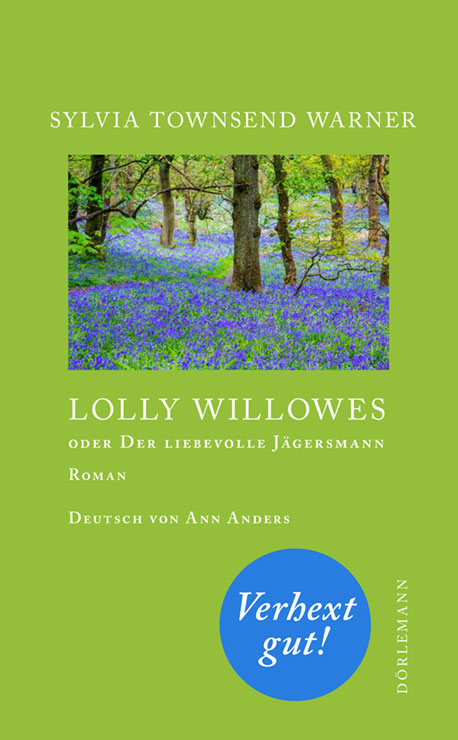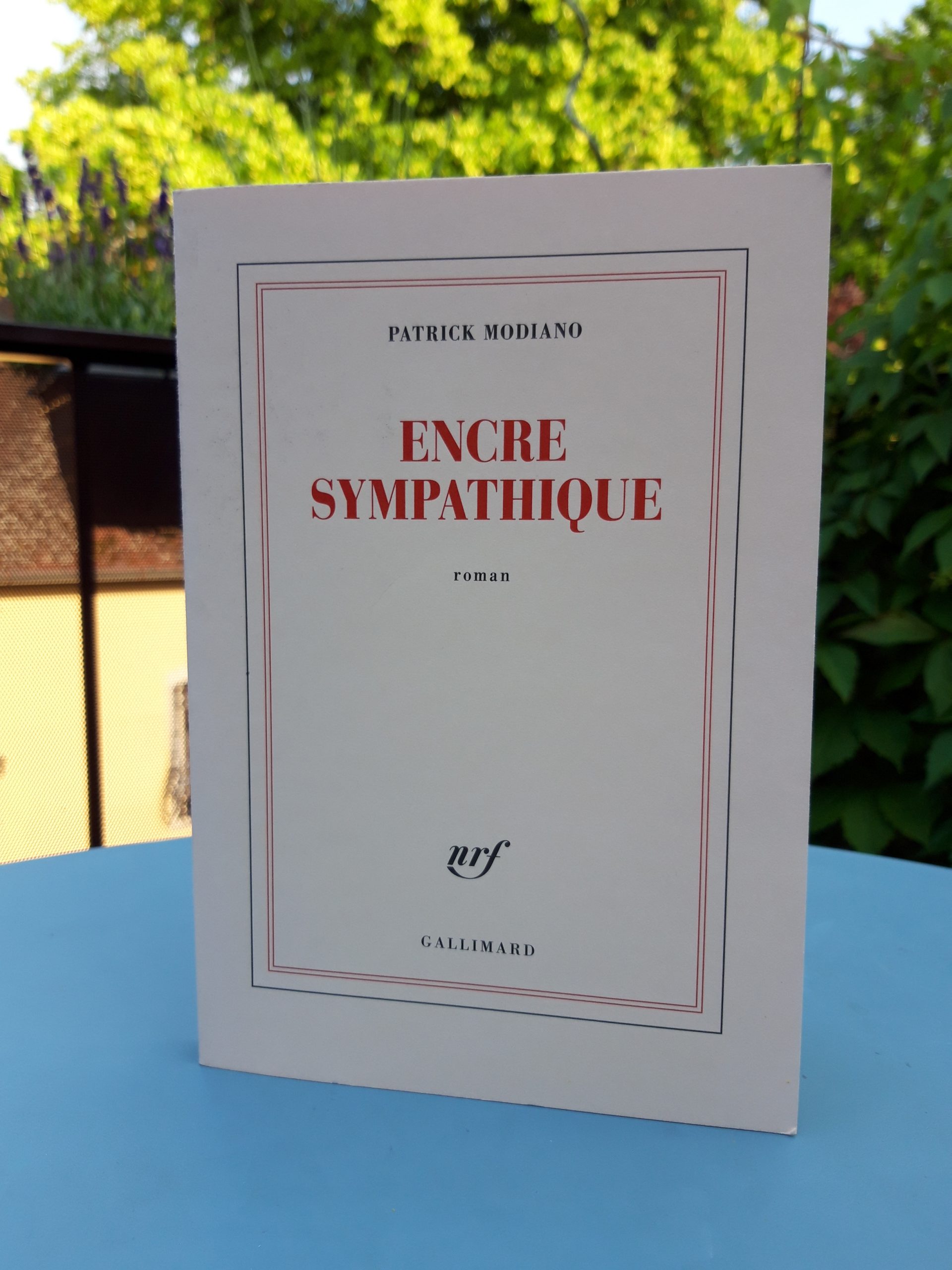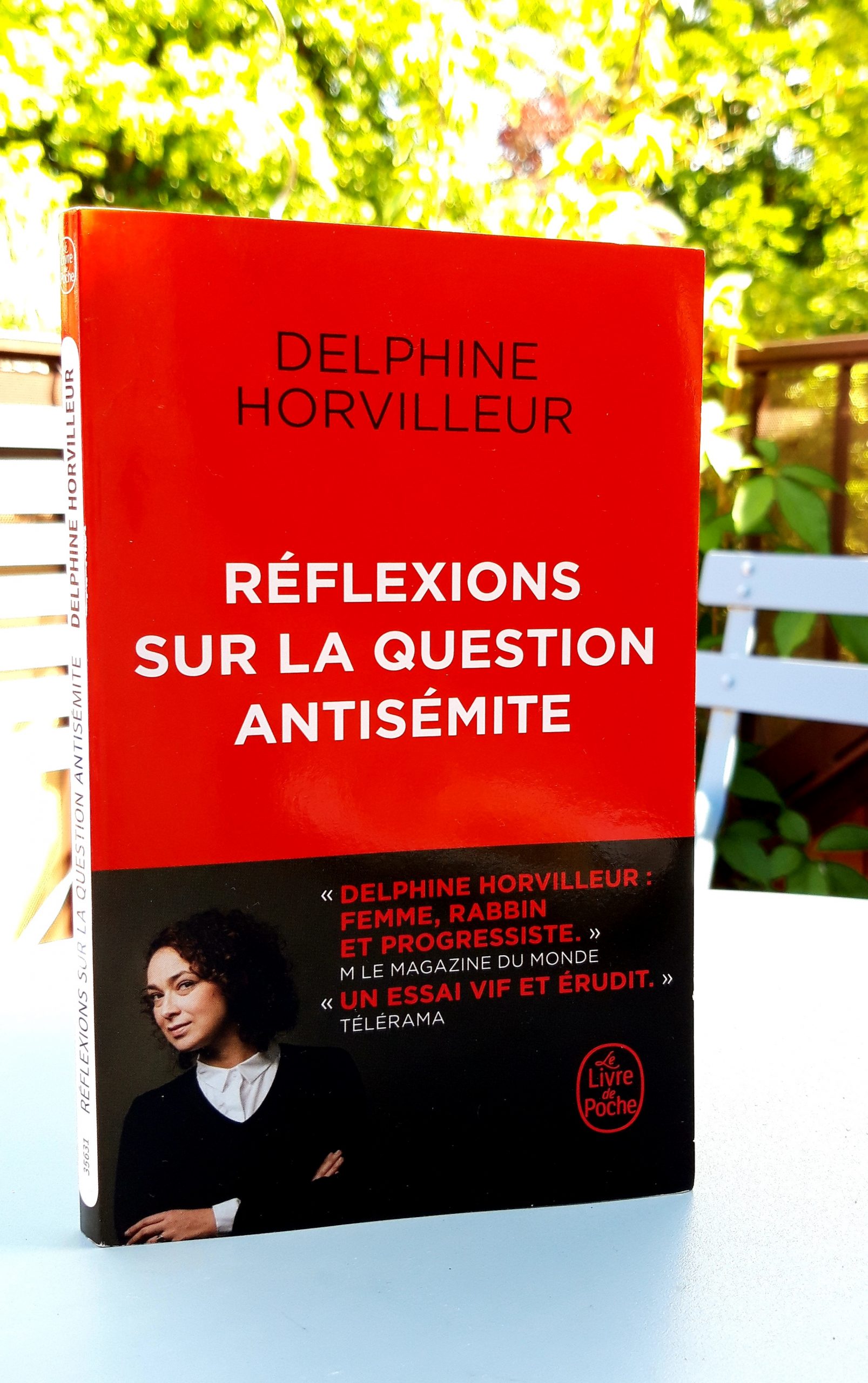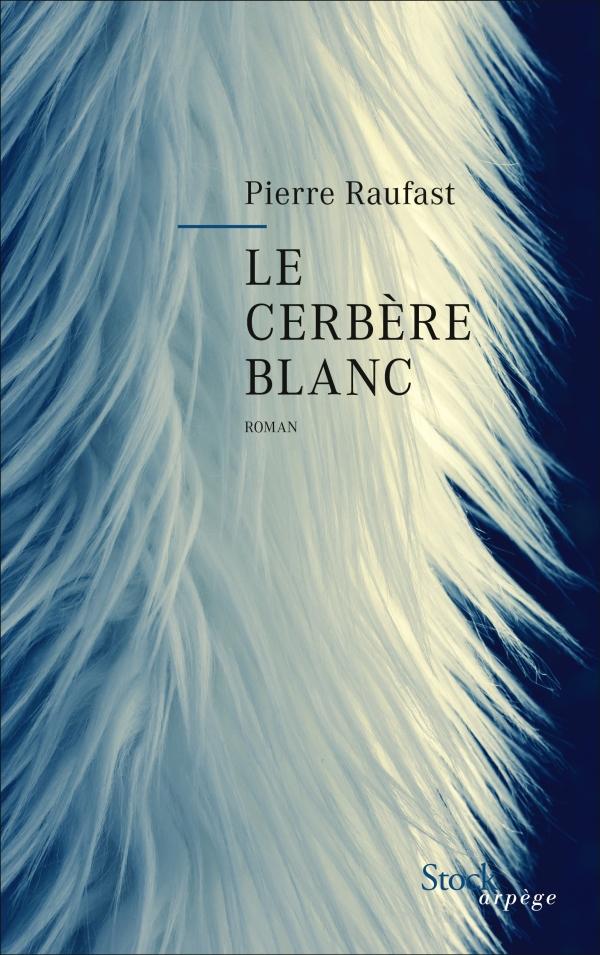Als ich diesen ersten Roman der englischen Schriftstellerin und Musikwissenschaftlerin aus dem Jahr 1926 gelesen habe, hat mich schon auf den ersten Seiten eine Faszination ganz eigener Art ergriffen und beim weiteren Lesen nicht mehr losgelassen: Ich war abwechselnd und manchmal auch gleichzeitig amüsiert, erschrocken, empört und verzaubert von dieser feinsinnigen Geschichte einer Frau, die anders ist und anders lebt, als es von ihresgleichen wie selbstverständlich erwartet wird, einer Frau, die als unverheiratete Erwachsene nicht nur ihren Mädchennamen, Laura, verliert, um fortan von allen nur noch Tante Lolly genannt zu werden, sondern auch die Freiheit, eine weibliche Identität zu haben, die nicht in einer familiären Beziehung begründet ist, einer Frau schließlich, die in eine Schublade gesteckt wird, die so eng ist, dass sie, als auch ihre kleinen, unauffälligen Fluchten nicht mehr helfen, auf immer noch subtile, aber wirksame Weise aufbegehrt und sich die Freiheit und Naturnähe ihrer Kindheit wieder zurückzuerobern versucht.
Der aus drei Teilen bestehende Roman weist eine stringente, aber stark kontrastive Struktur auf, deren größter Bruch, gleichwohl er unterschwellig lange vorbereitet wurde, im dritten Teil stattfindet, der sich durch seinen Übergang ins Ironisch-Fantastische von den vorhergehenden Teilen abhebt. Im ersten Teil erfährt man, wie die Hauptfigur Lolly Willowes, die damals noch Laura gerufen wurde, auf dem Land in Lady Place aufwächst; die Mutter lässt ihr, entgegen den eher strengen Sitten auf dem englischen Lande am Ende des 19. Jh., viel Freiraum, Laura darf lesen, was sie will, sie darf mit ihren Brüdern in der Natur umherjagen, und vor allem darf sie sich des leidigen Gesellschaftsspiels entziehen, welches das Leben der jungen Mädchen in der Suche nach einem Bräutigam kulminieren lässt. Nach dem frühen Tod der Mutter bleibt Laura ganz selbstverständlich bei ihrem Vater und sorgt für Haus und Garten, auch als die beiden Brüder nacheinander heiraten. Erst als der Vater stirbt, wird Laura sich über Nacht den gesellschaftlichen Konventionen, die in Lady Place keine Macht hatten, beugen. Sie zieht — und hier könnte der Kontrast in den Augen Lauras nicht größer sein — zur Familie ihres Bruders Henry nach London. Sie erlebt London als das genaue Gegenteil von Lady Place, das sie gegen eine graue, enge und von engstirnigen Menschen bewohnte Stadt eintauschen musste. Freiheit, sowohl des Geistes als auch des Körpers, und Natürlichkeit sind in dem Roman eng mit dem Begriff der Natur verbunden, während das urbane Gesellschaftsleben Entfremdung und Rollenzwänge begünstigt:
There was a small garden at Apsley Terrace, but it had been gravelled over because Henry disliked the quality of London grass; and in any case it was not the sort of garden in which she could run barefoot.
She was also annoyed by the hardness of the London water. Her hands were so thin that they were always red; now they were rough also. If they could have remained idle, she would not have minded this so much. But Caroline never sat with idle hands; she would knit, or darn, or do useful needlework. Laura could not sit opposite her and do nothing.
Lolly Willowes, S. 46 (Part 1)
Die im Zitat genannte Caroline ist Lauras Schwägerin und in fast allem das Gegenteil von ihr; Caroline ist eine perfekte Hausfrau und Mutter, sie bestätigt ihren Ehemann unhinterfragt in allem, was er denkt und tut, und bringt in Gesellschaft anderer niemanden mit eigenen Gedanken und Widerspruch aus dem Konzept, so wie Laura das in ihrer nur scheinbar naiven Art immer wieder tut, wenn sie gedankenlos geäußerte Klischees und Dummheiten einfach nicht so stehen lassen kann. Lauras unvoreingenommene, genaue Beobachtungsgabe, die in zurückhaltendem personalen Erzählstil vermittelt wird, verschafft dem Leser hier den Genuss psychologisch sehr nuancierter und entlarvender Figurenporträts. So durchschaut Laura etwa sehr genau, dass ihre Schwägerin zwar den Konventionen zufolge einen vorbildlichen Charakter hat, ihr Verharren in Konformität und Passivität sich letztlich jedoch auch auf das Verhalten ihres Mannes negativ auswirkt. Denn da Henry zuhause, ebenso wie übrigens auch in seinem beruflichen Umfeld — er hat eine Stelle als Jurist — keinerlei Widerspruch und geistige Anregung erhält, macht er es sich mit der Zeit in seinen Vorurteilen bequem und wird immer engstirniger; man geht wohl nicht zu weit, wenn man hier ein indirektes Plädoyer für eine gleichberechtigte Beziehung herauszulesen meint.
Doch so gut es Caroline und ihr Mann auch mit Laura meinen, indem sie ihr ein Obdach und Gesellschaft geben — die nicht mehr ganz junge Frau fügt sich einfach nicht in die für sie vorgesehene Rolle. Und zwar nicht durch Provokation und Aufmüpfigkeit, sondern schlicht durch die von ihr gelebte Natürlichkeit, mit der die Anstrengungen der anderen als unaufrichtig und zwanghaft entlarvt werden und an der denn auch alle Versuche, sie doch noch irgendwie an den Mann zu bringen, abprallen müssen. Mit diesen erzähltechnischen Strategien gelingt es der Autorin, ihre Figuren sehr lebendig und augenzwinkernd zu charakterisieren, hintersinnig Gesellschaftskritik zu üben und nicht zuletzt auch den Frust und die Verzweiflung ihrer Hauptfigur Laura für den Leser spürbar zu machen:
Caroline seemed affectionately disposed towards her; she was full of practical good sense, her advice was excellent, and pleasantly bestowed. Laura saw her a good wife, a fond and discreet mother, a kind mistress, a most conscientious sister-in-law. She was also rather gluttonous. But for none of these qualities could Laura feel at ease with her. Compared to Caroline she knew herself to be unpractical, unmethodical, lacking in initiative. The tasks that Caroline delegated to her she performed eagerly and carefully, but she performed them with the hampering consciousness that Caroline could do them better than she, and in less time.
Lolly Willowes, S. 52 f. (Part 1)
Als Lauras jüngerer Bruder James stirbt, wird ihr Kindheitsparadies Lady Place verpachtet, alles Mobiliar und die vielen, teils kuriosen Sammlerstücke aus früheren Willowes-Generationen werden verteilt oder zwischengelagert. In der Folge dieses einschneidenden Ereignisses wird deutlich, dass Laura, gleichwohl James‘ Sohn Titus, Lauras Neffe, rein rechtlich der Erbe von Lady Place sein wird, die wahrhaftige, nämlich geistige und emotionale Erbin der Willowes‘ ist. Dies ist für den weiteren Fortgang der Geschichte insofern von zentraler Bedeutung, als Laura sich von ihrer geographischen Bindung zu Lady Place freimachen kann, da sie erkennt, dass dieser Sehnsuchtsort nur noch in ihrer Erinnerung, dafür aber der Zeit und des Raums enthoben, weiterexistiert; so wird sie innerlich bereit für ihren Befreiungsschlag, ihren Ausbruch.
Doch erst einmal findet mit dem Ersten Weltkrieg ein anderer Ausbruch statt, der entscheidende Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und sozialen Hierarchien und eben auch auf die Geschlechterrollen hat; auf einmal ist es ganz selbstverständlich, dass die Frauen am Erwerbsleben teilhaben und in der Öffentlichkeit präsent sind. Weibliche Biographien, die für Leute wie Caroline und Henry vor dem Krieg unvorstellbar gewesen wären, werden geschrieben, wie zum Beispiel die ihrer eigenen Tochter mit dem andeutungsreichen Namen Fancy: Nach ihrer überraschenden und unkonventionellen Heirat 1914 wird sie bereits 1916 zur Kriegswitwe — und im gleichen Atemzug zur „widowed amazon“ (S. 70), zur modernen, unabhängigen Frau:
At least [so denkt sich ihre Mutter Caroline] Fancy might stay in her very expensive flat and be a mother to her baby. But Fancy drew on a pair of heavy gauntlet gloves and went to France to drive motor lorries.
Lolly Willowes, S. 70 (Part 1)
Mit dem Krieg ist auch der erste Teil des Romans zu Ende. Während die Londoner Willowes auf nun recht anachronistisch wirkende Weise zum Alltag vor dem Krieg zurückkehren —
When the better days to come came, they proved to be modelled as closely as possible up to the days that were past. It was astonishing what little difference differences had made.
Lolly Willowes, S. 73 (Part 1)
— ergreift Laura eine schwer fassbare Melancholie, die ebenso plötzlich, wie sie aufgekommen ist, wieder verschwindet, doch eine weitere unsichtbare Wunde in ihr hinterlässt, ein vages Ungenügen, das sie mit kleinen eskapistischen Streifzügen durch die Stadt und in Buchläden zunächst aufzuheben scheint. Doch hinter diesem scheinbaren Ausleben von Selbständigkeit und Freiheit verbirgt sich eine tiefe Einsamkeit, der sie in ihrer Rolle als unverheiratetes Anhängsel der Familie nicht zu entkommen vermag:
These things were exciting enough to be pleasurable, for she kept them secret. Henry and Caroline […] were quite indifferent as to where and how she spent her afternoons; they felt no need to question her, since they could be sure that she would do nothing unsuitable or extravagant. Laura’s expeditions were secret because no one asked her where she had been. […] But she did not examine too closely into this; she liked to think of them as secret.
Lolly Willowes, S. 79 f. (Part 2)
Die Kehrseite dieser kleinen Freiheiten, die sie sich nimmt, ist das vollständige Desinteresse der anderen für ihre Person. Für die Gesellschaft existiert sie im Grunde gar nicht. Und so fängt unterschwellig etwas in ihr zu brodeln an, eine Sehnsucht, die sie zum Entsetzen ihrer aus allen Wolken fallenden Familie dann doch eines Tages zu einer unerhörten „Extravaganz“ veranlasst. Sie fasst die Entscheidung, London zu verlassen und in eine ländliche Gegend zu ziehen, die sie nur aus einem Reisebericht kennt; und zwar ganz allein. Als sie mit dieser Neuigkeit inmitten eines Familientreffens herausplatzt, nimmt sie außer ihrem Neffen Titus niemand ernst; daher sucht sie später erneut das Gespräch mit ihrem Bruder:
„But Lolly, what you want is absurd.“
„It’s only my own way, Henry.“
„If you would like a change, take one by all means. Go away for a fortnight. […] Take a little trip abroad if you like. But come back to us at the end of it.“
„No, Henry. I love you all, but I feel I have lived here long enough.“
„But why? But why? What has come over you?“
Laura shook her head.
[…] „Lolly! I cannot allow this. You are my sister. I consider you my charge. […] It is not sensible. Or suitable.“
„I have reminded you that I am forty-seven. If I am not old enough now to know what is sensible and suitable, I never shall be.“
Lolly Willowes, S. 102 f. (Part 2)
Auch als sich im weiteren Gesprächsverlauf herausstellt, dass Henry ihr Geld ohne ihr Wissen ungünstig angelegt hat, so dass kaum mehr etwas davon übriggeblieben ist, lässt Laura sich nicht von ihrem Entschluss abbringen. Sie stellt sich auf ein bescheideneres, aber unabhängiges Leben ein und zieht zu einem älteren Ehepaar in eine Pension. In ihrer neuen Umgebung unternimmt sie behutsame freundschaftliche Annäherungen und vor allem viele Streifzüge durch die Natur, auf denen sie — zugleich schmerzhaft und befreiend, eine innere Wandlung durchmacht und endlich die ganze Dimension ihrer vorherigen Entfremdung erkennt. Im charakteristisch augenzwinkernd-satirischen Stil hebt die Autorin Lauras persönliches Schicksal auf eine übergeordnete, gesellschaftliche und historische Ebene:
There was no question of forgiving them [ihrer Londoner Familie]. She had not, in any case, a forgiving nature; and the injury they had done her was not done by them. If she were to start forgiving she must needs forgive Society, the Law, the Church, the History of Europe, the Old Testament, great-great-aunt Salome and her prayer-book, the Bank of England, Prostitution, the Architect of Apsley Terrace, ans half a dozen other useful props of civilisation.
Lolly Willowes, S. 152 (Part 2)
Doch es wäre zu kurz gegriffen und — gerade angesichts der in der zitierten Textstelle genannten historisch verankerten Gesellschaftsstrukturen — zu weltfremd, wenn ihr Akt der Emanzipation damit einfach so vollendet wäre. Im dritten Teil geht es denn auch darum, ihr neues Dasein gegen seine Bedrohung von außen zu verteidigen. Diese Bedrohung manifestiert sich ausgerechnet in Gestalt ihres Neffen Titus, der ihr in gewisser Weise sehr ähnlich ist und den sie eigentlich von Herzen gern hat. Titus ist inzwischen Student, ein junger, vor Willen und Kraft strotzender Mann, der den Ausbruch seiner Tante auf seine Weise imitiert und für eine Zeitlang bei ihr wohnen möchte. Doch Laura empfindet dieses Ansinnen als Affront und ihren Neffen als Eindringling, der ihr das alte Leben, aus dem sie sich so mühsam befreit hat, wieder überzustülpen droht: Auf einmal ist sie wieder die nützliche, liebenswürdige, unbedeutende Tante Lolly, kurz davor, wieder in die alten Ketten gelegt zu werden:
She walked up and down in despair and rebellion. She walked slowely, for she felt the weight of her chains. Once more they had fastened upon her. She had worn them for many years, acquiesciently, scarcely feeling their weight. Now she felt it. And, with their weight, she felt their familiarity, and the familiarity was the worst of all.
Lolly Willowes, S. 156 (Part 3)
Das Gefühl der Bedrohung besteht auch in der von ihr auf einmal ganz stark empfundenen Kluft zwischen einer Männlichkeit, die auch Selbstverständlichkeit bedeutet, und ihrer Weiblichkeit: Für Titus entspringt seine Lust auf einen Aufenthalt fernab seiner Familie einer leicht zu erfüllenden, durch keinerlei Hindernisse erschwerten Laune, während der Ausbruch für Laura ein einzigartiger, von Imagination, Hoffnung und Emotion beseelter Kraftakt war. Die Art ihrer Liebe zu dieser Gegend unterscheidet sich in Lauras Augen daher grundlegend:
It was comfortable, it was portable, it was a reasonable appreciative appetite, a possessive and masculine love. […] He loved the countryside as though it was a body.
She had not loved it so. […] for long before she saw it she had loved it and blessed it. With no earnest than a name, a few lines and letters on a map […] she had trusted the place and staked everything on her trust. She had struggled to come, but there had been no such struggle for Titus.
Lolly Willowes, S. 162 f. (Part 3)
Mit Lauras Verzweiflung nimmt der Roman in diesem letzten Teil noch einmal so richtig Fahrt auf. Es bleibt poetisch, aber es wird fantastisch, wild und abenteuerlich. Wie kann sie diesen Eindringling wieder loswerden, wie sich gegen die Verletzung ihres so mühsam eroberten Schutzraumes wehren? Und schließt Laura wirklich einen Pakt mit dem Teufel, der ihr in Gestalt einer kleinen Katze auflauert? Mit dem Motiv der Hexe, das im letzten Teil in den Roman Eingang findet, stellt die Autorin provokativ-ironisch die Frage in den Raum, ob für eine unabhängig lebende Frau ab einem bestimmten Alter nur die ewig-alte Unterstellung gültig sein kann, dass sie eine Hexe ist. Zugespitzt: Muss eine Frau böse werden, um frei sein zu können? In der Handlung wird dieser Mythos aufgegriffen und dann geschickt transformiert und dekonstruiert. Entsprechend der Inversion, die den bösen Teufel hier in eine liebende Erscheinung der Natur verwandelt, wird auch der Begriff der Hexe — wie der Frau — seiner historisch-moralischen Zuschreibungen enthoben und in einen sozialkritischen Kontext gestellt:
One doesn’t become a witch to run round being harmful, or to run round being helpful either, a district visitor on a broomstick. It’s to escape all that — to have a life of one’s own, not an existence doled out to you by others […].
Lolly Willowes, S. 243 (Part 3)
Durch die mythisch-fantastische Struktur des Textes im dritten Teil wirkt eine solche Dekonstruktion zugleich kämpferisch und utopisch, zumal sich poetische Ernsthaftigkeit und spielerische Ironie hier stets gegenseitig durchdringen. So wurzelt etwa der Gedanke an ein Kollektiv der Hexen, die eine eigene soziale Klasse darstellen könnten, aus einem ganz realen Ungerechtigkeitsempfinden und vermag den Lesern doch zugleich ein halb amüsiertes, halb trauriges Schmunzeln zu entlocken: wie z.B. wenn es um die Rekrutierung von weiblichen Hexen oder männlichen Zauberern geht; die Benachteiligung der Frauen im wirklichen Leben stellt nämlich einen absoluten Pluspunkt in ihrer Qualifikation als Hexe dar:
I can’t take warlocks so seriously, not as a class. It is the witches who count. We have more need of you. Women have such vivid imaginations, and lead such dull lives.
Lolly Willowes, S. 238 (Part 3)
Lolly Willowes ist ein ebenso melancholisches wie humorvolles Stück Literatur, kunstvoll verfasst in einem ganz eigenen Stil, den man poetisch-magischen Realismus nennen könnte oder besser noch: poetisch-magischen Feminismus? Auf jeden Fall vereinen sich hier Elemente des britischen Gesellschaftsromans satirisch-kritischer Prägung und eine ins Fantastische getauchte Abenteuergeschichte mit utopischen und naturhymnenhaften Zügen zu einem poetischen Gesamtkunstwerk, dessen kritisch-utopischer Gehalt auch heute noch Relevanz hat. Aufschlussreich ist, dass sich Laura zwar mit der utopischen Idee des selbstbestimmten Hexen-Lebens anfreunden kann, nicht jedoch mit der kollektiven Form des Hexensabbats, von dem sie gleich wieder Reißaus nimmt, als sie darin neue gesellschaftliche Zuschreibungen und Zwänge entdeckt. Laura ist eine literarische Figur, die sich nicht von Ideologien einzwängen und dirigieren lassen will, sondern die im Einklang mit sich und ihrer Umwelt leben möchte, und die dafür immer wieder auch ihre Rückzugsorte braucht. Somit zeichnet ihre Geschichte eindrücklich einen emanzipatorischen Akt nach, der aber ungleich poetischer ist, als alle zeitgenössischen Gesellschaftsformen des Feminismus es sein können, sei es des politisch-aktivistischen, des sprachpolitisch-formbehafteten oder derjenigen Spielart, die — wie Beate Hausbichler es in ihrem kürzlich erschienenen Buch, Der verkaufte Feminismus, analysiert — oft mehr Pose und Label ist als ehrliches Engagement. Literatur, das zeigt der Roman, ist doch immer noch eine der besten Arten, gesellschaftliches Bewusstsein zu schärfen, ohne den empathischen und differenzierten Blick für die Geschichte des Einzelnen zu verlieren.
Bibliograpische Angaben
Sylvia Townsend Warner: Lolly Willowes or The loving huntsman [1926], Academy Chicago Limited (1979)
ISBN: 9780915864911
Zur deutschen Ausgabe:
Bildquelle
Sylvia Townsend Warner: Lolly Willowes oder Der liebevolle Jägersmann, Dörlemann (2020)
In neuer deutscher Übersetzung von Ann Anders
ISBN 9783038200796
© 2020 Dörlemann Verlag AG, Zürich