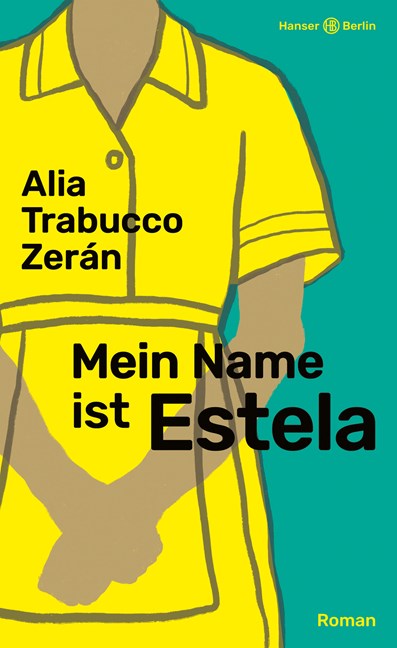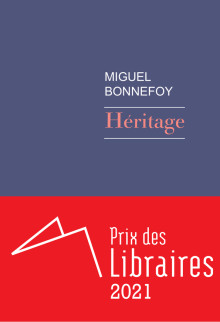Ja, sie hat einen Namen und sie kann sprechen, sie kann sogar erstaunlich gut formulieren, reflektiert und scharfsichtig, sich ihrer selbst bewusst und manchmal fast poetisch empfindsam, wovon man auf den folgenden 240 Seiten, von denen seit den ersten Zeilen eine so faszinierende wie erschütternde Spannung ausgeht, Zeuge wird. Erstaunlich gut? Ja, denn einem einfachen Hausmädchen, das selbst als Tochter einer Arbeiterin und Hausangestellten aufgewachsen ist und vor sieben Jahren von einer Insel aus dem Süden Chiles nach Santiago de Chile gekommen ist, traut niemand eine solche Sprache zu. Genauso wie niemand auf die Idee kommt, dass auch sie eine Person ist, mit einem Namen und einer Geschichte.
Die Erzähl- oder Sprechsituation der Ich-Erzählerin Estela, der die chilenische Schriftstellerin Alia Trabucco Zerán eine literarische Stimme verleiht, ist eine existentielle. Nicht zufällig ist dem Roman wohl ein Zitat von Albert Camus vorangestellt: „Die Frage ist nur, wer wen säubert.“ (Camus, Der Fall) Die existentielle Situation ist in Estelas chilenischer Wirklichkeit untrennbar von der sozialen Situation, in die man geboren wird und die mit der existentiellen Macht des Todes im Bunde zu stehen scheint. Estela erhebt ihre Stimme, doch sie tut das in einem merkwürdig echolosen Raum, einem Gefängnis, einem Verhörzimmer. Sie wendet sich an die, die hinter dem Spiegel stehen, und mit denen die Vertreter von Justiz und Polizei genauso gemeint sein können wie wir Leser. Man erfährt gleich zu Beginn, dass sich eine Tragödie ereignet hat, das siebenjährige Mädchen der wohlhabenden Familie, für die Estela als Hausangestellte und Kindermädchen arbeitet, ist zu Tode gekommen, wie, das enthält uns die Erzählerin noch einige Zeit vor. Ebenso wie den tatsächlichen Grund, warum sie in diesem verspiegelten Verhörzimmer sitzt. So wird natürlich die Neugier des Lesers erst recht geschürt und zugleich der Finger auf die Wunde seiner von sozialen Vorurteilen angetriebenen Sensationslust gelegt. Wie kam es zu dem Tod, wie ist Estela darin verwickelt, ist sie die Schuldige?
Die Frage nach Schuld und Verantwortung entwickelt sich, ebenso wie der Hintergrund der Tragödie, die sich jedoch mehr und mehr als Tragödie des ausgebeuteten Dienstmädchens erweist, in den zahlreichen „Abschweifungen“ der Erzählerin, die von ihr jedesmal so vehement bestritten wie hervorgehoben werden und in denen sie erzählt, wie sie die sieben Jahre bei dieser an Geld reichen und Mitmenschlichkeit armen Familie erlebt hat. Wenn sie dort auch keiner expliziten physischen Übergriffigkeit ausgesetzt ist, so leidet sie doch täglich mehr unter der gleichwohl auf Ausbeutung beruhenden sozialen Hierarchie, die von Beginn an von Verachtung, Desinteresse und Arroganz geprägt ist und in die sich eine Erniedrigung nach der anderen einschleichen konnte. Allein das völlige Fehlen von Intimität, eines Rückzugortes, der seinen Namen auch verdient, verwandelt Estela in einen allzeit benutzbaren Haushaltsgegenstand. Umgekehrt wird sie selbst ganz selbstverständlich und ungefragt mit der Intimsphäre der Familie konfrontiert, sie reinigt die Unterwäsche, wischt Erbrochenes auf, sieht den Eltern ungewollt beim Sex zu und wird gezwungen nächtlichen Geständnissen des Hausherrn zuzuhören. In den Augen ihrer Dienstherren ist Estela keine Person, sondern Untergebene, Nana (Kindermädchen), Sklavin, nicht mehr wert als die streunende Straßenhündin, die Estela heimlich zum Füttern hereinlässt, so wie sie, als einzige Möglichkeit der Empörung, immer wieder subtile Akte des Ungehorsams unternimmt, um sich ihrer selbst, ihres Daseins noch irgendwie zu vergewissern. Doch schließlich bricht der Tod, die existentielle Macht schlechthin, gleich dreifach über Estelas Welt herein. Auf die absolute Sprachlosigkeit folgt der längst überfällige Bruch, ein völliges Zurückgeworfensein auf sich selbst, der Ausbruch aus der Gefangenschaft und der Beginn einer neuen. Estela nimmt am Ende an einer Demonstration gegen die soziale Ungerechtigkeit teil. Das Private, das für ein Dienstmädchen nie privat war, hat begonnen, politisch zu werden.
Wie in ihrem ersten Roman, Die Differenz, über die Verschwundenen der Pinochet-Diktatur, arbeitet Alia Trabucco Zerán auch in ihrem neuen Roman die politische und soziale Wirklichkeit ihres Heimatlandes literarisch auf. Sie findet eine Sprache, die die soziale Ungerechtigkeit und existentielle Not der ungehörten oder unterdrückten Stimmen erfahrbar macht. Mein Name ist Estela ist die sich ins Herz bohrende Anklage einer Angeklagten, die in ihren so genannten Abschweifungen gerade das Essentielle auf den Punkt bringt, die ans Licht holt, was zu oft und lange vergessen wurde. Dass es unmenschlich ist, einem Menschen, egal, welcher Herkunft und welcher sozialen Stellung, die eigene Geschichte abzusprechen.
Bibliographische Angaben
Alia Trabucco Zerán: Mein Name ist Estela, Hanser Berlin 2024
Aus dem chilenischen Spanisch von Benjamin Loy
ISBN: 9783446277274
Bildquelle
Alia Trabucco Zerán, Mein Name ist Estela
© 2024 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München