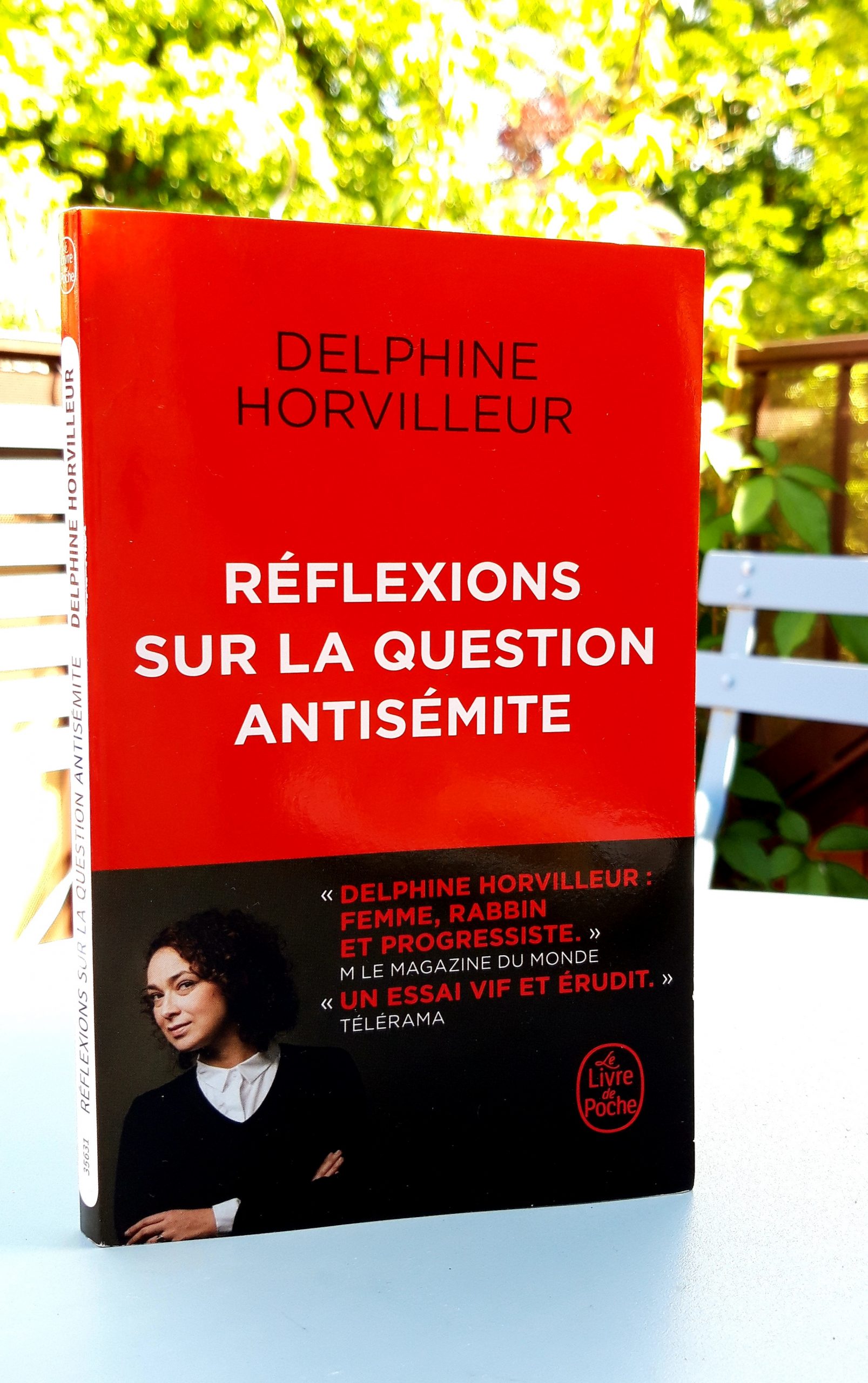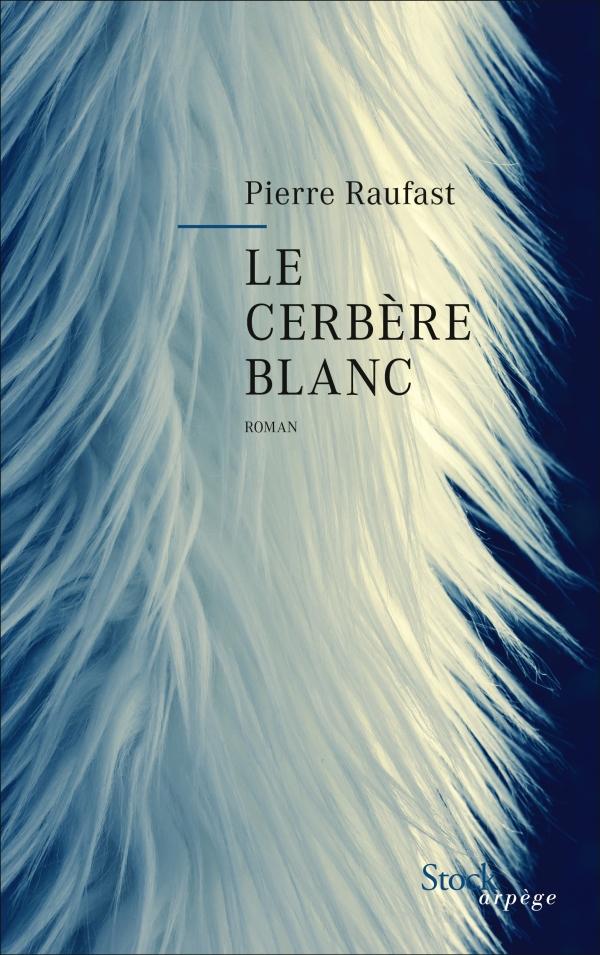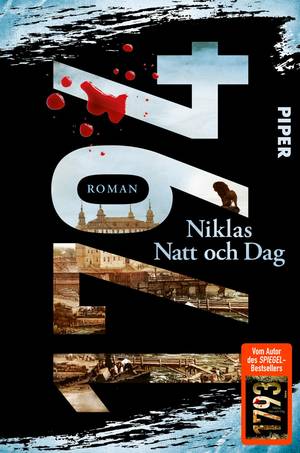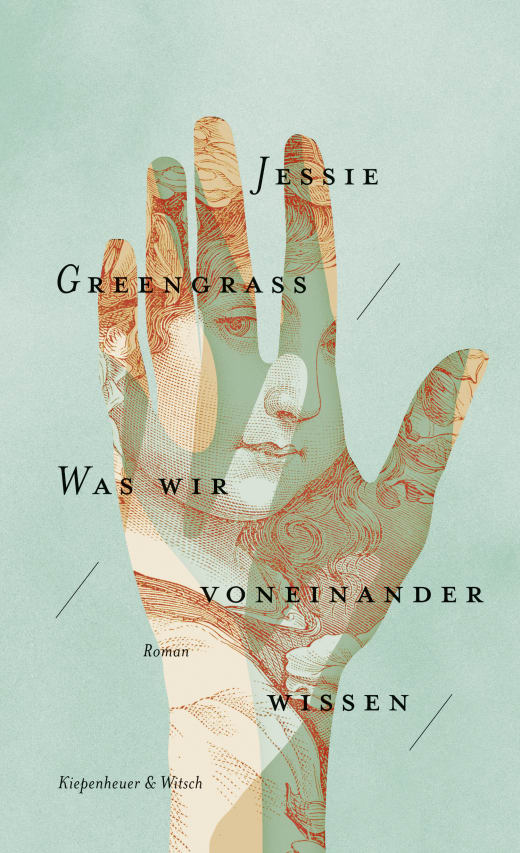Die französische Rabbinerin und Journalistin Delphine Horvilleur leistet mit ihren „Überlegungen zur Frage des Antisemitismus“ (so der Titel der deutschen Ausgabe im Hanser Verlag) einen äußerst intelligenten und erhellenden Beitrag zum besseren Verständnis des ebenso irrationalen wie merkwürdig persistenten Phänomens des vorurteilsbehafteten Ressentiments oder gar offenen Hasses gegenüber Menschen jüdischen Glaubens.
Ihr Essay ist ein schmales Bändchen, erkenntnisreich und spannend auf hohem reflexivem Niveau und liest sich überdies ungemein flüssig, da die Autorin ihre Leser charmant an die Hand nimmt, sie elegant durch ihre lebendige Argumentation lenkt und immer wieder von Bekanntem ausgehend die Dinge aus einer erfrischend neuen Perspektive beleuchtet. So wirft sie etwa immer wieder Fragen auf, die sie auch konkret formuliert und denen sie dann differenziert und anschaulich und mit reichlich literarischem und soziologischem Beispielmaterial nachgeht.
Im Zentrum steht natürlich die brandaktuelle Frage, warum auch heute der Antisemitismus nicht überwunden ist, warum er im Gegenteil gerade jetzt auf einen gefährlichen Nährboden zu fallen scheint. Zugleich führt eben diese Frage zurück in die Geschichte, in der sich seit Jahrhunderten in den verschiedensten Gesellschaften und Systemen der Judenhass immer wieder mit denselben Stereotypen manifestiert. Horvilleurs zentrale Argumentationslinie ist daher als philosophisch — geschichts- und religionsphilosophisch — und, vor allem in Bezug auf die antisemitischen Akteure, als psychologisch zu bezeichnen. In diese Linie integriert sie mit großem Illustrations- und Erkenntniswert einiges an literarisch-religiösem Material, vor allem rabbinische Texte kommen zur Sprache. Darin spürt sie frühen antisemitischen Feindbildern nach, die schier endlos zurückzureichen scheinen, aber in der rabbinischen Darstellung doch auffällig offen und oft auch humorvoll in Frage gestellt werden. Schon früh wird hier nach einer Alternative zum fatalistischen und unitaristischen Denken gesucht, das dem Antisemitismus oft zugrunde zu liegen scheint.
Bevor Horvilleur in fünf Kapiteln verschiedenen persistenten Merkmalen und Affinitäten des Antisemitismus nachgeht, definiert sie zuerst dessen Eigentümlichkeit, die ihn etwa vom verwandten Phänomen des Rassismus unterscheidet:
Le Juif au contraire est souvent haï, non pour ce qu’il N’A PAS, mais pour ce qu’il A. On ne l’accuse pas d’avoir moins que soi mais au contraire de posséder ce qui devrait nous revenir et qu’il a sans doute usurpé.
Hingegen wird der Jude oft nicht dafür gehasst, was er NICHT HAT, sondern dafür, was er HAT. Man beschuldigt ihn nicht, weniger als man selbst zu haben, sondern im Gegenteil etwas zu besitzen, was eigentlich uns zustehen sollte und was er vermutlich widerrechtlich an sich gerissen hat.
Horvilleur, Réflexions, S. 14
Das erste Kapitel geht den alttestamentarischen Darstellungen der Judenfeindschaft und ihrer Ergänzungen und Relativierungen in der rabbinischen Auslegung der Thora auf den Grund. Facettenreich wird so etwa der merkwürdige Hass Hamans auf den Juden Mordechai im Buch Esther analysiert, der Generationen zurück bis zur Zwillingsfeindschaft von Jakob und Esau reicht. Zwar verwendet Horvilleur nicht den von René Girard auch in Bezug auf die alttestamentarischen Mythen geprägten Begriff des mimetischen Begehrens, doch was sie als familiäre Rivalität herausarbeitet, erinnert sehr an seine Erklärung mythisch begründeter Gewaltdynamiken. Im zweiten Kapitel wird die psychologische Perspektive auf eine politische Ebene gehoben: Die nach der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr. ihres Kultortes beraubte und sich entsprechend neu auf das Wort und die Erwartung ausrichtende und somit an verschiedenste Systeme anpassungsfähige jüdische Gemeinschaft stellte, so Horvilleurs Interpretation, allein durch ihre dezentralisierte Existenz einen Stein des Anstoßes für ein auf Einheit und Integrität bedachtes römisches Reich dar. In diesem Kontext entsteht das stereotype Bild des Juden…
… comme source de contamination pour l’organisme qui l’accueille, et dont il menace l’intégrité par sa présence. Je lui en veux à mort de trouer ma complétude.
… als Quelle der Ansteckung für den Organismus, der ihn aufnimmt und dessen Unversehrtheit er durch seine Präsenz bedroht. Ich hasse ihn dafür, dass er meine Vollständigkeit durchlöchert.
Horvilleur, Réflexions, S. 68
In den folgenden Kapiteln zeigt die Autorin die schon von Freud konstatierte Affinität des Antisemitismus zu Misogynie und Sexismus auf, nimmt das Klischee des „erwählten Volkes“ auseinander und wendet sich schließlich dem Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus zu, die sie zwar keinesfalls gleichsetzen will, doch deren Denkmuster sich zum Teil gefährlich überschneiden.
Ein religionsphilosophischer Gedanke kehrt dabei immer wieder, der letztlich darauf hinausläuft, dass seit Abrahams Fortgang aus Ur die jüdische Glaubensgemeinschaft sich nie durch ihre Herkunft definiert, sondern durch ihre gerade nicht proselytische Anpassungsfähigkeit und zwangsläufig imperfekte Ausrichtung auf die Zukunft, und ihrer Umgebung daher immer wieder die eigene beängstigende Unvollständigkeit und Heterogenität ins Gedächtnis ruft. Vor diesem Hintergrund ließe sich auch erklären, wieso der Antisemitismus mit so gänzlich verschiedenen Denkmustern kompatibel ist, dass er sich im rechtsradikalen ebenso wie im linksradikalen Denken wiederfindet und teilweise sogar im Postkolonialismus anzutreffen ist, man denke nur an die gegenwärtige Debatte um Achille Mbembe und die Boykottmaßnahmen des BDS.
Schließlich bringt Horvilleur in ihrem Essay auch das in ihren Augen höchst gefährliche Potential des identitären, kommunitaristischen Denkens, das gegenwärtig Konjunktur hat, zur Sprache und setzt es in einen aufschlussreichen Zusammenhang mit erstarkenden antisemitischen Tendenzen. Die sich zu einem regelrechten Wettbewerb entwickelnden Opferdiskurse betrachtet sie mit Sorge, ebenso wie eine ausschließlich über die Gruppe sich vollziehende Selbstdefinition des Menschen, welche ihrer Ansicht nach die Vielschichtigkeit des Individuums, das immer mehr ist als seine Religion, seine Hautfarbe oder sein Geschlecht, beeinträchtigt und zu geradezu absurd anmutenden neuen Konflikten führen kann. In einem entsprechend einseitig geführten Opferdiskurs erscheint dann paradoxerweise sogar der Schmerz, den die Juden im Dritten Reich erlitten, fast wie ein Privileg, das Neid auslöst und antisemitischem Denken Vorschub leistet:
Son passé de victime ou de discriminé, qui devrait opérer comme une soustraction, un ‚moins que moi‘, agit paradoxalement comme un ‚en plus‘ ou un avantage qu’on vient à lui jalouser.
Seine Vergangenheit als Opfer oder als Diskriminierter, die als eine Entbehrung, ein „Weniger als ich“ funktionieren müsste, wirkt paradoxerweise als ein „Zuviel“ oder ein Vorteil, um den man sie beneidet.
Horvilleur, Réflexions, S. 15
Hier findet Horvilleurs Essay auch Anschluss an aktuelle Diskurse zur Identität, zur kulturellen Aneignung u.ä., wie sie zum Beispiel in Kwame Appiahs entlarvender Analyse der „Identitäten“ oder in Francis Fukuyamas neuem Buch Identität aufgerollt werden.
Allen, die sich die Frage nach dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stellen, lege ich den äußerst lesenswerten Text der französischen Rabbinerin unbedingt ans Herz, denn ihr gelingt es tatsächlich, dass man die rein rational so unverständlich erscheinenden und doch so hartnäckigen Mechanismen antisemitischen Denkens ein bisschen besser durchschaut, und dass man auch deutlicher sieht, wo man ansetzen muss, um bestimmten gefährlichen Stereotypen entgegenzuwirken und ein sich von Ressentiment und Hass nährendes judenfeindliches Denken zu überwinden.
Delphine Horvilleur: Réflexions sur la question antisémite, LGF/Livre de poche (2020)
ISBN: 9782253820345