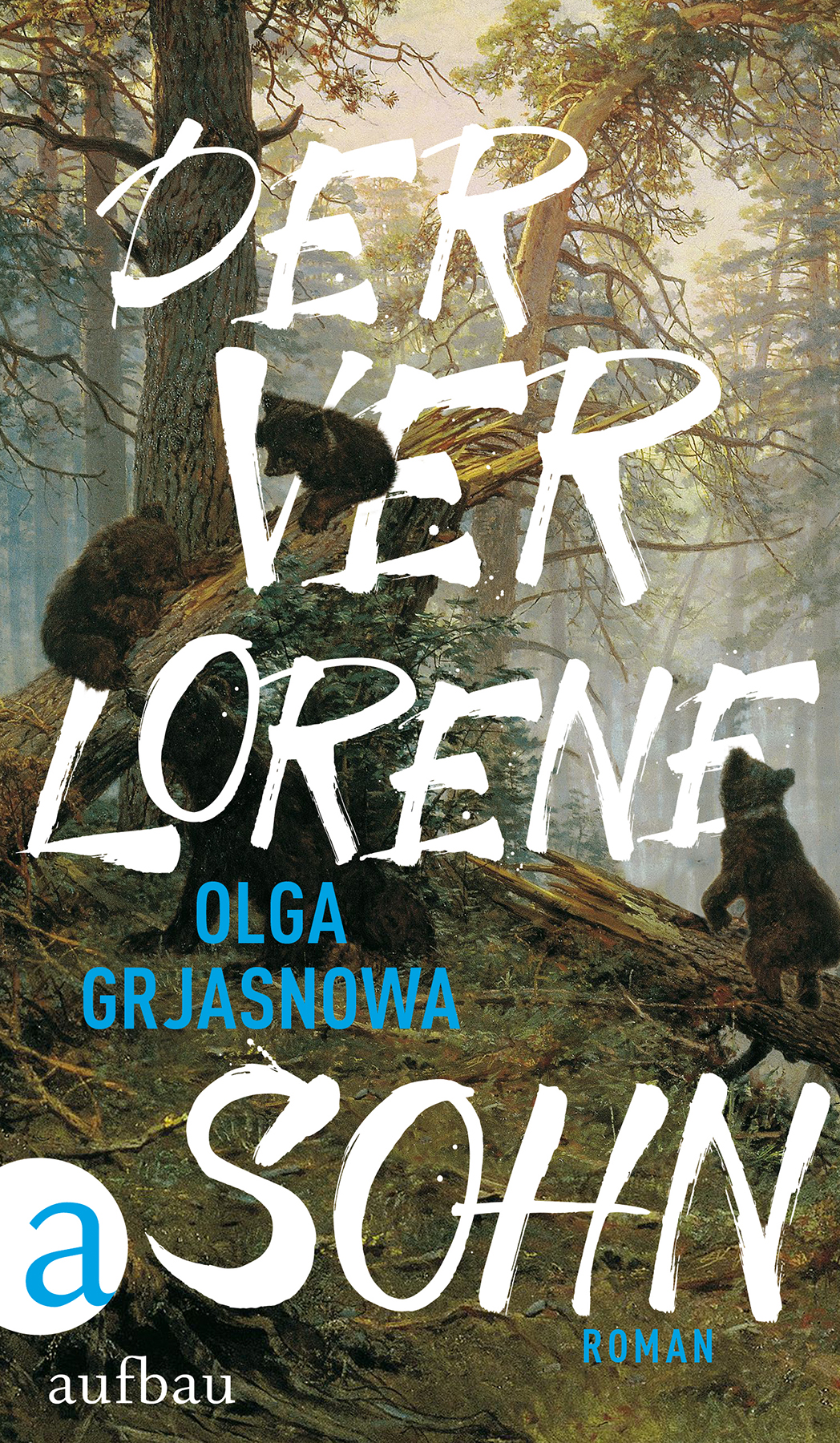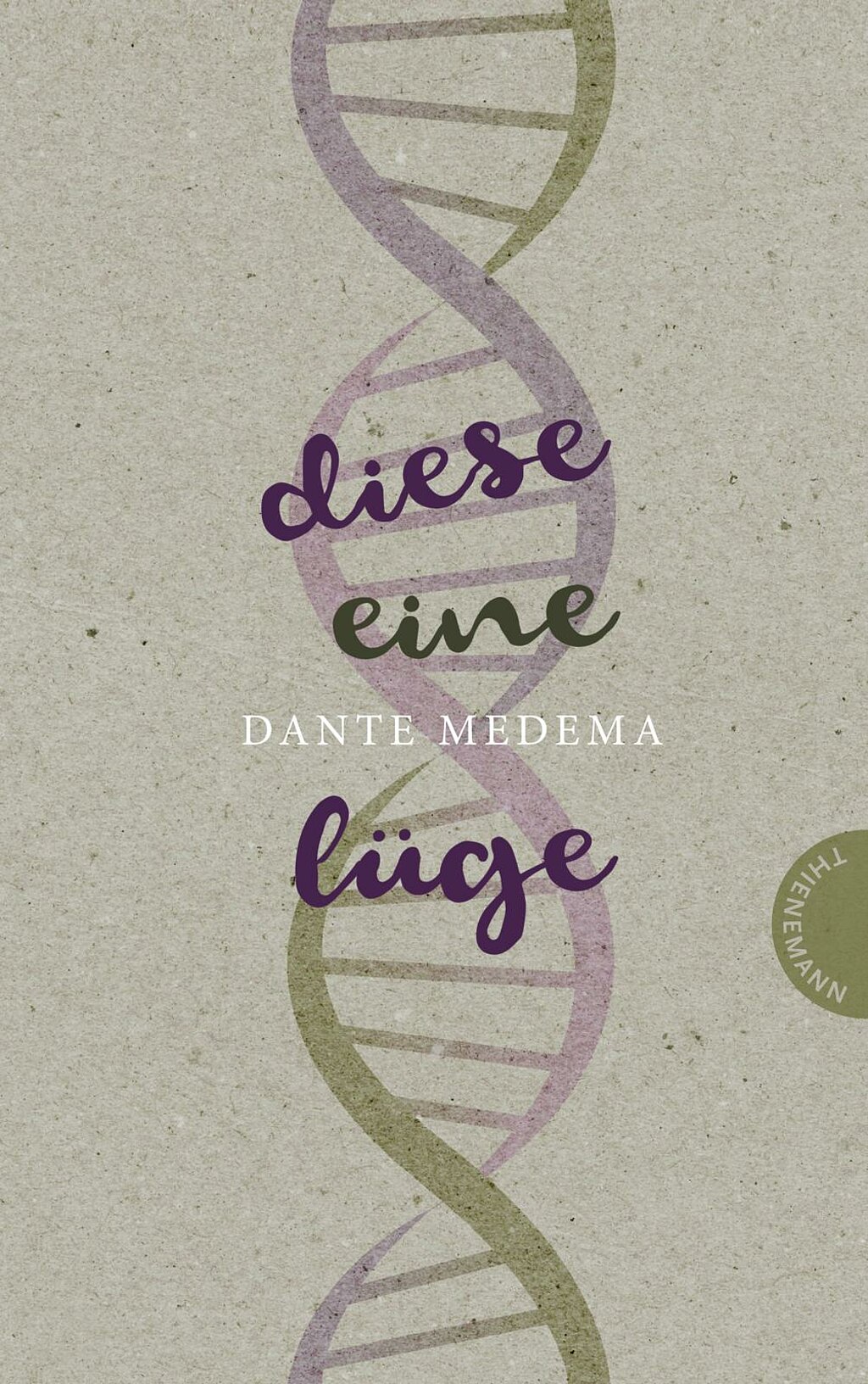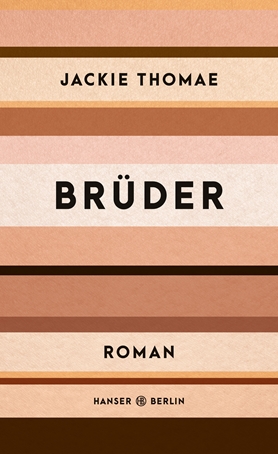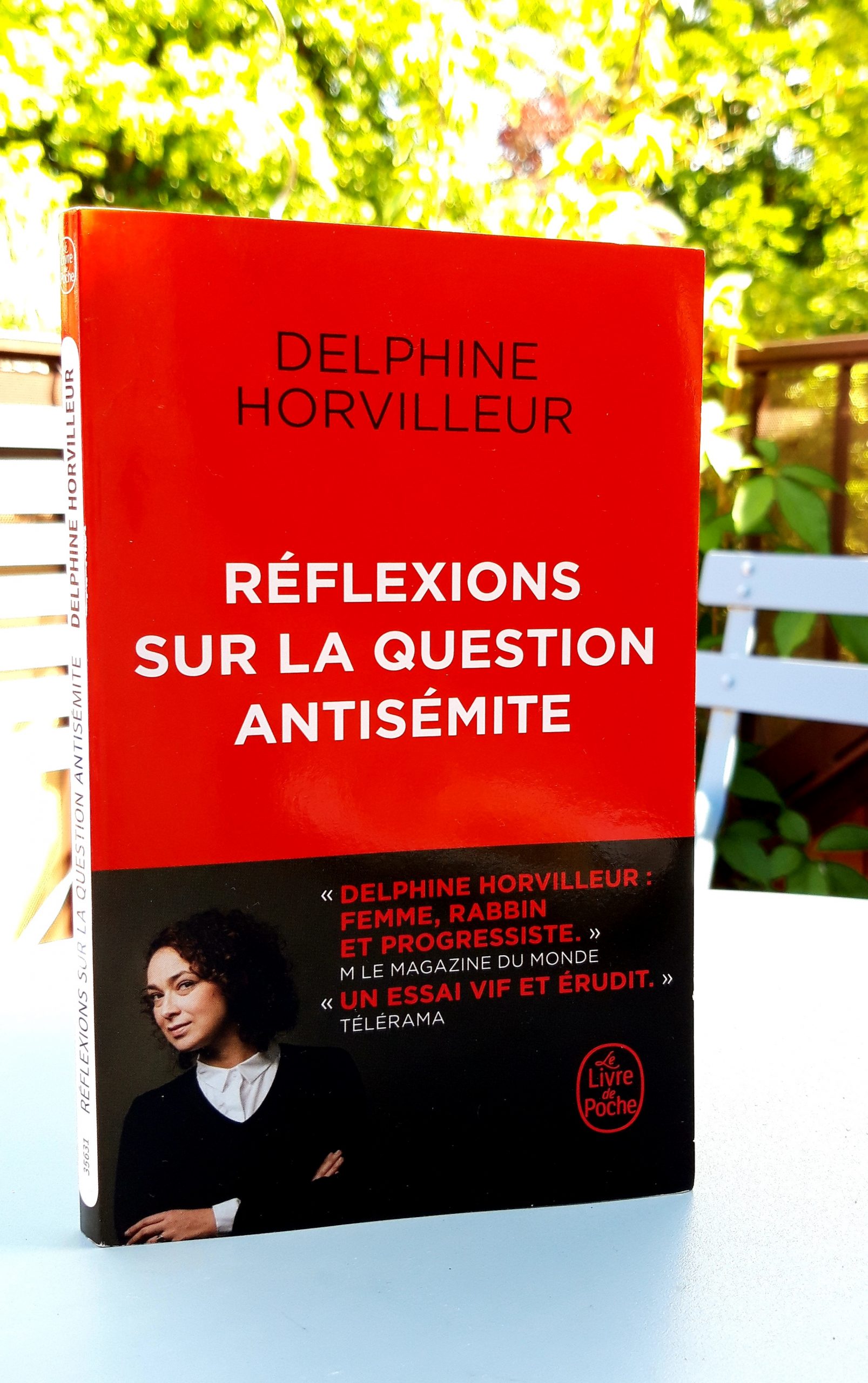Der Begriff der Identität hat die wissenschaftlichen Sphären der Psychologie und der Philosophie längst überschritten und eine gesellschaftspolitische Aufladung erfahren, die sich in so vielen, so häufig mit großer Emotionalität und Vehemenz geführten Debatten in der breitgefächerten medialen Öffentlichkeit äußert, dass man in der eigenen Wahrnehmung der Welt unweigerlich von diesem wie auch immer inhaltlich gefüllten Wort gelenkt zu werden scheint.
Diesen Eindruck erweckt auch der persönliche Einstieg, den der Autor Jörg Scheller für seinen Essay gewählt hat. In einer psychologischen Selbsthinterfragung schildert er, wie er, etwa beim Schauen von Musikvideos, in seiner Wahrnehmung mittlerweile geprägt ist von Diversitätssignalen, von der automatischen Erfassung der repräsentierten — oder eben nicht repräsentierten — Identitäten. Gleichzeitig stellt er an sich fest, dass er seine journalistischen Texte unbewusst gern mit eigenen fragmentarischen Identitätszuordnungen („Ich als Mann von soundsoviel Jahren / als Kunsthistoriker“ u.ä.) zu legitimieren strebt. In solchen auf die Identität bezogenen Reflexen dürften sich wohl viele wiedererkennen. Den sozialen Wert der so und viel genannten Vielfalt durchaus schätzend, ja sie „als“ Kunstwissenschaftler, Journalist, Erforscher der Popkultur, Musiker (u.a. in einer Heavy-Metal-Band), um nur ein paar der öffentlich bekannten Identitätsmerkmale des Autors aufzuzählen, intellektuell und ästhetisch praktizierend, stößt ihm doch die teilweise opportunistische Instrumentalisierung von „diversity“ und „identity“ sowie die polarisierende Reduktion und Vulgarisierung von Identitätszuschreibungen ungut auf.
Sein Essay, in dessen freie Argumentationslinie er neben persönlichen Beobachtungen viele aussagekräftige Stimmen aus der Philosophie, Soziologie, politischen Theorie, auch aus der Literatur und den (sozialen) Medien einbaut, von John Rawls, Hannah Arendt über Eva Illouz und Mohomodou Houssouba bis zum Rapper Ice-T, ist trotz der subjektiven Färbung das Gegenteil einer aktivistischen Streitschrift; es ist vielmehr der engagierte Versuch einer sachlicheren Betrachtung der seit einiger Zeit hitzig geführten Diskussionen um den in vielfältigen Schattierungen schillernden und von zahlreichen Kollektiven in ihrem eigenen Sinne eingesetzten Begriff der Identität. Auf seinem inspirierenden und informierenden Gedankengang, der ihn in wenigen Kapiteln von der Theorie zur Praxis der Identitätspolitik führt und auch kontextualisierende Einblicke etwa in die Entstehungsgeschichte der Intersektionalitätstheorie (d.h. der Theorie von der Überschneidung verschiedener Diskriminierungen) gibt, folgt der Autor dem Weg der Mäßigung und Differenzierung als in seinen Augen einzig möglichen, dem Extremismus, Fundamentalismus und Populismus, der sich auf diesem Gebiet breitzumachen versucht, entgegenzutreten.
So kann der Einsatz für eine Gruppenidentität den drastischen oder auch schleichenden Übergang zu einer Abwertung anderer Gruppenidentitäten, die nicht die eigene sind, in sich bergen. Ein solches Identitätsverständnis wird schnell ideologisch und extremistisch und führt mit „hermetische[n] Weltbilder[n] und eiserne[n] Identitäten“ (S. 35) zu Entdifferenzierung und moralischer Radikalisierung:
Die Soll-Identität der Welt wird mit der eigenen Gruppenidentität identifiziert — aus der unausweichlichen Enttäuschungserfahrung resultiert Gewalt. Natürlich ist dieses Prinzip nicht auf rechtsextreme Ideologien beschränkt. Es ist Kennzeichen aller Extremismen.
Jörg Scheller, Identität im Zwielicht, S. 35
Aus diesem Grund misstraut Scheller, der für Offenheit, Pluralismus und einen Liberalismus der Chancengleichheit nach John Rawls eintritt, allen Kollektiven mit exklusiv verstandener Identität, Kollektiven, die für sich beanspruchen, eine Kultur zu repräsentieren. Hier, im Zwielicht der Identitätspolitik, lauert die identitäre Politik:
Das Problem sind somit nicht Identitäten an und für sich, insofern diese meist flexible, wabernde, an den Rändern offene Gebilde sind. Das Problem ist ihre Kodifizierung, ihre dogmatische Verengung […] und ihre Repräsentation durch machthungrige Narzissten, die Menschen nicht in ihrer lebendigen Einzigartigkeit begreifen, sondern als Figuren auf dem Schachbrett der Macht. Sie sehen in Menschen stets nur Repräsentanten und Repräsentationen einer Kultur, einer Identität, einer Religion, einer „Rasse“, einer Partei, einer Ideologie, und immer so weiter. […] Dabei eliminieren sie nicht nur die faktische Vielfalt, die jeden einzelnen Menschen […] kennzeichnet […]. Sie reduzieren auch Sympathie und Solidarität auf die Zustimmung zu nur einem oder einigen wenigen Aspekten einer Identität.
Jörg Scheller, Identität im Zwielicht, S. 43
Vor der Einordnung der Umwelt in Kategorien ist niemand gefeit; Gesellschaften brauchen Zuweisungen sogar, funktionieren sie doch nach gewissen Kriterien der psychologischen und sozialen Erwartbarkeit. Identitätskategorien sind somit wichtige Orientierungshilfen für uns. Doch das Spannungsfeld der Identitätszuschreibungen, in dem wir uns bewegen, ist groß und wir sollten aufmerksam und selbstkritisch jedes reflexhafte Einordnen unserer Mitmenschen in Gruppen hinterfragen. Denn:
Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich beschreibend feststelle: Viele ältere weiße Männer wählen die AFD. Oder ob ich insinuiere: Sie sind ein alter weißer Mann und neigen deshalb vermutlich der AFD zu.
Jörg Scheller, Identität im Zwielicht, S. 40
Scheller unterscheidet daher zwischen einer gesellschaftspolitisch absolut sinnvollen deskriptiven Identitätsanalyse als Maßstab auch unseres politischen Handelns, und einer gefährlichen präskriptiven und moralisch vereinnahmenden Identitätszuschreibung.
Uneinigkeit und Verwirrung besteht heute auch im Verhältnis der Identitätspolitik zum überzeitlichen Universalismus Kants sowie zur Theorie der Postmoderne. Während sich letztere zeitgebunden versteht und ein Denken in Relationen praktiziert, worin eine Schnittstelle mit aktuellen Identitätstheorien liegt, unterscheidet sie sich von diesen jedoch radikal in Bezug auf den für die postmoderne Dekonstruktion jeglicher fester Identitäten geradezu unmöglichen Begriff der „Authentizität“ konkreter Identitäten, der in gegenwärtigen identitätspolitischen Diskursen eine wichtige, wenngleich nicht unumstrittene Rolle spielt.
Eine weitere im Zwielicht der Identitätspolitik lauernde Gefahr sieht der Essayist in der nicht nur, aber auch im Zuge des Authentizitätsdiskurses oft folgenden Klassifizierung und Absolutsetzung einzelner Identitätsmerkmale, die einen mythologisierenden Rückfall ins Klischee zur Folge hat. Wie sich verschiedene identitätstheoretische Ansätze in ihrer praktischen Umsetzung ineinander verstricken können, illustriert übrigens die auch von Scheller mehrfach zitierte Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal in ihrem Roman Identitti großartig, mit viel Scharfsinn und Humor, indem sie die Komplexität von Identitäten und das Zwielicht, das Scheller essayistisch auslotet, literarisch bis in die kleinsten Schattenwürfe ausleuchtet.
Auch dem changierenden Spannungsverhältnis von Autonomie und Macht, welches das Mit- und Gegeneinander der Identitäten bestimmt, geht der Essayist auf den Grund. Identitätspolitik ist auch ein Kampf um die Autonomie der (Selbst)Bezeichnungen, der Prozess des Identifizierens impliziert den uralten, magischen Machtgestus der Benennung. Daher verwundert es nicht, dass sich so viele Debatten um scheinbar banale Ausdrücke und Bezeichnungen drehen. Den identitätspolitischen Selbstbezeichnungen voraus gehen oft bereits existierende abwertende Identitätskonstrukte und Gruppenbezeichnungen von außen, sei es in Form von diskriminierenden Gesetzen oder Situationen im alltäglichen gesellschaftlichen Umgang. Autonom, also für sich selbst zu sprechen und zu handeln, ist in diesem Sinne ein klar liberaler identitätspolitischer Ansatz. Wenn sich eine so verstandene Identitätspolitik jedoch nicht auf Individuen, sondern auf Gruppen bezieht und diese über den Einzelnen stellt, entfernt sie sich vom liberalen Denken und wird anfällig für die Kettenreaktion der Macht:
Die einen bilden Gruppen, um Macht zu erlangen, die anderen bilden Gruppen, um Macht zu bewahren; beide nutzen dieselben Methoden mit unterschiedlichen Zielen; beider Handeln führt dazu, dass Partikulares die Debatte prägt.
Jörg Scheller, Identität im Zwielicht, S. 72
Die Isolierung einzelner Identitätsaspekte und ihre moralische Essentialisierung und Überhöhung hat sich längst auch der sehr erfolgreich im Zwielicht der Identitätspolitik agierende Markt zunutze gemacht. All die fragmentierten Identitätskategorien lassen sich wunderbar zur Ware machen, mit der freilich profitorientierten Zielgruppenorientierung ist das „Targeting“ zur angesagten Kulturtechnik geworden.
Es gilt also aufzupassen, dass aus einem strategischen Essentialismus, der als Durchgangsstadium der Identitätspolitik durchaus angebracht sein kann, nicht schleichend ein habitueller wird, dass man weder die Lebenspraxis aus dem Blick verliert noch das analytische Denken, das einem vor dem Abgleiten ins Partikularistische-Ideologische bewahrt, dass man skeptisch bleibt angesichts institutionalisierender und bürokratisierender Tendenzen, die schnell mit einer reduktionistischen Vereinfachung einhergehen können, und angesichts einer Vereinnahmung durch sich mit Hingabe weiß waschende Unternehmen oder Plattformen, die oft geradezu plakativ mit ihrer Diversität werben, um hinter diesem Deckmäntelchen so manche Ungleichheit besser vertuschen zu können.
Um den Opportunismus der Identitätsökonomie ebenso wie auch die vereinnahmenden Tendenzen verschiedener Identitätspolitiken zu durchschauen und zu konterkarieren, wirft man daher mit dem Autor, der in der Form des Essays elegant die Sphären der Politik und der Kunst zueinanderbringen kann, am besten einen ästhetischen Blick auf all die nebeneinander existierenden und miteinander rivalisierenden Identitäten. Scheller plädiert für eine spielerische, imaginationsreiche Offenheit, die er durch eine Gegenüberstellung der klaren Konturen im Klassizismus Jacques-Louis Davids mit den verschwommenen, fluiden Ansichten William Turners veranschaulicht, in dessen Werk er der schillernden Komplexität der wandelbaren Wahrnehmung mehr Rechnung getragen sieht. In diesem Sinne erscheinen auch Prozesse einer so genannten kulturellen Aneignung, zumal der Begriff des Eigentums für den Bereich der Kultur mehr als fragwürdig ist, keineswegs als Anmaßung, sondern durchweg als positives, konstruktives Handeln, ist ein künstlerischer Rollenwechsel doch untrennbar mit Einfühlung und Empathie verbunden und damit der beste Nährboden für einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit dem anderen.
Jörg Scheller gelingt in seinem mit Zitaten aus einschlägigen und differenzierten Lektüren argumentativ fundierten Essay, kurzweilig und stringent sein Anliegen einer Auslotung der Motive und Schattenbereiche der heutigen Identitätspolitik unaufgeregt und zugleich engagiert zu erfüllen. Erhellend weist er seine Leser auf die Fallstricke hin, die hinter den oft berechtigten Anliegen lauern, wenn die Forderung nach Autonomie und Chancengleichheit umkippt in eine Konkurrenzsituation verschiedener Gruppen oder Opferkategorien oder wenn Fluides behördlich oder geschäftstüchtig festgenagelt werden soll. Und immer bleibt sein Blick auf das Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft gerichtet, einer Gesellschaft, die sich letztlich aus so vielen Identitäten zusammensetzt, wie es Menschen gibt.
Bibliographische Angaben
Jörg Scheller: Identität im Zwielicht — Perspektiven für eine offene Gesellschaft, Claudius Verlag (2021)
ISBN: 9783532628607
Bildquelle
Jörg Scheller, Identität im Zwielicht
© 2021 Claudius Verlag im Evangelischen Presseverband für Bayern e. V., München