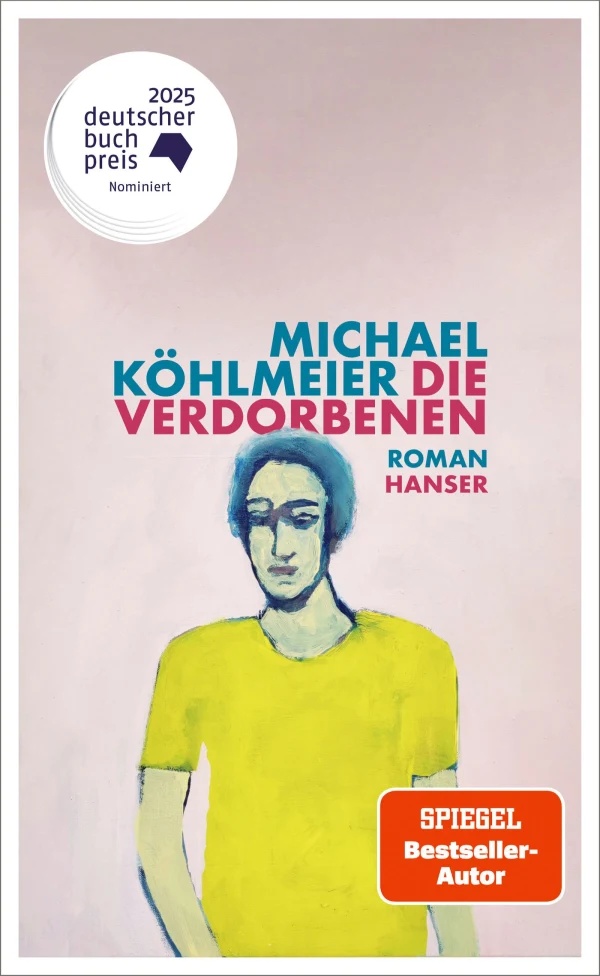„Oh rose, thou art sick!“ besingt William Blake in seinen Songs of Innocence and Experience eine kranke, zerstörerische Liebe, und eine solche bildet auch den philosophischen Kern des Romans von Michael Köhlmeier. Dass Köhlmeier seinem Text Verse des zu Lebzeiten verfemten Dichters, Künstlers und Mystikers aus dem frühen 19. Jahrhundert voranstellt, der in seinem Werk auf gesellschafts- und religionssatirische Weise über das Böse nachdachte, über das Satanische, über Schuld und Unschuld, über die weltverneinende Unterdrückung von Begehren und Sinnlichkeit, wundert einen nur kurz, wenn man den sprachlich so unschuldig daherkommenden Roman aufschlägt. In seiner Kürze und Schörkellosigkeit hat dieser es nämlich in sich, enthält er ein philosophisches Skandalon, das sich im Laufe der Lektüre, deren Nachwirkung unmittelbar einzusetzen beginnt, auf beunruhigende Weise entfaltet.
Mit dem Ich-Erzähler Johann hat Köhlmeier eine Erzählinstanz geschaffen, die für sich schon beunruhigend ist. Johann erzählt im Rückblick hauptsächlich von seiner Zeit als Student, von dem Lebensabschnitt also, in dem sich der Held eines klassischen Bildungsromans in einem Prozess der Reife zu einem verantwortungsvollen Subjekt entwickelt, in der es, auch unter heutigen lebensweltlichen Vorstellungen, darum geht, sich, durchaus unter Anstrengungen und einem Einsatz, der ein Scheitern nicht ausschließt, ein eigenes Leben mit dauerhaften Beziehungen aufzubauen. Genau dazu scheint der Protagonist von Die Verdorbenen, der sich in einer Selbstbetrachtung von außen einmal selbst als „eigenartig“ bezeichnet, jedoch unfähig zu sein. Er wirkt seltsam gefühl- und teilnahmslos, wenngleich in einer Weise, in der es nicht sofort nach außen hin auffällt. Als Erzähler wie im Leben ist diese Figur, deren Handeln und Nichthandeln man gebannt folgt, obwohl man sich immer wieder von ihr distanzieren will, mehr beobachtend als erlebend. Johann ist ein Experimentator der Liebe, der Emotionen, die er selbst nicht spüren kann oder will. Und die er nach außen hin, und weniger erfolgreich auch sich selbst gegenüber, doch immer wieder vorgibt zu empfinden. Er geht maskiert durch sein Leben, trägt eine Larve, wie man es früher nannte, mit all ihren Assoziationen von Verstellung, Täuschung und Zersetzung.
Der Text spielt mit der Unklarheit, ob diese Figur, tief verborgen in ihrem Inneren, doch etwas antreibt oder ob sie sich nur treiben lässt. Als Johann sechs Jahre alt ist, fragt ihn sein Vater nach seinem Lebenswunsch. Radikal und auf unheimliche Weise banal erscheint die Antwort, die er nicht seinem Vater, der sie vielleicht gar nicht hören will, wohl aber sich selbst und uns Lesern gibt: einmal im Leben einen Mann zu töten. Einen Mann, heißt es im Text, nicht einen Menschen — ist diese Fantasie vielleicht nur ein infantiler Abklatsch jahrhundertealter Männlichkeitsvorstellungen, vorauseilende Erfüllung einer erwarteten Rolle? Ein Muster, das sich in seinem Handeln übrigens später noch öfter wiederholen wird. Die Gewalt darin ist trotzdem nicht zu leugnen. Und ebensowenig zu leugnen ist, dass dieser Wunsch heimlich Johanns Leben bestimmt, wenn auch, in der Art einer permanent unterdrückten Revolte, eines am Aufflammen gehinderten gewaltsamen Begehrens, auf eher passive, reaktive Weise. So trifft Johann all seine Lebensentscheidungen in der Folge äußerer Impulse. Als sein Vater ihn etwa fragt, ob er jemanden habe, reagiert Johann mit einer Lüge und ist sofort beflissen, diese Lüge wahr zu machen, indem er in die Beziehung mit Christiane hineinstolpert. Christiane, die sein Tutorium besucht, ist dem Erzähler nicht besonders aufgefallen, einzig dadurch, dass sie mit einem anderen Studenten, Tommi, unzertrennlich scheint. Die beiden sind, wie Johann erfährt, schon seit Kindertagen ein Paar. In diese Konstellation wird Johann nun hineingezogen, eine seltsame, leicht morbide Dreiecksbeziehung entsteht. Die Verdorbenheit, die dem Paar unter der sichtbaren Oberfläche schon innegewohnt hatte, überträgt sich auf Johann, der als Mann ohne Eigenschaften, als unbeschriebenes Blatt die Tinte aufsaugt, mit der er beschrieben wird, auch wenn sie schwarz und verletzend ist. Verdorben ist diese Dreieckskonstellation nicht wegen der Unschicklichkeit einer offenen Liebesbeziehung, die hier keine Rolle spielt, sondern weil es eben gerade keine Offenheit und keine Liebe in ihr gibt, sondern nur Lieb- und Achtlosigkeit.
Dieser Dreiecksbeziehung vorgelagert ist ein anderes Dreieck, wie Dreiecke überhaupt auffällig den Roman durchziehen: das des Kindes in Beziehung zu seinen Eltern. Auch in dieser scheinbar so natürlichen und grundlegenden Konstellation von Vater, Mutter und Kind liegt etwas im Argen. In Johanns Erinnerung verhalten sich seine Eltern ihrem Kind gegenüber widersprüchlich. Mal sind sie voller Liebe, voller Besorgnis auch um den fiebernden vierjährigen Sohn, dessen Kampf mit dem Tod vom Vater später fast mythisch aufgeladen wird, während Johann selbst keinerlei Erinnerung mehr daran hat; dann wieder schließen sie ihren Sohn aus ihrer Beziehung aus, sind in Johanns Empfindung ein sich selbst voll und ganz genügendes Paar, das den Sohn zum Voyeur macht, der sie in ihrer Zweisamkeit heimlich beobachtet und belauscht, wie sie über ihn sprechen.
Dem Text geht es aber weniger um eine tiefenpsychologische Analyse, die das Verhalten Johanns erklärbar macht, als um einen philosophischen Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen. Am Beispiel der Eltern und auch am Beispiel des Dreiecks von Johann, Christiane und Tommi zeigt sich die Monadenhaftigkeit der Figuren und der wechselnden Figurenpaare. Monadisch im Sinne von Kant, der darunter nichts Göttliches verstand, sondern seelenlose, raumerfüllende Sphären mit anziehender und abstoßender Kraft. Und doch spielt das Metaphysische immer wieder mit hinein. Vom Dreieck auf die Dreifaltigkeit zu schließen, das legt der Text mit seiner Evozierung von Verdorbenheit, von Schuld und Unschuld, durchaus nahe. Es taucht sogar das Kreuz als Dingsymbol auf, hängt bei Tommi und Christiane im Zimmer, wird im Laufe der Geschichte aufgehängt, abgehängt, blasphemiert, verteidigt, gestohlen. Doch wie bei dem eingangs zitierten William Blake ist das christliche Kreuz in einem unverhohlen satirischen Kontext kein Garant von Liebe und Trost. Angebetet wird eher Satan, das Böse. Das Böse, das sich so banal als Gleichgültigkeit gegenüber sich selbst und den anderen manifestiert. Schuld, so heißt es in den ersten Zeilen des Romans, bestehe darin, „nicht zu wissen, was man den anderen antut“. (Köhlmeier, Die Verdorbenen, S. 9):
Ich verließ das Haus meiner Eltern wie der verlorene Sohn, von dem sie nicht einmal wussten, dass er verloren war.
Köhlmeier, Die Verdorbenen, S. 102
Die Schuld der Eltern ist das Nichtwissen, das Nichtzuhören, das Nichtnachfragen, das ein Desinteresse verrät, das in den Kindern unsichtbare Wunden schlägt und das sie gleichfalls zu Gleichgültigen werden lässt.
Ein weiteres wichtiges Motiv in diesem Roman ist die Langeweile, die eine explosive Leere enthält, die zu einem Reservoir für gewaltsame Energien werden kann. Die Verdorbenen ist ein philosophischer Roman mit kriminalistischem Einschlag, der an André Gides Les Caves du Vatican oder auch an Patricia Highsmiths The talented Mr. Ripley erinnert. André Gide schuf mit seiner Figur des Lafcadio die literarische Verkörperung einer spontanen, unmotivierten, gewaltsamen Handlung, den „acte gratuit“, der später auch von Sartre und Camus unter dem philosophischen Blickwinkel des Absurden aufgegriffen wurde. In Köhlmeiers Text manifestiert sich die Gewalt, die in den zwischenmenschlichen Beziehungen von Beginn an angelegt ist, am Ende physisch sichtbar gleich zweimal hintereinander, auf eine Weise, die nach außen und nach konventionellen Maßstäben betrachtet höchst absurd anmutet. Erinnert wird man auch an Sartres existentialistischen Roman La Nausée, dessen Protagonist Antoine Roquentin an einer Freiheit leidet, die dem Tod ähnelt.
Über den metaphysischen und philosophischen Fragen, die Köhlmeiers Text aufwirft, darf man die gesellschaftskritischen und satirischen Elemente nicht übersehen. Der Zeitbezug ist behutsam aber eindeutig markiert, Johann ist Teil des westdeutschen Studentenlebens der 1970er Jahre, auch auf die Watergate-Affäre wird angespielt, wieder eine Täuschung, allerdings mit ungleich weitreichenderer politischer Dimension. Und dann ist da noch das Geld. Das wieder zu André Gide und einem anderen seiner Romane führen würde, den Faux-Monnayeurs (1925), in denen es um Aufrichtigkeit und Fälschung geht. Geld dominiert in Köhlmeiers ein Jahrhundert später erschienenem Text heimlich alles Handeln und verursacht so einige Verwerfungen. Am Anfang war das Geld oder nicht genug Geld: „Mittendrin stand ich ohne Geld da.“, heißt es auf der ersten Seite des Romans. Bald danach hat Johann ein Auskommen durch gleich drei verschiedene Jobs, später nimmt er sich das Geld auch ungefragt.
Geld zu verdienen, oder besser, sich Geld anzueignen, das mag dem Protagonisten gelingen, eine humanistische Bildung seines Charakters aber erweist sich als unmöglich. Freundschaft, Liebe, Familie, in all diesen sozialen Gefügen scheitert Johann. Und das einzige Mal, dass er zu einem anderen Menschen ein Gefühl entwickelt, dass eine Beziehung in den Bereich des Möglichen rückt, die auf gegenseitigem Zuhören und Zuwendung beruhen könnte, lässt er es nicht zu, dass daraus eine „Geschichte“ wird. Er ergreift die Flucht, wie so oft.
In die Struktur unseres durch und durch ökonomisierten Lebens sind, so veranschaulicht es der Lebenslauf des Ich-Erzählers, Amoralität, Verstellung, Beziehungsunfähigkeit und -losigkeit tief und weitestgehend unhinterfragt eingeschrieben.
Bibliographische Angaben
Michael Köhlmeier: Die Verdorbenen, Hanser 2025
ISBN: 9783446282506
Bildquelle
Michael Köhlmeier, Die Verdorbenen
© 2025 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München