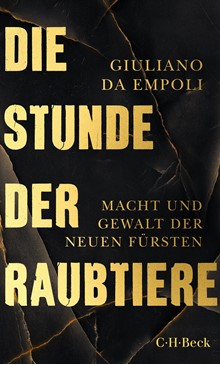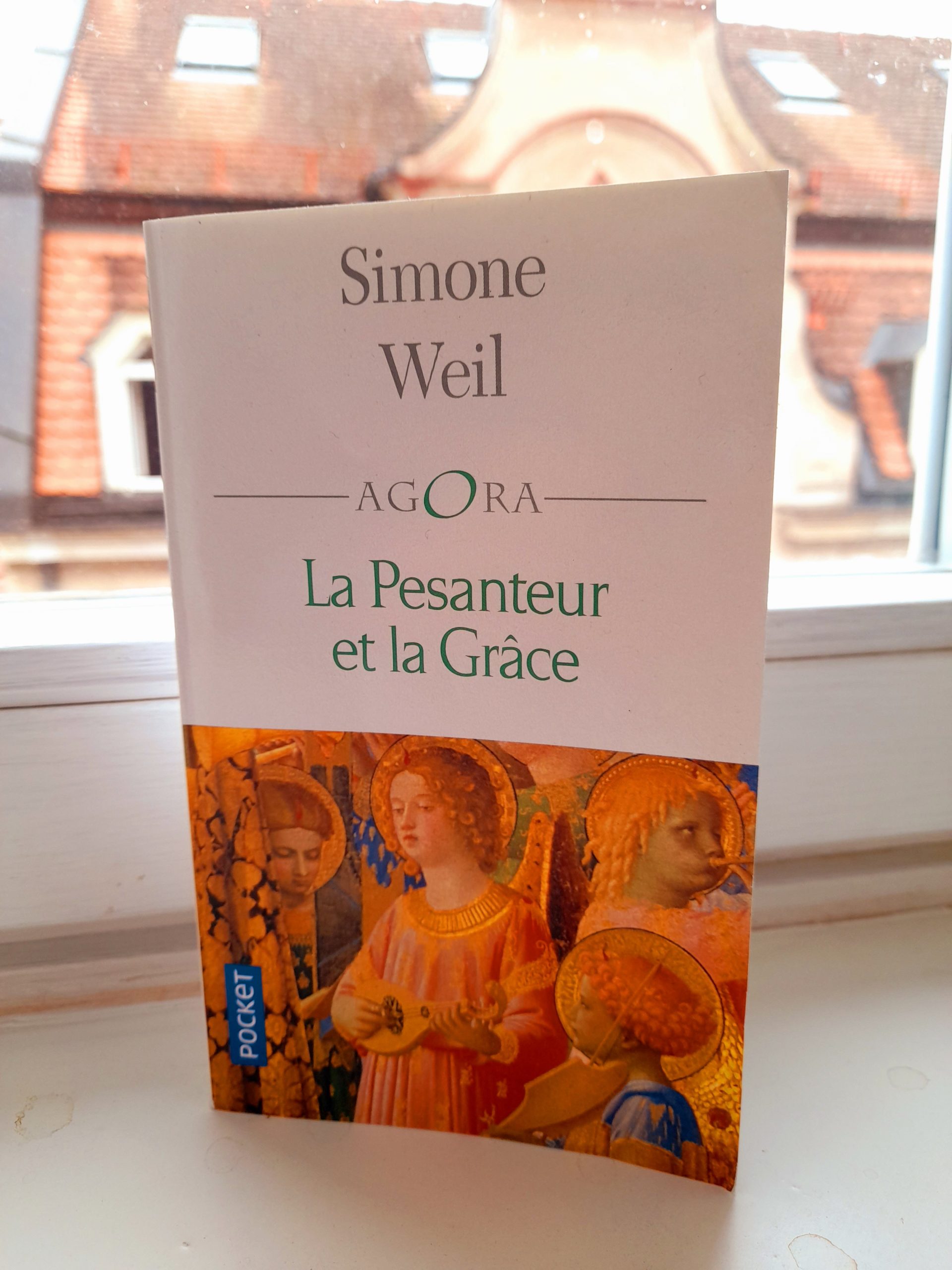Was für eine Gefahr von einer Welt ausgeht, in der nicht mehr gelesen wird! Dass der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten demonstrativ jede Lektüre verweigert, hält der Politikwissenschaftler und Journalist Giuliano da Empoli als symptomatisch für unsere Gegenwart, in der autokratische Figuren und Systeme weltweit wieder an Macht und Einfluss gewinnen. In seiner so kurzweiligen wie erschreckend illusionslosen politischen Gegenwartsanalyse, Die Stunde der Raubtiere, zeigt er, wie aufklärend es hingegen sein kann, zu lesen und wiederzulesen, für diesen Essay etwa besonders eingehend Kafka und Machiavelli.
Giuliano da Empoli ist nicht nur ein Theoretiker, sondern hat in seinem Leben, unter anderem als Berater des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, schon einiges an praktischer politischer Erfahrung sammeln können. Daraus schöpft er auch in diesem neuen Buch, in dem er uns Leser in Momentaufnahmen in die Welt der sichtbaren und unsichtbaren Mächtigen eintauchen lässt. Anders als sein letztes Buch über einen Berater Putins, Der Magier im Kreml, das inzwischen, mit einem Drehbuch des Goncourt-Preisträgers Emmanuel Carrère, verfilmt wurde, ist Die Stunde der Raubtiere kein wenn auch noch so nah an der Wirklichkeit entlang geschriebener Roman, sondern ein mit politikwissenschaftlichen, gesellschaftsanalytischen und philosophischen Überlegungen verknüpfter Erfahrungsbericht, in denen der Autor in mehreren Kapiteln verschiedene Stationen seiner Reisen durch die Welt der Mächtigen Revue passieren lässt. Vom Weißen Haus über Saudi-Arabien bis ins Silicon Valley war er an Situationen beteiligt, hatte er Einblick in Gespräche, in Konferenzen, die er als augenöffnend erlebt hat. Doch die Analyse von Macht, der Einfluss von scheinbaren Nebenfiguren auf dem Spielbrett der Mächtigen spielen auch in diesem neuen Text eine zentrale Rolle.
Die Form des literarischen Essays ermöglicht dem Autor eine freie, subjektive Herangehensweise an seine politische Analyse, die trotzdem niemals willkürlich wirkt und die, von der kleinen Situation, dem fast übersehenen Detail ausgehend und es entfaltend, einen umfassenden Blick auf unsere Gegenwart anstrebt, so dass man stets einen roten Faden ausmachen kann, der sich in vielen Schleifen und Kräuselungen stringent durch den Text zieht. Die essayistische Überwindung von Form- und Zeitgrenzen lässt Giuliano da Empoli aus der jahrhundertelangen Literatur- und Kulturgeschichte ebenso wie aus der Gesellschaftstheorie schöpfen und mit Metaphern arbeiten wie der von der Blutrünstigkeit der Raubtiere, deren Stunde — wieder einmal — geschlagen hat. Kafkas Prozess liest der Essayist Da Empoli als Antizipationsroman einer von Künstlicher Intelligenz durchdrungenen Welt, und im Rückgriff auf Machiavellis Traktat Il Principe, den dieser zu Beginn des 16. Jahrhunderts verfasste, arbeitet er Merkmale und begünstigende Kontexte eines gewissen wiederkehrenden Machttypus heraus: Machiavelli hatte beim Schreiben die historische Figur des Cesare Borgia vor Augen, einen skrupellosen Machtpolitiker, der keine Grausamkeit scheute, um seine Ziele zu erreichen. So wie dieser in der chaotischen politischen Lage der italienischen Kleinstaaten mit seinen brutalen Methoden triumphieren konnte, taten es ihm im Verlauf der Geschichte immer wieder andere gleich, von instabilen Krisenzeiten emporgetragene „Borgianer“, wie sie Da Empoli nennt, die ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Vor-Sicht die Gunst der unruhigen Stunde nutzen, durch eine interruptive Methode gewaltsamen Vorpreschens vor unseren verwunderten, schockstarren Augen mehr oder weniger unbehelligt ihre Macht zu etablieren.
Wieder einmal hat die Stunde der Raubtiere geschlagen, das ist der Anlass dieses Essays, der uns die Gegenwart und die Perspektive auf die Zukunft als einen gefährlichen Abgrund vorführt. Doch zeigen sich diese Raubtiere heute in verwandelter Gestalt, mit anderen Fallstricken bewaffnet. In der zweiten Hälfte seines Essays geht Giuliano da Empoli daher auch ausführlich auf die — mit einiger Berechtigung in diese metaphorisch aufgeladene düstere Begrifflichkeit gehüllten — Tech-Lords ein, in denen er die perfidesten und einflussreichsten Borgianer der heutigen Zeit sieht, ebenso wie er in der Technik der Künstlichen Intelligenz aufgrund ihrer Undurchschaubarkeit die größte Gefahr einer gar nicht so fernen Zukunft sieht. So wie die smarten Brillen von Meta, die schon auf dem Markt sind, jedem, der sie trägt, eine eigene Realität vorspiegeln, koppeln wir uns durch eine solche unhinterfragte Anwendung von KI immer mehr von der gemeinsamen politischen Wirklichkeit ab, verwandeln uns von mitdenkenden Individuen zu manipulierbaren Datensätzen, an die wir jede Verantwortung abgeben und die dann in undurchsichtiger und völlig verantwortungsloser Weise die Geschicke der Welt bestimmen:
Niemand weiß, wer die Entscheidungen trifft, das wissen nicht einmal die Entwickler. Das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis – der Erfolg […] – vollkommen gleichgültig, wie man ihn errungen hat. Intransparent, undemokratisch ist die Macht der KI und damit hochgefährlich.
Giuliano da Empoli, Die Stunde der Raubtiere
Es ist ein scharfer Blick, der den Analysen von Giuliano da Empoli hier zugrunde liegt, die in ihrer Hellsichtigkeit ganz schön düstere Aussichten offenbaren. Das gegenwärtige Auftrumpfen von Autokraten, die weltweit wie Pilze aus dem Boden schießen, die vom Chaos profitieren und es herrschaftstauglich machen, hat eine Eigendynamik bekommen, die kaum aufzuhalten ist, während das, was zuvor für Ordnung und Orientierung sorgte, unabhängige Institutionen, Menschenrechte, Diplomatie, wert- und machtlos werden, keine Rolle mehr spielen. Was zählt, ist die blinde Aktion, das schnelle, überraschende, rücksichtslose Handeln ohne jede Voraussicht. Überlegen, Planen, Denken, Wissen, fundierte Kenntnisse sind, wie da Empoli schreibt, hingegen „deren schlimmster Feind“. Denn Borgianer sind
Organismen mit besonders guter Anpassung an turbulente Phasen, in denen ein politisches System mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert wird und wo Unsicherheit und Gefahr nur mit Schnelligkeit und Gewalt zu begegnen ist.
Giuliano da Empoli, Die Stunde der Raubtiere
Da Empoli hat keinen Ratgeber geschrieben und hält keine bei dieser Analyse auch nur naiv wirkende Utopie bereit. Trotzdem kann, wer das Buch nicht durch smarte Brillengläser konsumiert, sondern es wirklich liest, kleine, unsicher flackernde Lichtblicke aufscheinen sehen, die einen Weg aus der brutalen Logik der Raubtiere weisen könnten. So hat der Essay auf jeden Fall ein aufklärerisches Anliegen — sapere aude –, indem er uns einige gedankliche Anreize gibt. Wir sollen erkennen, was die Raubtiere so mächtig macht, wovon sie sich nähren, und das ist neben dem Chaos eben gerade auch das Nicht-Wissen, das sich inmitten der digital erzeugten Informationsflut nach Lust und Laune ausbreiten kann.
Über die Berater von Donald Trump etwa, „eine außerordentlich gut an die gegenwärtige Situation angepasste Lebensform“, schreibt Da Empoli, dass sie — und nicht nur sie — sich nicht leise, wie es vereinzelt geschieht, sondern „laut und deutlich darüber entrüsten [sollten], dass er nie liest“. Hier und an vielen weiteren Stellen des Essays versteckt sich ein eindringlicher Appell an uns Leser, uns nicht vernebeln zu lassen, von den Hetzreden der Autokraten so wenig wie von den einlullenden virtuellen Realitäten der künstlichen Intelligenz. Und wie wichtig es ist, uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir mehr sind als ein manipulierbarer Datensatz, dass wir eine menschliche Spezies sind, Individuen, die in einer gemeinsamen bedrohten Wirklichkeit leben. Deshalb: legere aude!
Bibliographische Angaben
Giuliano da Empoli: Die Stunde der Raubtiere, C.H.Beck 2025
Aus dem Französischen von Michaela Meßner
ISBN: 9783406838217
Bildquelle
Giuliano da Empoli, Die Stunde der Raubtiere
© 2025 Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG, München