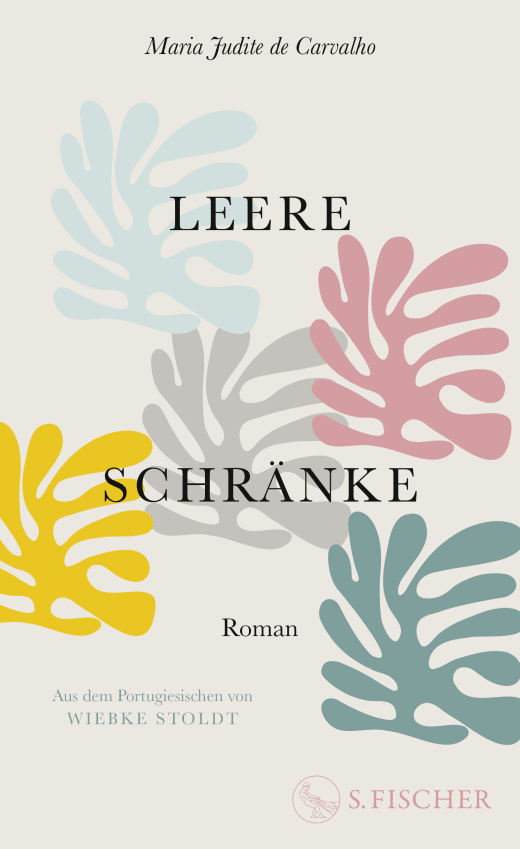Die allein im Regen zurückbleibende Erzählerin gibt ein nachhallendes melancholisches Schlussbild dieses Romans ab, der 1966 veröffentlicht wurde und in diesem Jahr zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erschienen ist. Auch wenn die portugiesische Schriftstellerin Maria Judite de Carvalho (1921–1998), die neben diesem Roman, der ihr einziger blieb, Erzählungen, Gedichte und ein Theaterstück verfasste, zu Lebzeiten vielfach für ihr Werk ausgezeichnet wurde, ist sie hierzulande noch wenig bekannt, was sich schnell ändern sollte, allein schon wegen ihres unaufgeregt-eleganten Stils, mit dem es ihr gelingt, einen immer wieder vor den Kopf zu stoßen.
Ein melancholisches Understatement durchzieht ihren Roman Leere Schränke auf mehreren Ebenen. Eine Ich-Erzählerin, deren Persönlichkeit zu Anfang ganz hinter ihrer Rolle als Zeugin und Berichterstatterin zurücktritt, erzählt Doras Geschichte, die klar im Zentrum des insgesamt schmalen Buches zu stehen scheint. Es ist die Geschichte einer Witwe, die Jahre nach dem Tod ihres Mannes erfährt, dass er sie wohl gar nie geliebt hat und seine wahre Liebe heimlich mit einer anderen Frau auslebte. Als ihre Schwiegermutter ihr etwas hinterhältig von der Untreue ihres verstorbenen Mannes erzählt, bricht für Dora ein Lebenskonstrukt zusammen. Doch wie sie nun reagiert ist ungewöhnlich, oder wird es vielleicht nur auf ungewöhnliche Weise erzählt? So lakonisch, unpathetisch, nüchtern, satirisch blitzend, dass man meint, hier sprenge eine Frauenfigur den gesellschaftlich gesetzten Rahmen, obwohl sie sich eigentlich weiterhin innerhalb dieses Rahmens bewegt, weiterhin in ihm gefangen ist, auch ohne sich in die Opferrolle zu fügen. Die Witwe Dora bleibt, trotz ihres Aufbegehrens, letztlich eine unscheinbare Person. Und genauso unscheinbar und lautlos tritt im Verlauf des Erzählens allmählich die Erzählerin selbst in den Vordergrund. Man erfährt ihren Namen, Manuela, und begreift, dass sie mit der Geschichte von Dora und deren Tochter Lisa über einen Umweg zugleich ihre eigene Geschichte des Verlassenwerdens und des Frauseins erzählt.
Doras Tochter Lisa repräsentiert in diesem Text, der, ohne historisch konkret zu werden, das patriarchalisch geprägte und autoritär regierte Portugal der Salazar-Zeit reflektiert, die jüngere Generation und ist damit ein auffälliger Gegenpol zur Figur ihrer Mutter. Lisa will gerade nicht unscheinbar sein, sie will leben, anders leben als ihre Mutter, sie will sich emanzipieren und stößt doch gleichfalls an Grenzen, die sich aber erst auf den zweiten Blick auftun. Alle Figuren, sowohl die Frauenfiguren als auch die Männerfiguren, haben im Übrigen eher einen satirischen, entlarvenden denn individuellen Charakter und geben auf diesem erzählerischen Weg indirekt Aufschluss darüber, wie das Individuelle in einem autoritären System hinter gesellschaftlichen Rollenerwartungen und Rollenbildern verschwindet. Den oft abwesenden, auffällig passiven, allesamt blassen Männerfiguren steht eine ganze Reihe von Frauenfiguren aus verschiedenen Generationen gegenüber, die trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere die gemeinsame Erfahrung machen, auf sich selbst gestellt zu sein. Alle pendeln sie auf der Schwelle zwischen Aufbegehren und Resignation, die verrückte Tante Júlia, die von ihrem Mann verlassen wurde und ihr Kind verlor, ebenso wie die kurz sich aus der grauen Witwenschaft herauswagende Dora, wie die eine pragmatische Haltung an den Tag legende Erzählerin oder die sich um neuer Ziele willen mit alten Traditionen arrangierende Lisa. Mit dem melancholischen Schlussbild im Regen betont der Roman noch einmal das Resignative, das alle Figuren durchwebt, das jedoch im Text durch einzelne provozierende Handlungen und unerwartete Äußerungen wie mit feinen Nadelstichen subtil traktiert wird.
Leere Schränke ist ein zeitloser Roman und er ist zugleich, und das ist neben der lakonisch-hintergründigen Erzählhaltung das Faszinierende an ihm, ein zwar auf den ersten Blick ganz und gar unpolitischer Roman, der aber unterschwellig eine politische Andeutungskraft entwickelt, mit der sich von den Lebens- und Geschlechterverhältnissen im Portugal der 1960er Jahre eine Brücke bis in die Gegenwart schlagen lässt. Die Art und Weise, wie hier über Geschlechterrollen und darüber hinausgehend über Wege der Emanzipation nachgedacht wird, hat, in ihrer hinterfragenden Vielschichtigkeit, die geisterfrischende Aktualität eines modernen Klassikers.
Bibliographische Angaben
Maria Judite de Carvalho: Leere Schränke [Original von 1966], S. FISCHER 2025
Aus dem Portugiesischen von Wiebke Stoldt
ISBN: 9783103976168
Bildquelle
Maria Judite de Carvalho, Leere Schränke
© 2025 S. FISCHER Verlag GmbH, Frankfurt am Main