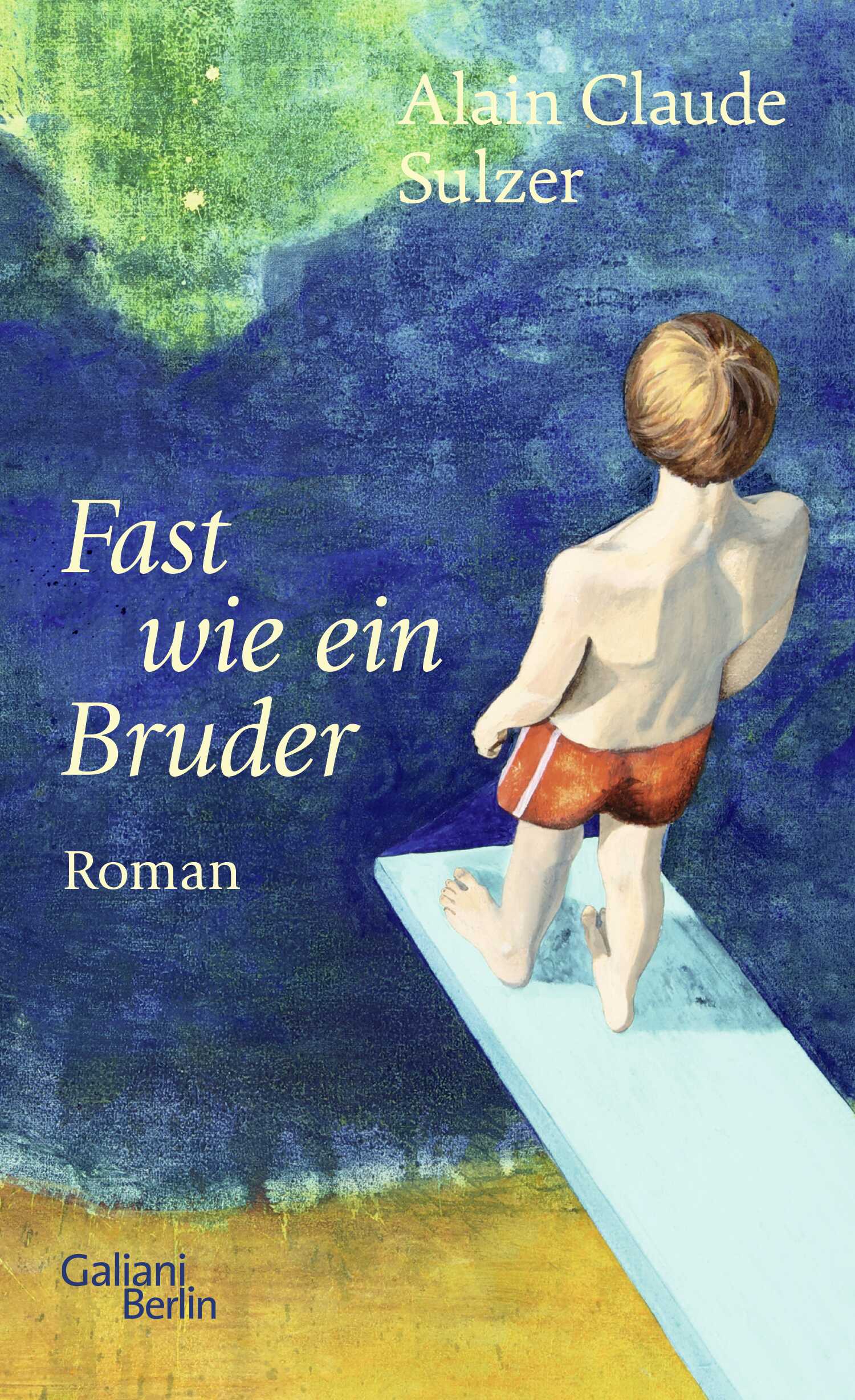Die Romane des Schweizer Schriftstellers Alain Claude Sulzer umkreisen in Variationen immer wieder ein bestimmtes Motiv, das sich mit dem Begriffspaar des Aufleuchtens und Verschwinden umreißen lässt und übrigens nicht nur die Haupt-, sondern auch die scheinbaren Nebenfiguren betrifft. Vielleicht ist es auch das, was mir an der Feder dieses Autors so gefällt: dass, ohne historische oder gesellschaftliche Machtstrukturen zu verkennen, die Hierarchie von wichtigen und weniger wichtigen Figuren ausgehebelt wird, dass Vordergrund und Hintergrund in Bewegung geraten. In Postskriptum, das von einem berühmten Schauspieler erzählt, der in unterdrückerischen Zeiten in Vergessenheit gerät, geht es um die Hinfälligkeit von Ruhm, in Unhaltbare Zustände folgt die Erzählung dem unauffälligen Leben eines Schaufensterdekorateurs, auf dessen Existenz sich für einen Moment die Scheinwerfer richten, in Doppelleben kontrastiert das doppelte Leben der Brüder Goncourt, die in ihrem berühmten Tagebuch über die Abgründe und Lächerlichkeiten der intellektuell-mondänen Kreise des 19. Jahrhunderts schreiben, mit dem Doppelleben ihrer unscheinbaren Haushälterin. Und sie bewegen sich alle im Dunstkreis der Kunst, jeder Roman hat etwas von einer kleinen Künstlerbiographie, der das Scheitern als tragisches oder vielleicht eher melancholisches Element eingeschrieben ist.
Auch in seinem jüngsten Roman Fast wie ein Bruder fällt Frank, der fast wie ein Bruder für den Erzähler ist, nicht auf, zumindest nicht zu seinen Lebzeiten und nicht für das, was er sich im Innersten wohl gewünscht hätte, nämlich für seine künstlerischen Arbeiten. Was ihn in den Augen seiner Umgebung auffällig macht, ist seine Homosexualität, die zu der Zeit, in der der Roman spielt, ein Stein des Anstoßes ist und vertuscht werden muss. Doch etliche Jahre nach seinem frühen Aidstod tauchen auf einmal Gemälde von ihm in einer Berliner Galerie auf und sorgen dort für Furore. Der verkannte Künstler erlangt postum eine plötzliche, unerwartete, aber auch namenlose Berühmtheit, denn niemand außer dem Erzähler weiß, wer diese Bilder gemalt hat. Es sind Bilder aus dem Nachlass des Künstlers, die bisher unbeachtet in einer französischen Gartenhütte verwahrt wurden, in die sie der inzwischen nach Frankreich ausgewanderte Erzähler nach dem Tod seines ehemals engsten Freundes recht achtlos untergebracht hatte. Der Raub der Werke ist für den Erzähler denn auch der Anlass zum Schreiben und Sich-Erinnern an eine Freundschaft, die im Laufe der Zeit mehr und mehr verblasste, und auch der Beginn einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Frage nach den eigenen Fehlern und Unterlassungen.
Am Anfang steht eine große Nähe. Frank und der Erzähler wachsen in den 70er Jahren im Ruhrgebiet auf, leben seit ihrer Geburt als Nachbarn im selben Haus und sind einander wie Brüder. Im Teenageralter entwickeln sie unterschiedliche Interessen, dann sterben beide Mütter kurz nacheinander an Krebs. Die Väter bleiben mit ihren Söhnen zunächst im gemeinsamen Haus wohnen, bis Frank eines Abends halbnackt mit einem Zigeunerjungen erwischt wird. Nach diesem Skandal, der alle, auch den Erzähler überfordert, kommt es zum Bruch, mit der vorurteilslosen Brüderlichkeit der beiden Nachbarsjungen ist es vorbei und auch räumlich entsteht durch den Umzug beider Familien Distanz. Frank verschlägt es nach New York, wo er in der Künstler- und Schwulenszene ein ausschweifendes Leben führt. Zwar arriviert er nicht als Künstler, kann fern von Deutschland und seinen erstickenden Moralvorstellungen aber seinen sexuellen Neigungen nachgehen. Bis er von der Krankheit eingeholt und ausgebremst wird, die damals für unzählige Schwule den so gut wie sicheren Tod bedeutete. Es ist ein grausamer Tod, ein Dahinsiechen mit dem Stigma des Aussätzigen. Zum Sterben kehrt er nach Deutschland zurück, in einem Berliner Krankenhaus sehen sich Frank und der Erzähler nach langer Zeit wieder, können ihre Kommunikation aber nicht mehr wirklich wieder aufnehmen, so dass vieles ungesagt bleibt. Der Erzähler arbeitet inzwischen als Filmkameramann, hat eine Französin geheiratet und seinen Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlagert, von wo aus er seine beruflichen Reisen in die Welt unternimmt. Er ist nicht wirklich glücklich, das Auseinanderleben, das seine früheste Freundschaft fast zur Auflösung gebracht hat, wiederholt sich auf andere Weise auch in seiner Ehe, deren Geschichte Alain Claude Sulzer in dem unaufgeregten Ton, den er so gut beherrscht, am Rande miterzählt.
Unter der Oberfläche der Handlung, die mit dem Raub der Bilder die Andeutung eines Kriminalfalls und die biographischen Werdegänge der Protagonisten verbindet, ist die Erzählung eine kontinuierliche Hinterfragung der eigenen Verantwortung des Erzählers, eine Gewissensbefragung, in der ausgehend von der Entwicklung einer Freundschaft die Entscheidungen des Lebens in neuem, mitunter sehr schmerzlichem Licht betrachtet werden.
Der Erzähler muss sich eingestehen, dass er die Arbeiten seines Freundes unterschätzt hat. Was nicht nur einem unterschiedlichen Kunstverständnis geschuldet war, sondern auch seinem mangelnden Interesse, seiner Trägheit und Unentschlossenheit. Mit bildender Kunst, auch mit Musik, für die der junge Frank früh zu schwärmen beginnt, kann der Erzähler wenig anfangen; in den frühen künstlerischen Versuchen seines Freundes sieht er nur die nicht sehr originelle Nachahmung anderer Künstler, die ja nicht selten vor Beginn der Herausbildung einer eigenen künstlerischen Handschrift steht. Spätere Arbeiten Franks kennt er kaum mehr, fragt auch nicht nach. Sein künstlerisches Interesse gilt einzig dem Film, dem bewegten Bild, das er zu seinem Beruf macht, wobei er auch hier eine gewisse Trägheit an den Tag legt. Auch wenn er wohl Talent hinter der Kamera zu haben scheint, macht er zum Großteil Werbefilme und überlässt dem Regisseur die Verantwortung für das künstlerische Ergebnis. Ist der fehlende Mut die traurige Konstante in seinem Leben? Waren ihm die bewegten Bilder der Kamerakunst ein willkommener Vorwand, nicht stehenzubleiben, nicht innezuhalten, nicht Farbe zu bekennen? Stattdessen hatte er sich der Unaufhaltsamkeit der Zeit unterworfen, der einzig die Kunst etwas entgegenzusetzen vermag.
Zeit und Kunst, so geht es auch aus diesem Roman Alain Claude Sulzers hervor, stehen in einer spannungsreichen Wechselwirkung, in der der einzelne Mensch verlorengehen kann. Denn Kunst reicht über eine Lebensspanne hinaus, wird in ihrer Bedeutung oftmals erst erkannt, wenn die Zeiten andere sind, ja die Bedeutsamkeit zeigt sich gerade im Überdauern, in der zeitlichen Enthobenheit. Für Franks Kunst war die Rezeption zu Lebzeiten noch nicht reif, vor allem war es der Erzähler nicht, der dafür erst einen Anstoß von außen und einen reflektierenden Prozess im Inneren erleben musste, den er im Schreiben wiederum nach außen trägt. Das aufleuchtende Ergebnis ist ein schöner, ein nachdenklicher Roman, der auffälligerweise weniger unaufgeregt erzählt ist als die anderen Bücher des Autors. Das mag daran liegen, dass die Erzählerstimme diesmal in der Ich-Perspektive zu uns spricht. Man spürt, wie der Erzähler mit seinen Schuldgefühlen ringt, wie angegriffen er von der Geschichte seines Freundes ist, die zu dessen Lebzeiten so wenig fertig erzählt werden konnte wie seine Kunst. Auch der Roman ist im Übrigen nicht auserzählt, ein Geheimnis bleibt am Ende, was der Überzeugungskraft der Geschichte keinen Abbruch tut, im Gegenteil.
Bibliographische Angaben
Alain Claude Sulzer: Fast wie ein Bruder, Galiani 2024
ISBN: 9783869712949
Bildquelle
Alain Claude Sulzer, Fast wie ein Bruder
© 2025 Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co KG, Köln