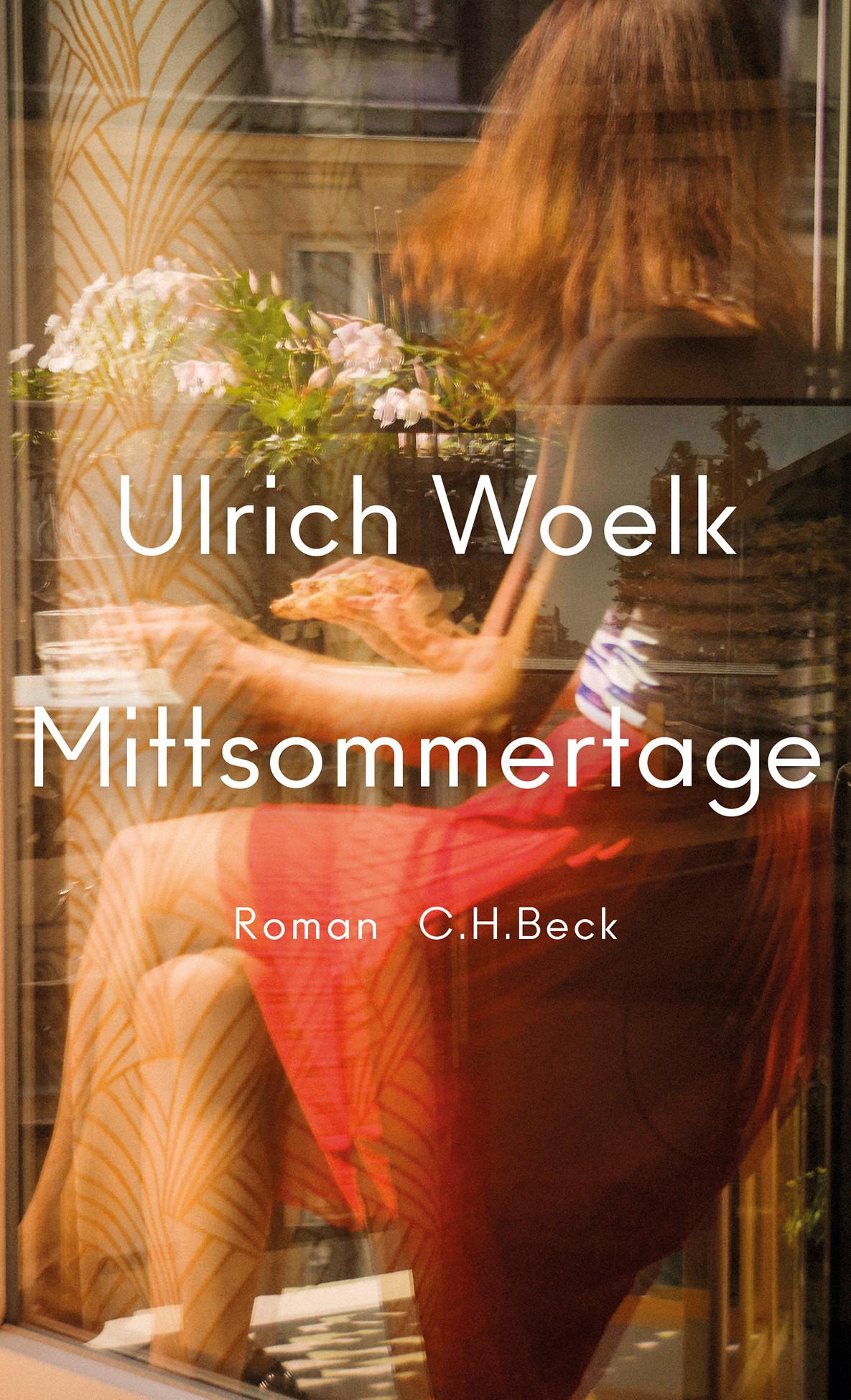Irgendwie sehr vertraut kommt sie einem vor, diese Geschichte einer modernen Liebe, einer heutigen Paarbeziehung, erzählt in den titelgebenden zehn Bildern, Momentaufnahmen aus den letzten zehn Jahren, vom Moment der ersten Begegnung von Luisa und David bis zu einer sich am Romanende in die Zukunft öffnenden Gegenwart. In jedem Kapitel, jedem Bild, jeder Szene, könnte man sagen, werden nacheinander die Perspektiven beider Liebender zur Sprache gebracht, die manchmal mehr Verzweifelnde, Bangende, Hadernde, aber fast immer auch Hoffende sind.
Der im Grunde kontingente Kernkonflikt, an dem die Paarbeziehung ins Schwanken gerät, ist der Kinderwunsch von David, in den beide, wohl zurecht, mehr hineininterpretieren als die scheinbar ganz natürliche Folge einer romantischen Beziehung. Denn mit Ronya, der Tochter von Luisa und Holger, Luisas Exmann, ist schon ein Kind in der Beziehung, ein Kind, zu dem David in behutsamer und wie selbstverständlicher Annäherung auch eine väterliche Bindung aufgebaut hat. Warum genügt ihm das nicht? Sind sie denn nicht bereits eine Familie? Soll Luisa mit einem weiteren Kind riskieren, ihre beruflichen Ambitionen wieder zurückstecken zu müssen, woran die Beziehung zu ihrem Exmann zerbrochen ist? Auch David treiben Ängste um, die seine Sehnsüchte bis zur Ununterscheidbarkeit überlagern. Wie fragil und von Verlust bedroht ist die Bindung zu einer nicht leiblichen Tochter? Hinzu kommen die Kräfte zehrenden und an der Liebe zerrenden Fertilitätsbehandlungen, all die körperlichen und psychischen Strapazen, die auf David und Luisa zukommen, als es mit einer natürlichen Schwangerschaft zunächst nicht klappen mag.
Das Kinderwunschthema ermöglicht es gut, weitere Herausforderungen und Zündstoffe einer modernen Beziehung zu verhandeln, es geht um männliche und weibliche Rollenbilder, um Mutterschaft und Arbeit, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, die Aufgabenverteilung innerhalb einer Familie, um Vaterrollen, um Elternschaft, um die Herausforderungen von Patchworkkonstellationen,…
Erzählerisch handelt es sich eigentlich weniger um Bilder, auch wenn der Autor mitunter welche heraufbeschwört, die einem eine Weile im Gedächtnis bleiben, wie zum Beispiel das der tanzenden Luisa vor griechischer Sommerurlaubskulisse, und mehr um Dialoge und Reflexionen, es geht um das Miteinandersprechen oder eben um das Verschweigen, die Hürden der Kommunikation, an der sich jede enge Beziehung auf ihre Weise abarbeiten muss, und es geht um all die Gedankenspiralen, die Erwartungen und Ängste, die in einem fortdauernden inneren Monolog, von dem nur ein Bruchteil nach außen dringt, verhandelt werden.
Auffällig und wahrscheinlich zeittypisch finde ich die (Selbst-)Reflektiertheit der Figuren, die ihre Gefühle und Sorgen wenig für sich stehen lassen, sondern nach Erklärungen, Rechtfertigungen, Einordnungen suchen, sie ins Verhältnis setzen, es als ihre innerste Verantwortung betrachten, Perspektivwechsel vorzunehmen, dann mitunter darunter leiden, wenn es ihnen schwerfällt, und überhaupt trotz ihrer starken Gefühle sehr vernünftig, sehr aufgeklärt wirken. Wenn der Roman die Möglichkeiten der Liebe in unserer Zeit auslotet, so entwirft er das Möglichkeitsbild einer Romantik der aufgeklärten Liebe.
Die Konstruktion der zehn Bilder, in denen den Perspektiven von Mann und Frau jeweils gleichberechtigt Raum gegeben wird, mag dazu verleitet haben, das irgendwie ja auch immer anarchische Thema der Liebe etwas zu thesenhaft darzustellen. Es ist wenig Platz für literarische Überraschung und Abseitigkeit. Doch berührt der Roman viele wunde Punkte unserer Gegenwart, reflektiert sie auf nachdenkliche, vielseitige Weise, und nimmt seine Figuren und ihre Nöte auf einfühlsame und doch unaufgeregte Weise ernst.
Bibliographische Angaben
Hannes Köhler: Bilder einer Liebe, Frankfurter Verlagsanstalt 2025
ISBN: 9783627003265
Bildquelle
Hannes Köhler, Bilder einer Liebe
© 2025 Frankfurter Verlagsanstalt GmbH, Frankfurt am Main