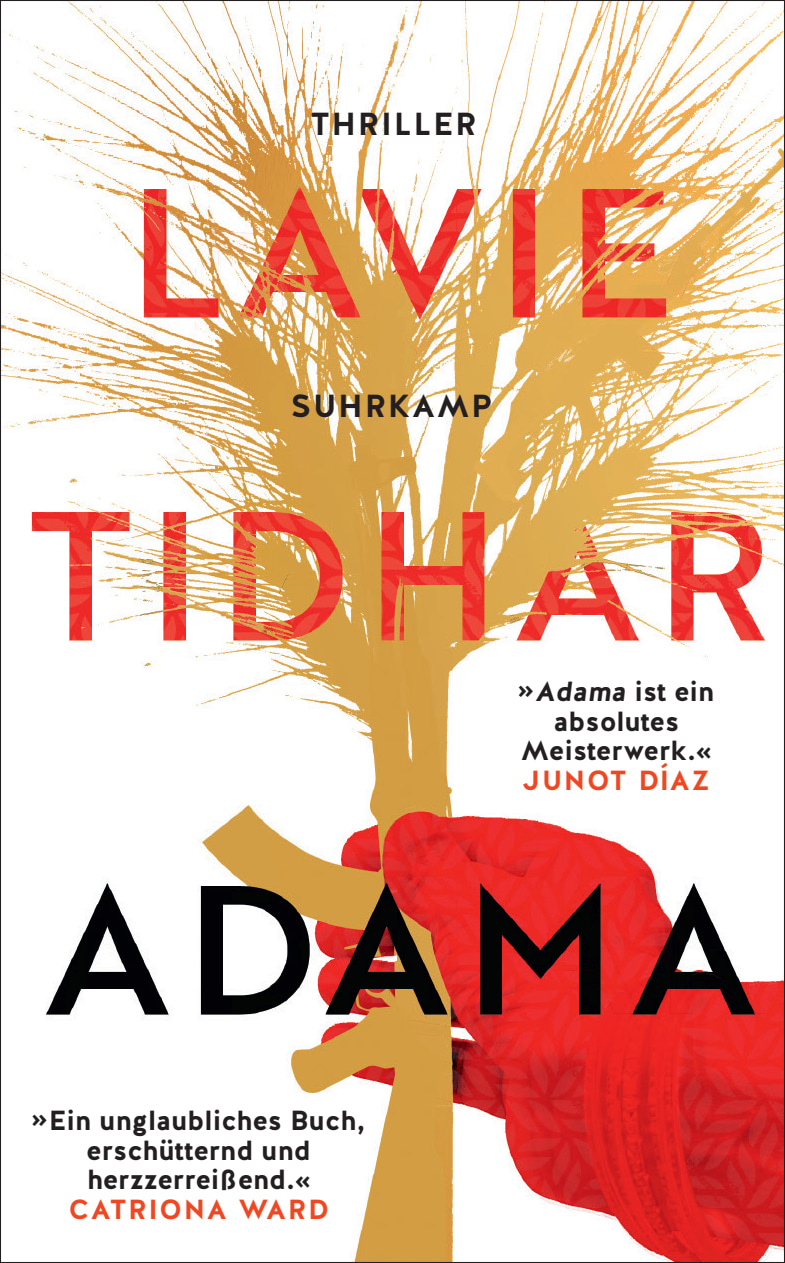Literatur vermittelt Wirklichkeit auf einer anderen Ebene, als es journalistische Nachrichten und Geschichtsbücher tun. Dennoch kann sie, wenn sie die Balance zwischen emotionaler und reflexiver Kraft hält, das Bewusstsein für eben diese Wirklichkeit mit Klingen schärfen, die tiefer in uns dringen als so manche an uns abprallende Informations- und Bilderflut. Adama, das neue Buch des israelischen Schriftstellers Lavie Tidhar, das auf den ersten Platz der Jahres-Krimibestenliste von Deutschlandfunk Kultur gewählt wurde, ist so ein Text. Adama ist ein historischer Thriller, hat mit klassischer Genreliteratur jedoch nichts zu tun, sondern ist einfach ein ungeheuer gut geschriebenes Buch, das von der ersten bis zur letzten Seite den Verstand auf Hochspannung hält.
In fast jedem der 15 Teile des Buches, aus der Perspektive verschiedener, familiär miteinander verbundener Figuren in verschiedenen historischen Augenblicken erzählt, wird man mit einem neuen Verbrechen konfrontiert, das sich in ein die Generationen übergreifendes Gewaltpanorama einfügt. Die verschiedenen Handlungsfäden mit ihren verschiedenen Perspektiven bilden ein sich Seite für Seite verdichtendes und doch locker gesponnenes Netz, das, ohne auszuufern, die Geschichte des 20. Jahrhunderts umfasst und die Komplexität einer gewaltsamen Wirklichkeit in Gestalt eines stilistisch prägnant konstruierten Erzählgewebes darzustellen vermag. Verwirrende historische Gemengelagen und scheinbare gesellschaftspolitische Absurditäten werden in Adama auf diese literarische Weise ganz anders als in einem Sachbericht durchleuchtet.
Was einen sofort in den Roman hineinzieht, sind nämlich seine mit wenigen Strichen, in wenigen Szenen so menschlich gezeichneten Figuren, in deren Ambivalenz man geradezu hineinkatapultiert wird. Es ist ein intensives Lektüreerlebnis, wenn das Menschliche, das einen zu ihnen hinzieht, fast unmerklich von einer Grausamkeit unterwandert wird, wenn die Figuren von einer Gewaltspirale erfasst werden, die übermächtig scheint. Das Paradoxe wird möglich: Man kommt den Figuren in ihrem Existentialismus ganz nah, erfährt mit ihnen die Absurdität und Intensität des Lebens, man beginnt, jede einzelne von ihnen zu mögen, mit ihr und um sie zu bangen — man versteht sie, auch wenn man vor ihrer Gewalt zurückschreckt und ihr Verhalten ablehnt. Mit den Spannungsthemen Zusammenhalt und Verrat, Idealismus und Gewalt, Gemeinschaftsdenken und Existentialismus fühlt man sich an Don Winslows Mexiko-Trilogie erinnert, in der einem ans Herz wachsende und zugleich abstoßende Figuren in eine gewaltsame Umgebung hineingeworfen sind, in der es fast keine andere Chance gibt, als diese Gewalt zu verinnerlichen. Vielleicht hat Lavie Tidhar in Adama noch eine etwas poetischere Sprache gefunden, zwischen den Dialogen und der Gewalt gibt es immer wieder auch kurze Stellen mit Naturbeschreibungen, die einen in das Land Israel versetzen, eine Atmosphäre greifbar machen, ein Sehnen, ein Flirren in der Luft.
Zeitsprünge, auch innerhalb der Kapitel, verstärken die Wirkung der gewaltsam-verwirrenden Epoche, deren Porträt Adama ist. Zweiter Weltkrieg, Palästinakrieg, Sechstagekrieg, Yom-Kippur-Krieg sind der wechselnde Hintergrund, vor dem sich die Handlungen ereignen und deren chronologische Abfolge die gut belegte Wahrheit der Geschichtsbücher ist, die mit der Wahrnehmung der Protagonisten jedoch nicht zwangsläufig übereinstimmt. In a-chronologischen Sprüngen erzählt Lavie Tidhar in Adama die Entwicklung seiner aus vier Generationen stammenden Figuren von Kindern zu jungen Erwachsenen — viel älter werden die meisten von ihnen nicht. Gewalt hat eine zersplitternde Wirkung, im physischen wie im psychischen Sinne, und bringt ethische wie rationale Maßstäbe aus dem Lot. Auch die Einheit des Ortes, wie man im Theater sagen würde, wird gesprengt. Zwar konzentriert sich ein Großteil der Handlung auf Israel, doch führen immer wieder Erzählstränge nach Europa, auch nach Amerika. Ausgehend von der „heiligen Erde“ (adama) eines sich selbst versorgenden und verteidigenden Kibbuz, in dem die Fäden der Handlung immer wieder zusammenlaufen, verlieren sie sich doch immer wieder. Flieh- und Anziehungskräfte konkurrieren miteinander, für die einen ist der Kibbuz ein Ideal, ein sicherer Hafen, anderen ein Gefängnis oder ein uneinlösbares Versprechen. Wenn das Auseinandergesprengtwerden ein oder vielleicht das zentrale Motiv des Romans ist, ist ein Erzählen in Sprüngen nur folgerichtig. Unmöglich erweist es sich jedenfalls, die Geschichte eines Landes wie Israel, sei es historisch oder räumlich, isoliert zu betrachten, und alle Landes- und Zeitgrenzen erscheinen auf die eine oder andere Weise artifiziell.
Tod und Sterben sind in Adama omnipräsent. Es gibt mehrere Sterbeszenen, die Figuren sterben durch Krankheit, Unfall, Krieg und Verbrechen, sie erleiden Gewalt — und sie fügen sie auch anderen zu, aus den verschiedensten Motiven, von denen Selbstverteidigung und Rache nur zwei Beispiele sind. Das zu lesen ist hart, aber es ist nie sensationsheischend, nie pathetisch und auch nie gefühllos. Adama rüttelt einen wach, konfrontiert einen mit dem Unbequemen, lässt einen nachdenken über Gerechtigkeit, über Rache, Selbstjustiz, Trauma und über das richtige Leben, so wie auch die Figuren keine unreflektierten Sprösslinge eines gewaltsamen Milieus sind, sondern sich selbst viele Frage stellen:
Warum musste ausgerechnet er [Lior, der einen Unfall überlebt] der einzige Überlebende sein? Und warum hatten Yael und Israel nicht allein sterben können? Sie hatten nicht das Recht gehabt, ihm so etwas anzutun, zu sterben in seiner Gegenwart und ihn zu dem zu zwingen, was er getan hatte.
Lavie Tidhar: Adama, S. 349 (12 Das Ende der Straße – Ophek – Sinai, 1976)
Oder:
Was waren Opheks [der zum Auftragsmörder wird] Verbrechen im Vergleich zu dieser alten Grausamkeit, was war er anderes als eine Fortsetzung der Geschichte, eine Zeile einer Seite, die immer und immer wieder neu geschrieben wurde?
Lavie Tidhar: Adama, S. 361 (2 Das Ende der Straße – Ophek – Sinai, 1976)
So schwarz die Schatten von Gewalt und Krieg in Adama sind, ist es kein völlig düsteres Buch, was an der bereits erwähnten die Poesie streifenden Sprache ebenso liegt wie an den Figurenzeichnungen. Hinzu kommt, dass man wie nebenbei einiges über jüdisches Leben in und außerhalb Israels erfährt, über israelische Traditionen, Feste, und über das teils utopisch, teils überholt anmutende Leben in einem Kibbuz, von der sozialistischen Organisation der Arbeitsteilung bis zum gelebten Ideal einer jüdischen Gemeinschaft, die über biologische Familienbande hinausgeht, weshalb die Kinder schon im Säuglingsalter gemeinschaftlich statt nur von den Eltern betreut werden.
Für die einen ist der Kibbuz Trashim, wie er in Adama heißt, ein Zuhause, die anderen wollen ihm entfliehen, was allerdings nur selten gelingt. Die Verwurzelung in der jüdischen (Schicksals-)Gemeinschaft ist tief, so tief wie auch die Verwurzelung in der Vergangenheit, deren Bande fast unlösbar scheinen. Einige, wie Shosh, die Schwester der ältesten Protagonistin, Ruth, die ihrerseits die überzeugteste Verteidigerin des Kibbuz ist, wandert, nachdem sie den Nationalsozialismus und den Hunger und die Grausamkeit in verschiedenen Lagern überlebt, nach Jahren ihre Schwester in Israel wiedergefunden hat, im Kibbuz ein Kind bekommen und nicht nur einen Mann verloren hat, schließlich nach Amerika aus, von wo nur noch die ein oder andere Postkarte im Kibbuz bei ihrer Tochter eintrifft, die sie zurücklassen musste.
Shosh dachte an Anna Klug, wie sie in einem Keller in Landsberg in einer Blutlache lag. Sie dachte an die Lager. Die Welt hatte eine Waffe aus ihr gemacht, aber sie konnte sich immer noch entschließen, keine zu sein, dachte sie. Sie wollte Licht, Musik und hübsche Kleider und Dinge! Sie wollte Dinge. Sie wollte einen Mann, der ihr niemals Vorträge über das ‚Proletariat‘ hielt. Sie wollte ein Kind, das ihr gehörte, nicht dem Kibbuz.
Lavie Tidhar: Adama, S. 250 (6 Die Geier – Shosh – Kibbuz Trashim, 1952)
Shosh will der Gewaltspirale entkommen, in die sie sich hineingezogen fühlt, sie will ihre Träume leben, und so wie ihr ergeht es eigentlich allen der Protagonisten. Sie haben Hoffnungen, Sehnsüchte, die radikal gebrochen werden oder aber deren Verwirklichung unendlich Kraft kostet. Einige von ihnen verkaufen ihre Seele, lassen ein Stück von sich zurück, um sie zu erfüllen. Ihnen allen wird auf die eine oder andere Weise Gewalt angetan oder sie werden zum Zeugen von Gewalt. Nicht darüber sprechen zu können, stellt sich als ein intergenerationelles Trauma heraus, das bei einigen von ihnen dazu führt, dass sie selbst anderen Gewalt antun.
Lior wollte nicht Pilot werden. Er wusste nicht, was er werden wollte. Er wollte ausholen und jemandem weh tun. Er wollte jemandem Schmerzen zufügen als Ausgleich für den Schmerz, den er empfand und über den er nicht sprechen durfte. Man musste ein Mann sein. Das Land verlangte Opfer. Ruths Stimme, Ruths Worte. Und auf ihrem Regal lauter Bilder von toten Männern.
Lavie Tidhar: Adama, S. 332 (11 Yom Kippur – Lior – Kibbuz Trashim, 1973)
Die schon erwähnte Ruth aus der ersten Generation, von der erzählt wird, überlebt fast alle Protagonisten. Sie war schon vor dem Krieg nach Palästina ausgewandert und wurde Mitgründerin des Kibbuz Trashim, um dessen Fortbestand sie ihr Leben lang, auf zugleich bewundernswerte wie furchteinflößende Weise, auch mit Mitteln der Selbstjustiz, kämpft. Eine gewisse emotionale Verhärtung scheint ihr Preis für das Überleben zu sein.
Bis auf Ruth erlebt man die allermeisten Figuren als Kinder und als ganz junge Menschen. Das macht es so hart, ihre Schicksale beim Lesen mitzuerleben, mitzuerleben etwa, wie ein kleiner aufgeweckter Junge voller Fantasie, der seinen Lebenstraum, Zauberer zu werden, mit bemerkenswerter Konsequenz verfolgt, schließlich zum Auftragsmörder wird. Es macht die Lektüre gleichzeitig aber auch so schön, wenn sie uns sprachlich verlebendigt in ihren Sehnsüchten wie in ihren Schmerzen so nahe kommen.
Momentan wirkt es wie eine Utopie, aber hoffen wir, dass irgendwann in Israel keine Kinder mehr zu hebräischen Pirschern erzogen werden, sondern Zauberer werden können.
‚Der hebräische Pirscher!‘, sagte er. ‚Klein und gefährlich, er greift nur an, wenn er sich bedroht fühlt. Seid selbst der Skorpion. Habt Mut. Wir werden diesen Krieg gewinnen, so wie alle anderen auch. Ich selbst…‘ Er schweifte ab zu einer Geschichte über den Krieg 1948. Sie hatten sie alle schon hundertmal gehört. Und auch Skorpione hatten sie alle schon hunderte gesehen. Sie wussten, dass man nicht einfach Steine umdrehen durfte, man musste sehr vorsichtig sein.
Lavie Tidhar: Adama, S. 334 (11 Yom Kippur – Lior – Kibbuz Trashim, 1973)
Bibliographische Angaben
Lavie Tidhar: Adama, Suhrkamp 2025
ISBN: 9783518475164
Bildquelle
Lavie Tidhar, Adama
© 2026 Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin