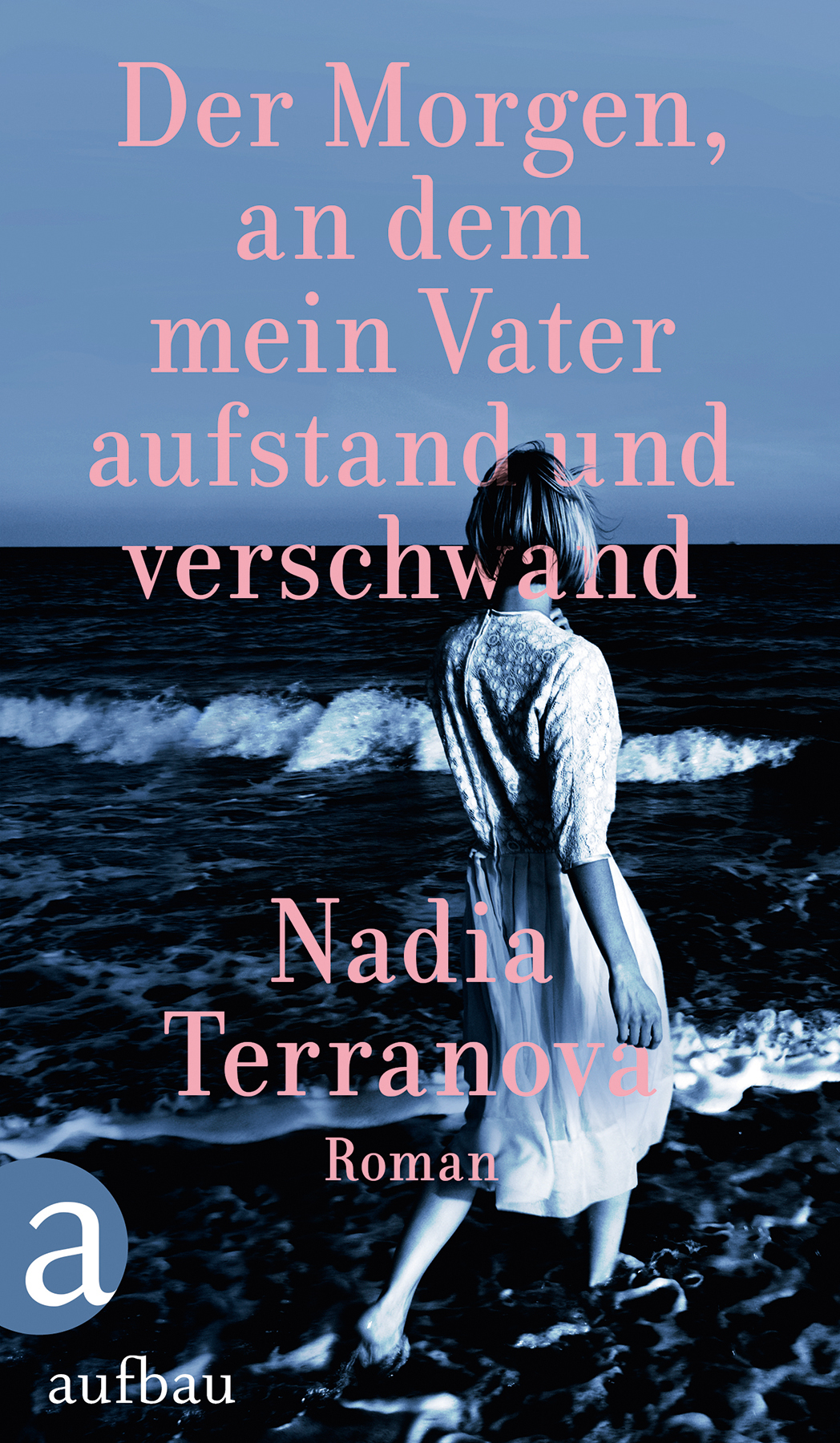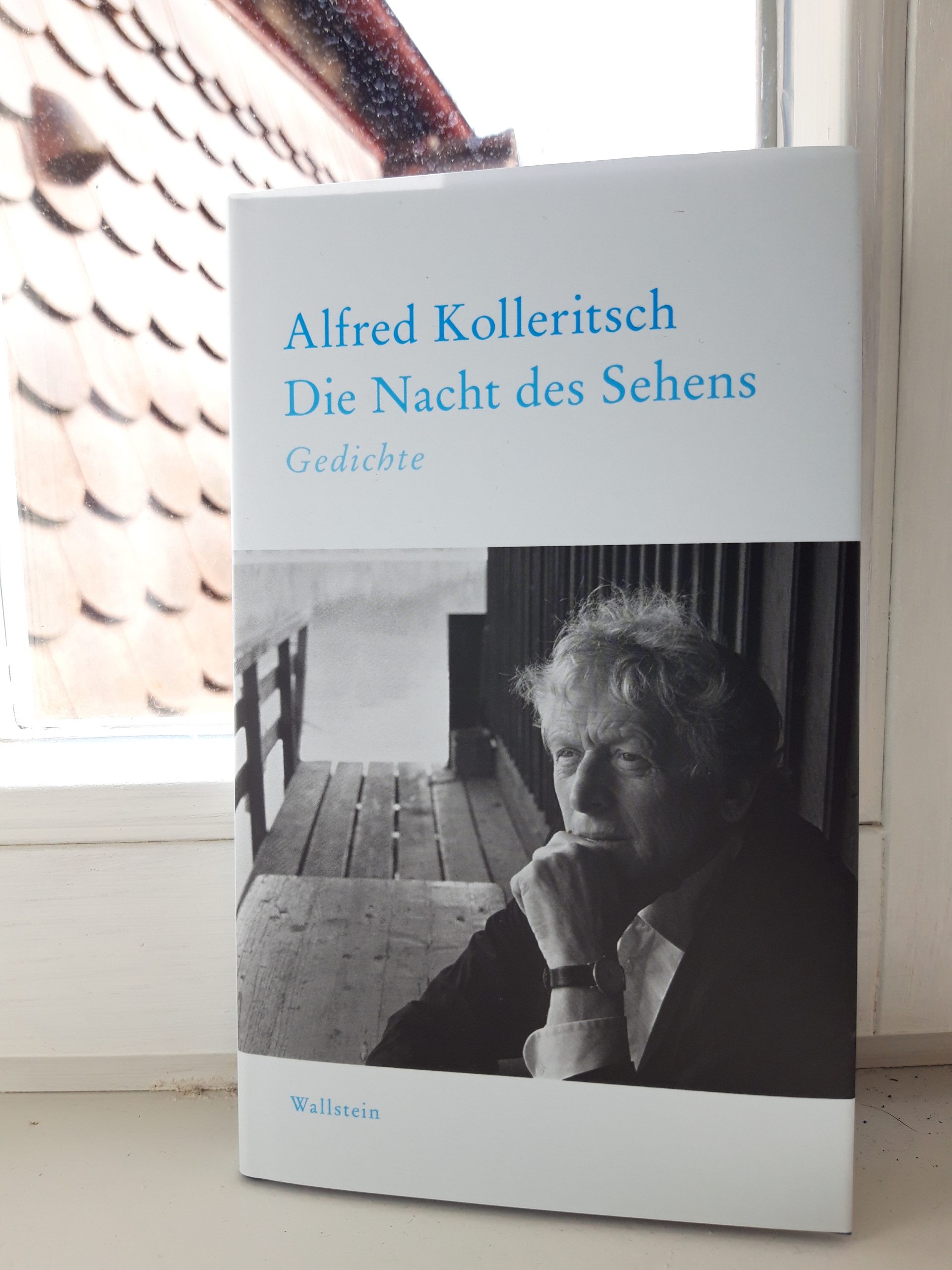Die Matutin, die ihren Ursprung in den rituellen Nachtwachen der frühen Christen hat, wird in der katholischen Liturgie in den ganz frühen Morgenstunden, im Hinübergehen von der Nacht zum Tag, gebetet. Dieses Transitorische zwischen zwei Wirklichkeits- oder vielleicht eher Wahrnehmungszuständen charakterisiert auch ganz stark den 2008 erschienenen gleichnamigen Roman der Schweizer Schriftstellerin Gertrud Leutenegger (1948-2025), die trotz einiger literarischer Auszeichnungen in der Öffentlichkeit wenig bekannt war.
Matutin ist ein stiller Roman, der ganz wunderbar von der Sprache und den sprachlich erzeugten Bildern getragen wird. Gertrud Leutenegger war auch Lyrikerin, das merkt man dem Text an, der einen auf eine Weise in Bann zieht, die man gar nicht recht begreift, und der einen Spannungsbogen schafft, der nicht von den wenigen und im Schwebezustand des Unvollendeten verbleibenden Handlungselementen abhängig ist, sondern durch eine Wiederholung, Variation und Verdichtung der Motive und Bilder entsteht. Dabei folgt der Text in einer lyrischen Prosabewegung zwei scheinbar entgegengesetzten literarischen Pfaden, denn die Bilder verleihen sowohl dem Schrecklichen der Existenz einen Ausdruck von unaufgeregter Eindringlichkeit als auch dem Alltäglichen einen nachschwingenden Zauber, der aber nichts Mystifizierendes hat.
Der ganze Roman ereignet sich in einem Raum des Dazwischen, evoziert einen Schwellen- und Schwebezustand, in dem Joseph Vogl in einem kürzlich erschienenen Essay (Meteor — Versuch über das Schwebende, C.H. Beck 2025) eine besondere Qualität des Literarischen, wie sie etwa bei Robert Musil oder Franz Kafka hervortritt, ausgemacht hat. In Leuteneggers Text ist der Turm, der auf einem Floß in der Bucht eines Sees gelegen ist, an dessen Ufern sich die Stadtkulisse mit ihren Hotels erhebt, das dinghafte Symbol für diesen Raum des Dazwischen; ein Bauwerk, das so vertraut wie unheimlich wirkt, so bedrohlich wie bedroht, scheinbar fest erbaut, und doch wandelbar. Zu Beginn des Romans wird die Erzählerin für eine vorübergehende, vergängliche, ihr vorher nicht bekannte Zeitspanne die Kustodin dieses Turmes; 30 Tage und Nächte werden es sein, die den 30 Kapiteln des Romans entsprechen. Für sie und für uns Leser ist der Eintritt in den Turm eine Rückkehr in die Innenwelt ihrer Kindheit, die sich mit der Vergangenheit des Turms zu überlagern beginnt. In Wirklichkeit nur ein Nachbau, eine Konstruktion aus Holz, dient er als eine Art Museum oder Dokumentationsstelle für das ehemalige Handwerk der Vogelfänger in der italienischen Schweiz.
Die Vogelmetaphorik überzieht in vielen Schattierungen den ganzen Roman, das Textgewebe erscheint als Vogelschwarm, der Vergangenheit und Gegenwart und auch die Figuren und Motive miteinander verbindet. Erinnerungen an eine verletzte Amsel, die sich ins Elternhaus geflüchtet hatte, und an den vogelliebenden Vater sind mit dem Motiv des Hütens und Versorgens verknüpft, während die im Turmmuseum dokumentarisch belegten Vorgehensweisen der Vogelfänger, die die Erzählerin und Turmwächterin den Besuchern nahebringen soll, von erschreckender Brutalität und Gewaltsamkeit sind: Vögel, die gejagt, gequält, getötet wurden, geblendete und malträtierte Lockvögel, Zugvögel, die sich in einem jenseits des Turms gepflanzten Baumkorridor verirren und verfangen sollten. Der Turm erscheint hier geradezu als Hort der Gewalt, als böse Täuschung eines sicheren Hafens.
In diesen hat sich auch die Erzählerin geflüchtet, wohl ahnend, dass es sich hier weniger um einen Schutzraum denn um einen Konfrontationsraum handelt, auch um einen Raum der Konzentration, im wörtlichen Sinne eines Sich-Zentrierens. So ist die Turmwächterstelle auch mit strengen Regeln verbunden, die einen religiösen, asketischen Charakter haben. Nach Einbruch der Dunkelheit ist im Turm Stillschweigen geboten, die Mahlzeiten sind frugal, jeden Tag wird die gleiche Polenta vor die Tür gestellt. Als tatsächlich ein Besucher im Turm Unterschlupf sucht, Victoria, eine junge Frau mit vermutlich südamerikanischem Akzent, die ihr gesamtes Hab und Gut in ein paar Plastiktüten mit sich trägt, werden diese Regeln immer wieder leicht gebrochen. Victoria möchte eigentlich nichts von den Vogelfängern hören, über die die Erzählerin ihre Gäste informieren soll, doch erzählt sie irgendwann ihrerseits von der blutigen Opferung eines Kondors in ihrer Heimat. Auch sie hat Dinge zu verarbeiten, auch ihre Geschichte ist die eines Exils, sie erscheint wie ein trotz seiner Stärke verletzlicher Zugvogel, der die Turmhüterin irritiert und fasziniert, und der ihr ans Herz zu wachsen beginnt.
Die Erinnerung, die bei der Erzählerin wie auch bei Victoria von der besonderen Atmosphäre des Turmes ausgelöst zu werden scheint, stellt sich als ein flüchtiger, schwebender Zustand dar, der von Andeutungen und kurz aufscheinenden Momenten des Wiedererkennens gespeist wird. Die Ich-Erzählerin meint, im Sekretär, der ihr jeden Tag die Polenta vorbeibringt, eine Person aus ihrem früheren Leben wiederzuerkennen, Victoria lässt einmal fallen, die Turmwächterin in den Hotels, in denen sie gearbeitet hat, schon gesehen zu haben. Weitere Figuren, die die Erzählerin mit ihrem früheren Leben verbindet, tauchen schemenhaft auf, der Architekt des Turmnachbaus im schwarzen Mantel, ein Mädchen, das mal mit Pagenkopf, mal mit langen Haaren draueßen vor dem Turm erscheint und ihr von unten zuwinkt. Ist es ihre Tochter, die sie in der Andeutung einer schmerzhaften Geschichte einmal erwähnt, oder ist sie es selbst als junges Mädchen? Die Figuren verschmelzen, wie alle Eindrücke der Erzählgegenwart, mit den Bildern der Erinnerung, auch Vögel und Menschen werden ununterscheidbar, Zugvögel und Migranten, unerschütterlich bleibt vielleicht nur die Erfahrung des Exils.
Dass dieser Roman einen wie ein luftiges Seidentuch so fest umhüllt, dass er Abdrücke hinterlässt, liegt an der kunstvollen Verdichtung des Stoffes, der im gleichen Atemzug luftig, durchlässig erzählt wird; nicht leicht, denn es ist auch viel Schwermut darin, doch alles Schmerzliche, Lastvolle, Grausame der Existenz erscheint zugleich als vorübergehend, als verwandelbar. Das Schwere wird nicht negiert, es zeichnet das Leben, doch wird es in Matutin literarisch in einen Zyklus von Werden und Vergehen eingeordnet, der der religiösen Zeiterfahrung des Stundengebets entspricht. Der Turm erscheint letztlich als ein Durchgangsort, der Refugium und Aufbruch miteinander verbindet und in dem in einigen flüchtigen Augenblicken das Geheimnis der Verwandlung aufleuchtet: die möglich wird in der alltäglich-mystischen Begegnung.
Bibliographische Angaben
Gertrud Leutenegger: Matutin, Suhrkamp 2015
ISBN: 9783518466247
Bildquelle
Gertrud Leutenegger, Matutin
© 2025 Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin