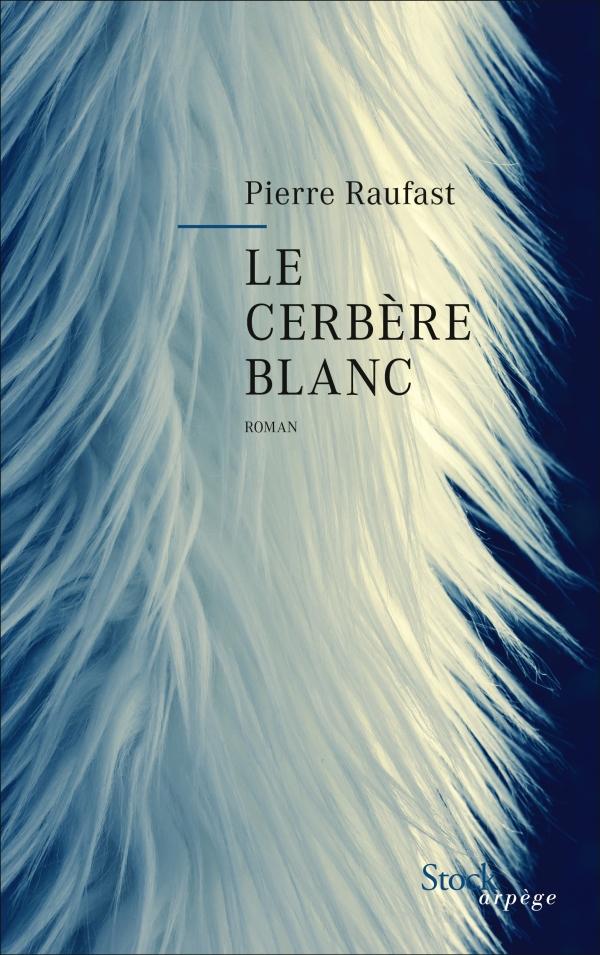Ein junges Mädchen, zwergenhaft verhüllt in einen Umhang, schleicht des Nachts durch Paris und verschafft sich Einlass in die Kaserne, weil sie gehört hat, dass es dort Leichen geben soll. Auch wenn sich herausstellt, dass sie hier eine Redewendung allzu wörtlich genommen hat, nimmt man hinter dem leicht grotesken Humor, der schon die Eingangsszene des Romans auszeichnet, eine starke Figurenpersönlichkeit wahr, spürt man die Ernsthaftigkeit des Mädchens, das hartnäckig seinen Plan verfolgt, Körper zu sezieren und in allen Details zu erforschen. In Christine Wunnickes neuem Roman, der in wenigen, dafür umso anschaulicheren Szenen die Lebenswege zweier Frauenfiguren im 18. Jahrhundert nachzeichnet, geht es um die Wissenschaft als Leidenschaft, um Kunst und Berufung, um Glaube und Wissen und Liebe im Angesicht der Vergänglichkeit, um den Wandel der Zeit, um die Verheißung und den Schmerz von Umbrüchen.
Das Mädchen ist Marie Biheron, die als Anatomin und Künstlerin im 18. Jahrhundert wirkte, und sie ist nicht die einzige historische Figur in diesem Roman, die ihrer Leidenschaft folgt und mit Ausdauer, Pragmatismus und Findigkeit Geschlechterrollen aufbricht, die auch im neuen Geiste der Aufklärung, der damals durch Frankreich wehte, nur wenig hinterfragt wurden. Die knapp 20 Jahre früher geborene Madeleine Basseporte, die zweite Hauptfigur, war königliche Pflanzenmalerin im Jardin du Roi und ihre verbürgte Begegnung mit Marie Biheron, deren Zeichenlehrerin sie war, wird im Roman zum Stoff einer Weiterdichtung, die uns auf pointierte, humorvolle Weise und mit einem etwas abseitigem Blick das Porträt einer Zeit großer Veränderungen auf menschlicher Ebene nahebringt.
Im zweiten Kapitel — und von da an durchgehend im Wechsel mit zeitlich weiter zurückreichenden Szenen aus dem Leben ihrer beiden Hauptfiguren –, zeigt die Autorin ihre Figur Marie um Jahrzehnte gealtert, kränklich, arm, seit vier Jahren hat sie sich in ihrer Gartenhütte verschanzt, versorgt von Edmé (eigentlich Aimé), einem kleinen Jungen, vielleicht ein Wechselbalg, vielleicht der leibliche Sohn des verarmten Schusterflickers, der inzwischen mit seiner Familie in dem Haus lebt, das früher Maries berühmtes Wachskabinett beherbergte. Es ist das Jahr 1793, die Revolution bereits Geschichte, Madeleine gestorben, doch die Welt steht noch immer Kopf, wovon sich Marie zuerst über die Zeitungen, die ihr Edmé bringt, ein Bild zu machen versucht, bis sie sich in Begleitung des Jungen, der sie im Leiterwagen hinter sich her zieht, doch nach draußen wagt und sich auf einen Streifzug durch die Straßen von Paris begibt, sich den Löchern, Leichen und dem wie eine sehr realistische Metapher funktionierenden Schatten der Guillotine aussetzt.
Jedes einzelne Kapitel dieses schmalen Romans liest sich wie eine kleine Novelle mit ihrer unerhörten Begebenheit, gleichzeitig gewinnen die Figuren und die Epoche, in der sie leben, mit jedem Kapitel an Dichte. Schon recht zu Anfang des Romans verrät die Autorin in einem eingängigen Bild die philosophische Perspektive, die ihrem Text eine besondere Färbung gibt. Die sichtbar gealterte Marie betrachtet mit ihrem noch immer präzisen Blick einer Wissenschaftlerin, der nichts entgeht und die nichts verschweigt, ihren Körper und mit besonderem Interesse ihre Hand, an deren anatomischen Veränderungen sie die Entstehung und den Lauf eines ganzen Lebens reflektiert. Geschichtsphilosophie als Körperphilosophie, das ermöglicht einen unkonventionellen Blick auf die Geschichte und die Menschen, die sich in ihr bewegt haben, und bringt uns die nur scheinbar fernen Zeiten literarisch sehr nah. So wie die Anatomin auch die unterschiedlichen Reifungsstadien der Körper erforscht, für die sie jeweils eigene Untersuchungsobjekte hat, denen sie sich je nach Interesse widmen kann, wirft auch der Roman seinen Blick auf die verschiedenen Lebensschichten seiner Figuren, nicht chronologisch, sondern von Kapitel zu Kapitel in der Zeit springend.
Während die Persönlichkeiten von Marie und Madeleine bei diesen literaturanatomischen Studien im Zentrum stehen, werden sie immer wieder auf humorvolle und entlarvende Weise mit männlichen Wissenschaftlern, Philosophen und Aufklärern wie Buffon oder Diderot kontrastiert. Madeleine zum Beispiel wird im Jahr 1734 gezeigt, als sie, die ehemalige Schülerin des königlichen Pflanzenmalers Aubriet, voll ausgebildet und talentiert, ihrerseits die Funktion der offiziellen Pflanzenmalerin im Jardin du Roi innehat — jedoch mit Abstrichen, da man dem weiblichen Geschlecht nicht die volle Verantwortung zugesteht. Daher werden alle ihre Zeichnungen, so perfekt sie auch sind, zusätzlich vom Intendanten, dem noch heute berühmten Naturforscher Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, kontrolliert und mit seinem Namen unterzeichnet. Indem Madeleine ihn leicht spöttisch nur Leclerc nennt, wird hier literarisch Rache geübt an der männlichen Berühmtheit, die unter dem Namen Buffon in die Geschichte eingegangen ist. Die emanzipatorische Ausgestaltung der Frauenfiguren zeigt sich auch im mühsam unterdrückten Unmut, den Madeleine verspürt, wenn sie den höheren Töchtern, die zum Zeichenunterricht zu ihr in den Jardin du Roi kommen, beibringen soll, Rosetten und Kränze zu malen, florale Muster statt naturgetreuer Abbildungen, Dekoratives ohne den wissenschaftlichen Anspruch, mit dem sie selbst arbeitet. Unter den Zeichenschülerinnen ist jedoch auch die eigenwillige Apothekerstochter Marie, die sich nicht mit Blümchenmustern abspeisen lässt und einem Kunstverständnis folgt, das auch Madeleines ästhetische Vorstellungen vor den Kopf stößt. Denn Marie seziert während dem Unterricht mit ihrem Pinselstrich die Pflanzen wie Körper, und eines Tages übergibt sie der verehrten Lehrerin eine schockierend getreue Zeichnung zweier innerer Organe, einer Leber und eines Herzens. Es ist der unkonventionelle Beginn einer Liebesbeziehung, die bis zu Madeleines Tod im Jahr 1780 halten wird.
Marie wohnt später eine Zeitlang im selben Haus wie Diderot, und Christine Wunnicke zaubert aus dieser Begegnung der beiden eine witzige geschichtsphilosophische Szene mit Tiefgang. Der etwas drollig geschilderte berühmte Philosoph flüchtet sich in seinem unstillbaren enzyklopädischen Wissensdurst und mehr noch vielleicht, um dem Trubel in der Wohnung seiner Familie für eine Weile zu entgehen, zu der aufgeweckten Wissenschaftlerin und Künstlerin, um bei ihr Anatomie zu lernen und sie um einen Artikel für seine Enzyklopädie anzubetteln. Doch Marie lehnt ab, wohl nicht zum ersten Mal: Solange sie als Frau ihren Text nicht selbst unterzeichnen kann, kommt eine Mitarbeit für sie nicht infrage. Lieber streitet sie mit Diderot über den Titel des Buches, der mehrbändigen Encyclopédie, das er doch besser Vom Irrtum nennen sollte. Auch für die so genannte Chronologische Maschine, die Diderot für einen Freund in Paris zu vermarkten versucht, eine mit Kurbeln bedienbare Maschine, die die ganze Geschichte der Menschheit enthält, hat sie einige Verbesserungsvorschläge grundsätzlicher Art, wie etwa den, auch einen Platz für die noch nicht geschriebene Geschichte der Zukunft zu schaffen. Maries geschichtsphilosophischer Ansatz bringt Komplexität in die schnell aufflammende Begeisterung ihres Freundes Diderot hinein und, ähnlich wie bei ihrer Betrachtung des menschlichen Körpers, auch Individualität und Bewegung.
Diesem hier angedeuteten Programm entsprechend gestaltet die Autorin ihren ganzen Roman, in den Armut, soziale Ungleichheit und auch die besondere Ungleichheit des weiblichen Geschlechts auf individuelle, subtilere Weise Eingang finden. So wird beiläufig, aber mit einer gewissen Selbstverständlichkeit erzählt, dass die Schülerinnen wegen Menstruationsschmerzen nicht zur Zeichenstunde kommen oder dass die Pflanzenmalerin Madeleine sich immer wieder gegen die verniedlichende Bezeichnung der „Blumenmalerin“ wehren muss.
Marie kommt irgendwann auf die Idee, statt der schwer zu beschaffenden Leichen Bossierwachs zu verwenden, um Körper herzustellen, die zwar künstlich sind, doch so lebensecht wirken, dass sich die Anatomie an ihnen gut praktizieren lässt. In dieser Technik verschmelzen Kunst und Wissenschaft miteinander, so wie auf andere Weise auch in der Pflanzenmalerei Madeleines. Künstlich, und doch lebensecht ist auch Christine Wunnickes neuer Roman, der ein Stück Menschheitsgeschichte aus einer anderen Perspektive erzählt, die Themen berührt und Fragen aufwirft, die ihren Strahl bis in die Zukunft unserer Gegenwart verlängert.
Bibliographische Angaben
Christine Wunnicke: Wachs, Berenberg 2025
ISBN: 9783911327039
Bildquelle
Christine Wunnicke, Wachs
© 2025 Berenberg Verlag GmbH, Berlin