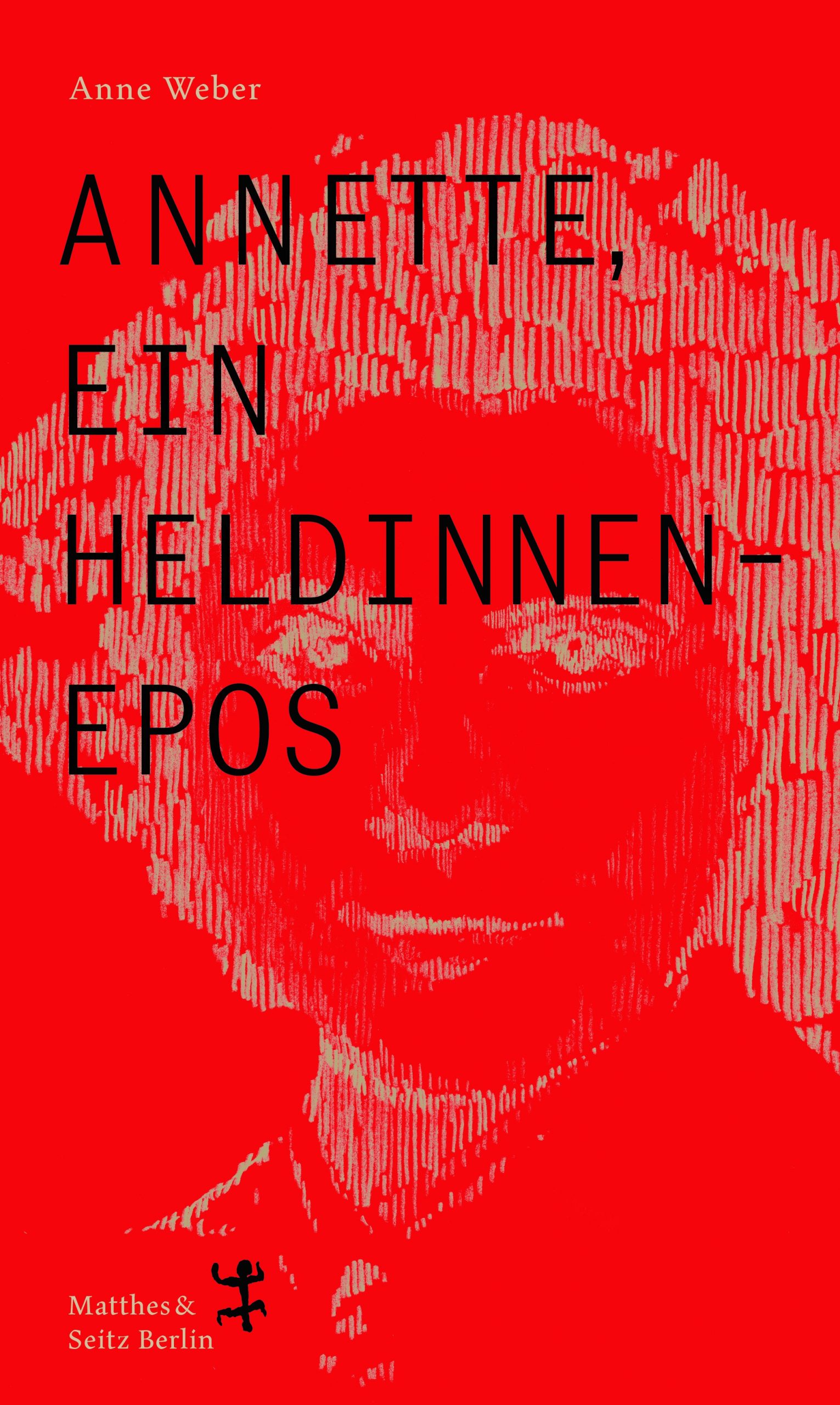Idee und Form dieses grandiosen Werks aus der Feder der seit langem in Frankreich lebenden Übersetzerin und Romanautorin — und nun sogar Versepikerin! — Anne Weber sind aus einer zufälligen Begegnung mit der von ihr besungenen Heldin entstanden: der 1923 in einem kleinen Fischerdorf in der Bretagne geborenen und heute 97-jährigen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir, Spitzname Annette. Mit ihr kam die Autorin in Frankreich bei einer Veranstaltung ins Gespräch, und aus der Faszination heraus, in unserer heutigen Zeit tatsächlich noch einer echten Heldin begegnet zu sein, ging dann, so die Autorin, dieser ungewöhnliche Text hervor, der seinerseits tatsächlich noch die Gestalt eines echten Versepos in unsere heutige Zeit transportiert — und zwar stilistisch virtuos, ungemein mitreißend und alles andere als verstaubt.
Natürlich variiert und interpretiert Anne Weber diese längst aus der Mode gekommene Gattung auf ihre eigene Weise. Die Tradition, in der sie sich ganz bewusst verortet, um sie dann ebenso bewusst zu transformieren und auf sinnfällige Weise neu zu interpretieren, reicht von der Antike mit Homers Odyssee über die mittelalterlichen Epen bis zur Renaissance, in denen das Genre mit Herrscherlob und Nationalbewusstsein ein letztes Mal zur Blüte kommt, ehe es allmählich von neuen epischen Formen wie dem Roman verdrängt wird. Interessant ist auch, dass für Anne Weber, die die bretonische Herkunft ihrer Heldin durchaus hervorhebt, die wohl doch zu fantastische „matière de Bretagne“ der Artusepen dennoch weniger eine Rolle spielt als die deutlich politischere „chanson de geste“. Vor allem das Rolandslied steht einem hier bei der Lektüre kontrastiv vor Augen, geht es darin doch auch um Widerstand, Verrat und Kameradschaft, gleichwohl die Heldin bei Anne Weber selbst nicht mit Waffen auf offenen Schlachtfeldern kämpft, sondern im Untergrund, und gleichwohl sie nicht für einen König oder eine bestimmte Nation ihr Leben aufs Spiel setzt, sondern eher für eine Idee, die universale und doch alles andere als abstrakte Idee der Humanität, die für sie im menschlichen Einzelfall, als religionsunabhängige Form der Nächstenliebe, jedesmal aufs Neue individuelle Gestalt annimmt. Anne Beaumanoir handelt stärker noch als ihr freilich auch charakterlich heldenhafter epischer Vorgänger Roland aus einer inneren ethischen Überzeugung heraus, und vor allem besteht ihr Heldentum gerade nicht im Sichtbarwerden ihrer Taten, sondern in ihrem unaufhörlichen, unsichtbaren, selbstlosen Wirken im Geheimen, darin, unerkannt, ja anonym zu bleiben und ganz hinter der Sache, dem Dienst an der Menschheit und Menschlichkeit, zu verschwinden. Im Unterschied zu den traditionellen Epen gewinnt Anne Webers Heldin mit den vielen, immer wieder wechselnden Namen ihre Kraft und ihre Besonderheit gerade nicht aus der Ehre des großen Heldennamens.
Denn es geht der Autorin wohl ganz wesentlich auch darum, am Beispiel von Annette und im Kontext ihrer einen Großteil des 20. Jahrhunderts umfassenden Biographie jenseits der berühmten männlichen Heldenfiguren weitere von der Geschichte vergessene Gestalten zu benennen, sie ins Gedächtnis zu rufen, zu ehren, wie z.B. die junge Frau, die Annette beim Verstecken der jüdischen Kinder hilft:
Sie ist es auch, die vorher schon Annette zur
Weber, Annette, ein Heldinnenepos, S. 49
Tarnung die Krankenschwesterkluft besorgte,
eine junge Frau, alleine, ohne Kind noch Mann — eine
von vielen und von viel zu wenigen –, die sofort hilft, wo sie
nur kann, und deren Namen heute alle vergessen haben.
Übrigens kommt der Roland, den es tatsächlich auch in dieser Geschichte gibt — er ist die erste große Liebe Annettes, ihr Kamerad und treuer Mitstreiter — trotz bzw. gerade als Folge seines Mutes bereits vor der Hälfte des Epos um. Seine ebenso mutige Freundin Annette mit den vielen Namen ist es, die überlebt, die weiterkämpft wie eine Heldin, als welche sie sich selbst nie fühlte.
Annette ist auch die moderne und weibliche Variation eines anderen, noch berühmteren epischen Helden:
(…) Und wie Odysseus, dem auf
Weber, Annette, ein Heldinnenepos, S. 59
langer Reise seine Gefährten nacheinander starben, ist sie
von ihrer Herkunft, ihrer Geschichte abgetrennt: Von
denen, die in jenen Tagen ihre Wege kreuzten, kennt
keiner ihren wahren Namen, ihre Vergangenheit —
kaum, dass sie selbst sich ihrer noch erinnert. Sie bewohnt
ihren eigenen Schatten. Und wie Odysseus könnte sie,
gefragt nach ihrem Namen, nicht nur aus List, sondern
wahrheitsgemäß „Ich heiße Niemand“ sagen.
In ihrem Heldinnenepos rückt die Autorin somit einen anderen Aspekt in den Vordergrund: Annettes Heldentum besteht darin, wie aus einer Notwendigkeit heraus selbstlos und im Sinne der Schwächeren zu handeln, Opfer zu bringen, ohne sich als Opfer zu fühlen. Zugleich wird uns in Anne Webers Versen die Ambivalenz des Heldinnenseins vor Augen geführt. Einerseits zeigt sie Annette als starke Heldin, die, während sie handelt, nie in Frage stellt, ob die Sache ihren bedingungslosen Einsatz wert gewesen ist, und genau daraus ihre Kraft entfaltet. Andererseits schreibt die Autorin ihrem vielschichtigen Text den Zweifel, der die Heldin wenn überhaupt erst rückblickend beschlich, von Anfang an mit ein. Sie macht uns Lesern bewusst, dass ihre weibliche Heldin eben auch eine Frau und Mutter ist, die um ihres Einsatzes für die Menschlichkeit willen, ohne zu klagen, als solche vielfach zurücksteckt. So verzichtet sie — und der Verzicht tut ihr weh — auf ihr ungeborenes Kind mit Roland, und als sie Jahre später doch noch Mutter wird, muss sie ihre drei geliebten Kinder, von denen das Jüngste eben erst zur Welt kam, zurücklassen, um dem Gefängnis und dem Land, das in ihr keine Heldin, sondern eine Verbrecherin sieht, zu entfliehen. Sie lebt das Leben einer modernen Frau, einer mutigen Frau, die ihrer Zeit voraus ist, was auch im Privaten zu Konflikten führt, etwa wenn sie in ihrem algerischen Exil einen höheren Posten innehat als ihr algerischer Geliebter. Gerade weil sie eine Frau ist, die mit den tradierten Zuschreibungen bricht und sie in Frage stellt, stößt sie sich doch immer wieder an den verfestigten patriarchalischen Strukturen und Oppositionen, wie der von Privatheit und Öffentlichkeit, Gefühl und Stärke. Und doch zeigt die Autorin am Beispiel ihrer Geschichte, dass Mitgefühl und Heldenmut einander nicht ausschließen. Annettes Heldinnentum vereint beides, auch wenn es immer wieder Schmerz und Verzicht bedeutet:
(…) An diesem Tag
Weber, Annette, ein Heldinnenepos, S. 46
retten Roland und Annette ein Kind. Ein
anderes, das ihre, das noch unbewusst im Leib
der Mutter schwimmt, geben sie am selben Tag
verloren. Denn jegliches hat wirklich seine Zeit
das Kinderkriegen und das Widerstehen,
und beides gleichzeitig ist nicht zu haben.
Man muss Anne Webers Epos eigentlich laut lesen, um seine ganze poetische Kraft zu spüren. Die freien Verse strukturieren den Text und verleihen ihm einen ganz eigenen Rhythmus: andächtig und melodisch wie ein alter epischer Gesang, in den sich immer wieder auch die auktoriale Stimme mischt, aber auch mit Brüchen und überraschenden Enjambements, die die Aufmerksamkeit des Lesers wachhalten und ihn bisweilen nachdenklich innehalten lassen.
Berichtet werden die Taten der Heldin, die selbst lieber handelt als über ihre Motivationen zu reflektieren, gleichwohl sie durchaus nach übergreifenden Ideen und Idealen handelt, die man Humanismus, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft oder heute vielleicht Zivilcourage nennen kann. Hier erweist sich die Form des Epos, das von den Taten erzählt und sie zugleich auktorial kommentiert, tatsächlich als passende und erstaunlich zeitgemäße Gattung. Anne Weber liefert die Reflexion immer gleich mit, ja lässt sie kunstvoll den Worten selbst entwachsen, und verleiht ihrem Text auf diese Weise eine große poetische Dichte und essayistische Nachdenklichkeit.
So arbeitet sie, ohne den mutigen und selbstlosen Einsatz so vieler im Untergrund Widerstand Leistender dadurch herabzuwürdigen, auch das Konfliktpotential des kollektiven Widerstands heraus: die Schwierigkeit wenn nicht Unmöglichkeit, im Kampf gegen die Besatzer, gegen Unmenschlichkeit und Gewalt selbst „unschuldig“ zu bleiben, die Gefahr, sich von Ideologien vereinnahmen zu lassen, und die Kehrseite der Unterordnung unter eine Gruppe bzw. einen höheren Zweck. Auch das Thema Religion und Religiosität wird in diesem Kontext von vielen Seiten beleuchtet; Annette erlebt z.B., wie der Islam in den ehemaligen französischen Kolonien ein neuer politischer Faktor wird, oder wie eine algerische Mitgefangene sich zur Ikone des Widerstands stilisieren lässt, und bleibt zwiegespalten, ob hier weibliche Selbstermächtigung am Werke ist oder fragwürdige Propaganda. Sie selbst jedenfalls bleibt lieber im Schutze ihrer vielen Namen, die sich auch als Schutz vor einseitiger Instrumentalisierung erweisen.
Es werden im Laufe der lebendigen Darstellung von Annettes Biographie auch einige bewusst ausgewählte Autoren und Werke zitiert und zu ihrem Handeln in Beziehung gesetzt. Allen voran André Malraux, der selbst im Widerstand tätig war und in seinen Büchern Auflehnung, Revolution und Selbstopfer im existentialistischen Kontext der conditio humana reflektiert. Auch andere Bücher werden aus Annettes fiktivem Bücherregal gezogen, etwa Camus und sein Mensch in der Revolte oder Rousseau. Facettenreich geht es um die Frage nach der Rechtfertigung von Gewalt, dem Übergang von Widerstand in Terrorismus, der Legitimität von Bluttaten im Kampf gegen ein Unterdrückungssystem. Camus‘ Einstellung zum Kolonialismus etwa unterscheidet sich von derjenigen Annettes, gleichwohl ihr Leben in vielerlei Hinsicht mit seiner in der Figur des glücklichen Sisyphus kulminierenden Philosophie übereinstimmt.
(…) Jenseits der Zweifel, die bis ins
Weber, Annette, ein Heldinnenepos, S. 127
Bewusstsein dringen, gibts aber andere, die in weiter
Seelenferne schwimmen. Ist es denn Liebe, die den
Revolutionär macht, ist es Hass? Sind es Ideen oder ist es was
Lebendiges, was den im Innersten erschüttert, der vor
dem Unglücklichen steht, vor dem, der hungert, leidet,
vor dem, der … von einer Bombenexplosion zerfetzte
Beine hat und sterben wird?
Die Autorin verurteilt nicht, sie wirft Fragen auf, die einen langen Nachhall haben, und sie hinterfragt vor allem auch die offiziellen Geschichtsbilder, in denen so manches verzerrt oder verschwiegen wird. Aber nicht in Form einer moralischen Anklage, sondern über poetische Assoziationen, durch die für die Dichterin z.B. die Möglichkeit entsteht, ein Lied von Charles Trenet mit einem Atomtest in der Wüste zu verknüpfen, der viele namenlose Opfer forderte und in der überlieferten Geschichtserzählung kaum auftaucht. Das gilt ganz besonders auch für den Algerienkrieg, der lange Zeit in Frankreich mit der Bezeichnung „Ereignisse“ verharmlost wurde, für all die Seilschaften und vertuschten Verbrechen im Hintergrund des kolonialen Gefüges.
In seiner ehrwürdigen, in Verse gesetzten Form, die zugleich durch moderne Begrifflichkeiten gelockert ist und sich an unserer heutigen Prosa orientiert, adelt der Text den unermüdlichen Einsatz der Heldin, ohne sie zum Idol zu machen. Denn im Vordergrund steht Annettes Menschlichkeit und durch die reflexive Ebene dringen auch ihre Zweifel bis zu uns durch. Dank ihres Gespürs gelingt es der Autorin, die man auf jeden Fall eine Dichterin nennen sollte, diese Balance nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch zu vermitteln. Ein beeindruckendes Werk!
Bibliographische Angaben
Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos, Matthes & Seitz (2020)
ISBN: 9783957578457
Bildquelle
Anne Weber, Annette, ein Heldinnenepos
© 2020 Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH