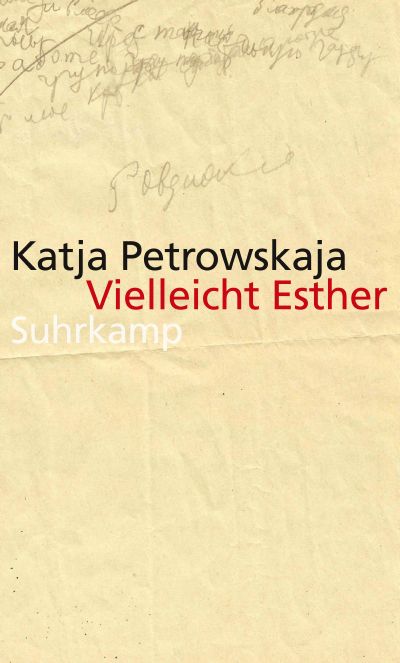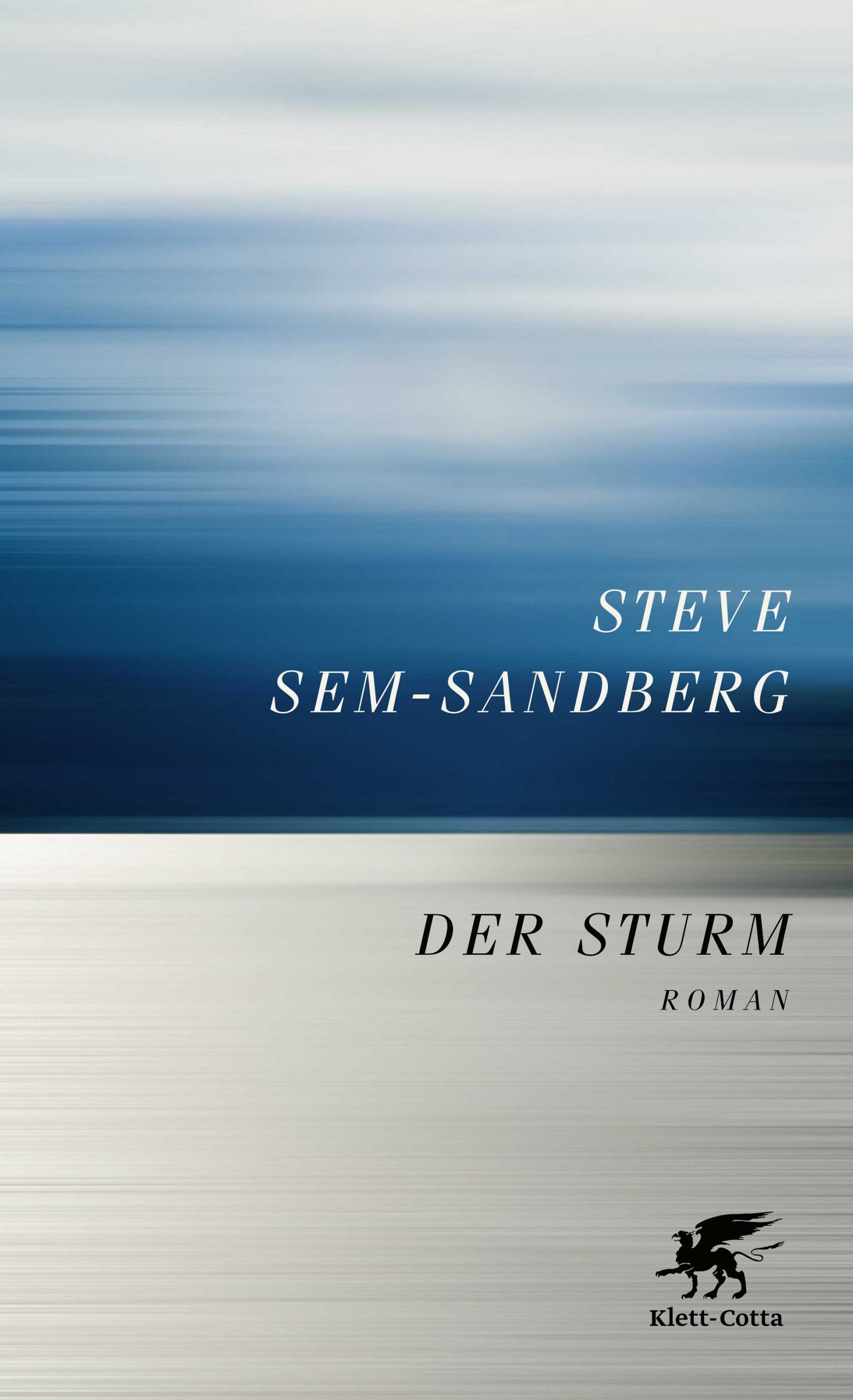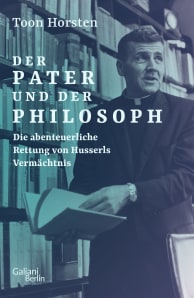Mit der Geschichte „Vielleicht Esther“ gewann Katja Petrowskaja 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2014 erschien der Text in einem um weitere Geschichten erweiterten Buch mit demselben Titel, 2022 ein von Meike Rötzer gelesenes Hörbuch. Die Autorin geht darin auf Spurensuche, recherchiert in ihrer eigenen jüdisch-ukrainischen Familiengeschichte und taucht auf eine zugleich sehr persönliche, essayistische und dokumentarische Weise tief in die Vergangenheit der Sowjetunion und eigentlich ganz Europas ein.
In den aufeinander folgenden Geschichten rekonstruiert Katja Petrowskaja das Leben, die Schicksale vieler verschiedener Verwandter mütterlicher- und väterlicherseits, doch tut sie das nicht als epische Erzählerin einer Familiensaga, sondern als Suchende, Fragende, als eine, die begreifen will, was sich immer wieder als nicht begreifbar herausstellt, die die zahlreichen Leerstellen der Vergangenheit zu ergründen sucht, und diese, wo dies nicht möglich ist, auch als solche belässt, anstatt sie fiktional zu füllen. Denn trotz ihrer emsigen Recherchearbeit, ihrer Reisen nach Warschau, Kiew und Mauthausen, verbirgt sich die Wahrheit ihrer eigenen Familiengeschichte und genauso auch der Geschichte im Großen, der Geschichte der Juden, der Menschen im 20. Jahrhundert, immer wieder hinter Unklarheiten und Widersprüchen. Oder ist die Wahrheit manchmal nichts anderes als Unklarheit und Widersprüchlichkeit?
Es entsteht ein immer dichter gewebtes Netz von Geschichten, das sich der auch dem Leser oder Hörer manchmal labyrinthisch anmutenden Vergangenheit mit einzelnen Ariadnefäden nähert und das mit Absicht unvollständig bleibt, endlos weiter gewebt werden könnte und trotzdem exemplarisch ist.
Ausgangspunkt der Erzählungen ist dabei jedesmal die Gegenwart, der Besuch in Archiven, Gedenkstätten, ein Telefonat mit einer Holocaustüberlebenden in Amerika.
Verknüpft sind nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch die verschiedenen Länder und Sprachen, und mit ihnen die Schicksale der Menschen.
Ganz bewusst schreibt die Autorin auch nicht in ihrer Muttersprache, eine Möglichkeit, nicht mit dem eigenen Thema zu verschmelzen oder von ihm überwältigt zu werden. So wird auch die Sprache selbst, die Sprache angesichts von Unaussprechlichem, Gegenstand des Textes, Gegenstand der Aufarbeitung und Annäherung. Hinterfragt werden darüber hinaus auch die Zahlen, welche die Geschichte nicht angemessen („angemessen“, auch ein Wort, über das sie reflektiert) darstellen kann: Wurden in Babyn Jar 100.000 oder 200.000 Menschen umgebracht, gab es also ein Babyn Jar oder zwei? Der menschlichen Absurdität dieser historischen Frage antwortet Petrowskaja mit ihrem Buch, indem sie mit ihren Geschichten den abstrakten Zahlen ein Gesicht gibt.
Dafür findet sie, und das macht ihren Text so besonders, einen Erzählton zwischen Involviertheit und Dokumentation, zwischen Betroffenheit und sachlicher Aufarbeitung, ein Ton, den die Sprecherin gut einzufangen versteht. Die Erzählung, die auch humorvolle Stellen hat, ist berührend und an einigen Stellen erschütternd, ohne dass oder gerade weil sie nicht dramatisiert, sondern emotionale Nähe und kritische Distanz in ihr Hand in Hand gehen.
Bibliographische Angaben
Katja Petrowskaja: Vielleicht Esther, Suhrkamp 2014
ISBN: 9783518424049
Hörbuch:
Der Audio Verlag 2022
Gelesen von Meike Rötzer
ISBN: 9783742426352
Bildquelle
Katja Petrowskaja, Vielleicht Esther
© 2023 Suhrkamp Verlag AG, Berlin