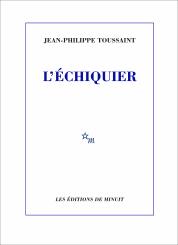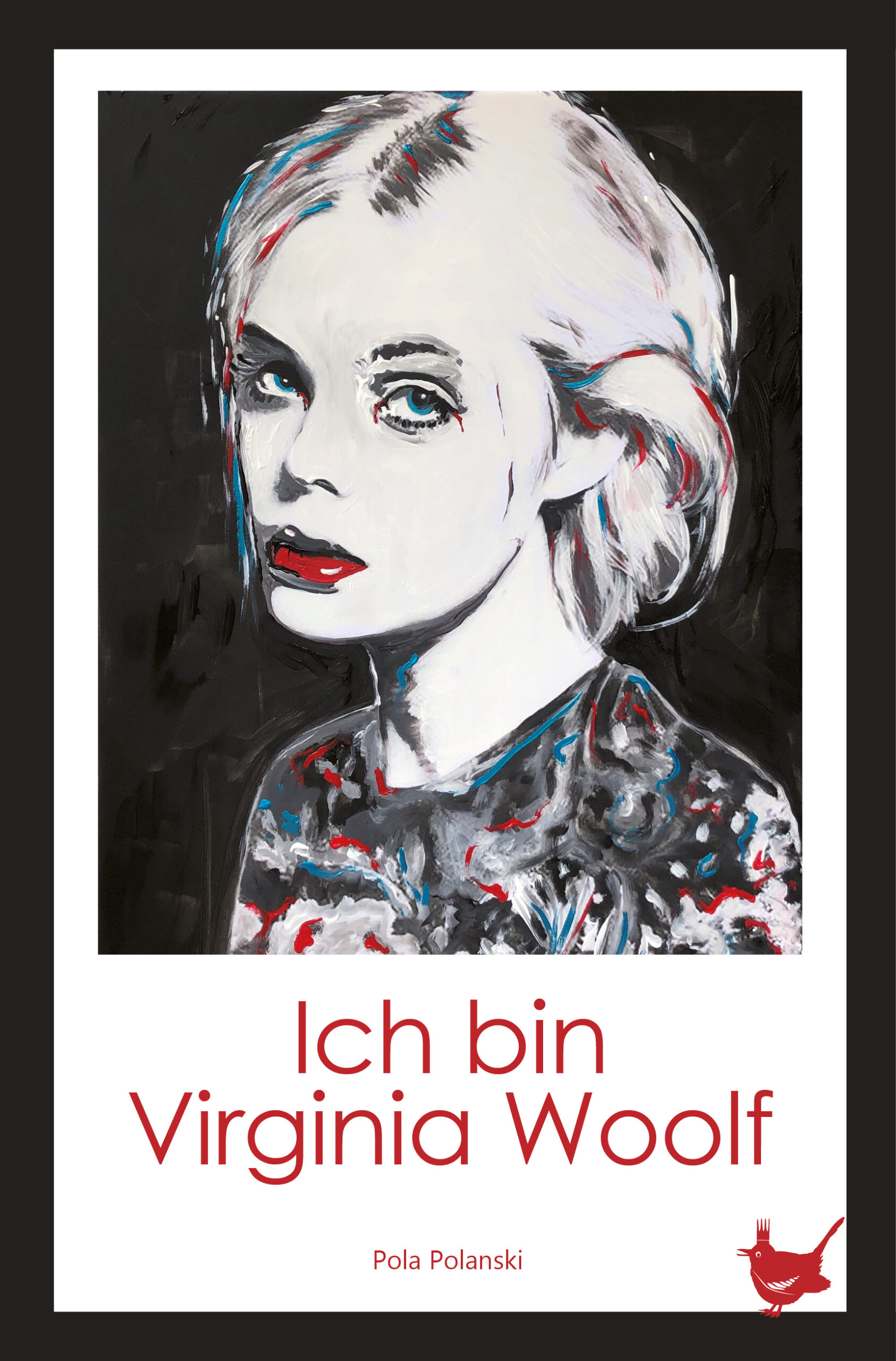In ihrer Kindheit sagte Tove Ditlevsens Vater zu seiner Tochter, dass Mädchen keine Dichterinnen werden könnten. Die junge Tove, die, seit sie ganz klein ist, ihren Vater beim Bücherlesen beobachtet hat und sich später selbst Bücher aus der Erwachsenenabteilung der Bücherei ausleiht, da sie mit den konfliktarmen Inhalten der Kinderbücher nichts anfangen kann, beginnt trotzdem Verse in ein Poesiealbum zu schreiben, das sie jahrelang versteckt hält, bis sie den Mut und die Gelegenheit findet, einzelne Gedichte daraus wichtigen Männern der Zeitungs- und Buchbranche zu zeigen und ihre Schriftstellerinnenkarriere mühsam in Gang zu setzen. Die Heimlichkeit des Schreibens, das für sie lange Zeit mit Scham verbunden bleibt, und ebenso das Glück und der Ansporn, die sie daraus gewinnt, der Mut, gegen vielseitige Widerstände ihrer Berufung zu folgen, die weder durch ihre soziale Herkunft noch durch ihr Geschlecht vorgezeichnet war, charakterisieren ihren Lebensweg als Schriftstellerin, von dem sie auf autofiktionale Weise in den drei Romanen Kindheit, Jugend und Abhängigkeit erzählt.
Tove Ditlevsen ist 1917 in Kopenhagen geboren und wächst dort in den 1920er Jahren im Arbeiterviertel Versterbro auf. Im ersten Teil der Trilogie, Kindheit, bekommt man ein sehr lebendiges Bild von der erstickenden Enge und der Armut, die dieses Milieu prägten, und die für ein Mädchen, das von klein auf das Gefühl hatte, anders als die anderen Mädchen zu sein, die sich ihre Zukunft nicht innerhalb der ihr gesteckten Grenzen vorstellen konnte, für Unsicherheit und Verzweiflung sorgten. Weiblichkeit erscheint ihr schon in der Kindheit und auch später die meiste Zeit als eine Pose, und sie entspricht weder den Erwartungen, die man von ihr als Mädchen hat, noch denen ihres Milieus. Tove Ditlevsen findet in ihrem ansonsten sehr nüchtern und wenig ausschweifend erzählten Text mehrere Metaphern für die Kindheit, die der kleinen Tove als ein kaum auszuhaltender Zustand erscheinen. Wie auch ihr Bruder, der mit seiner Volljährigkeit die Familie verlässt, hat Tove schon früh eine große Sehnsucht nach einem Raum nur für sich. Ihre Mutter, die von ihrer eigenen Herkunft geprägt ist — mit ihrer Heirat hat sie einen minimalen Aufstieg erreicht und ist daher umso ungehaltener, wenn ihrem Mann wieder eine Anstellung gekündigt wird — ist Tove auch kein Halt, sondern gibt ihre Ängste und Rollenerwartungen unbewusst an ihre Tochter weiter. Das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter, der sie gefallen möchte und zu der sie doch keine wirkliche Nähe findet, ist eines der versteckten psychologischen Themen dieser autobiographischen Erzählung, die ganz auf einordnende oder erklärende Analysen verzichtet, indirekt aber sehr genaue psychologische und soziologische Beobachtungen vermittelt. Fast ohne dass es einem bei der Lektüre auffällt, die einen mit ihrer schlichten Unmittelbarkeit in Bann zieht, wechselt sie immer wieder zwischen Präteritum und Präsens, und führt uns sehr nah heran an das Erleben und Beobachten ihrer Erzählerin. Ihr Stil ist, obgleich sie nichts, auch nicht ihren eigenen Namen oder den ihrer Eltern, unter dem Deckmäntelchen der Fiktion verschleiert, sehr literarisch.
Im zweiten Teil, Jugend, der im Kopenhagen der 1930er Jahre spielt, gewinnen die bereits in den Kindheitsjahren der Erzählerin noch eher diffus wahrgenommenen soziopsychologischen Dilemmata an Kontur. Die Kindheit, die Tove als so ungenügenden Zustand erlebt hat, erscheint im Vergleich zu den Jugendjahren auf einmal fast leicht. Mit 15 Jahren ist für die Jugendliche die Schule schon zuende, der Besuch einer weiterführenden Schule kommt für ihre Eltern nicht infrage. Stattdessen tritt Tove ins fordernde Arbeitsleben der unteren Schichten ein, um sich ihren Unterhalt selbst zu erwirtschaften. Es sind typische weibliche Anstellungsberufe, in denen sie ihr erstes eigenes Geld verdient, Haushälterin, Bürogehilfin. Sie hat auch ihren ersten festen Freund und macht erste Erfahrungen in der Liebe, empfindet dabei aber nichts, was nur entfernt an Glück oder Erfüllung erinnert. Anstatt selbst zu fühlen, beobachtet sie die Gefühle und das Verhalten der anderen. In den Beziehungen zu Männern verfestigt sich ein Motiv, das sich schon in Kindheit angedeutet hat, nämlich die soziokulturell vermittelte Notwendigkeit, sich anzupassen und darüber auch das eigene Ich aus den Augen zu verlieren. Was der heranwachsenden Tove Kraft gibt, ist allein das Gedichteschreiben; es ist ihr Ansporn, es an ihrer drögen Arbeitsstelle auszuhalten und die Zeit bis zu ihrem 18. Geburtstag zu überbrücken. Ganz undramatisch und doch sehr unter die Haut gehend schildert die Erzählerin dieses Schwanken zwischen Motivation und Mutlosigkeit, das ihre Jugendzeit bestimmt, die von einem schier endlos scheinenden Ausharren, einem Warten auf eine irgendwo in der Ferne liegende Unterstützung, geprägt ist. Kleine Hoffnungsschimmer wie der, als ein Redakteur Potential in ihren Gedichten erkennt, wechseln sich mit schmerzhaften Rückschlägen ab.
Mit ihren Eltern zieht sie unterdessen in eine größere Wohnung, in der sie ein eigenes Zimmer bekommen soll. Doch ist dieses eigene Zimmer am Tage gleichzeitig auch das Wohnzimmer und überhaupt nur durch einen dünnen Vorhang abgetrennt. Der sehnsüchtige Wunsch nach Privatsphäre und einem ungestörten Raum zum Schreiben treibt sie, als sie die ersehnte Volljährigkeit endlich erreicht hat, schließlich in ein armseliges Zimmerchen zur Untermiete, das noch dazu von einer Frau vermietet wird, die sich als fanatische Anhängerin Hitlers und der Nationalsozialisten herausstellt. Zu den existentiellen Bedrohungen wie Krankheit, Armut, Arbeitslosigkeit, die in Jugend ebenfalls stärker thematisiert werden, kommt in diesem zweiten Teil der Trilogie zunehmend die Bedrohung durch den Aufstieg Hitlers und den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zur Sprache. Vor diesem apokalyptischen Hintergrund veröffentlich Tove ihr erstes Gedicht in einer Zeitschrift und, mit Unterstützung des Herausgebers der Zeitschrift, bald auch ihren ersten Gedichtband.
Der Krieg und die Besatzungszeit grundieren auch den dritten und letzten Teil der Trilogie, der in den 1940er Jahren spielt. Tove hat den deutlich älteren Herausgeber geheiratet, nicht aus Liebe, aber doch aus einer gewissen Verbundenheit zu diesem väterlichen Freund, der sie in ihr bisher verschlossene literarische Kreise einführen konnte, und wohl auch, um endlich das von einer Frau ihrer Herkunft erwartete Lebensziel einer Grundsicherung durch Heirat zu erreichen. In ihrer Ehe merkt sie jedoch schnell, dass sie nicht nur nicht glücklich ist, sondern richtiggehend unglücklich. Sie trennt einfach zu viel voneinander, nicht nur der Altersunterschied, auch, dass ihr Mann nicht versteht, „was es bedeutet, arm zu sein und fast seine ganze Zeit verkaufen zu müssen, nur um ein Auskommen zu haben“. Dass sie an einem Roman schreibt, verheimlicht sie ihrem Mann, ebenso die Affäre, die sie mit einem jüngeren Schriftstellerkollegen beginnt.
Sie trennt sich schließlich von ihrem Mann und lernt nach einigen schmerzhaften und enttäuschenden Erfahrungen ihren zweiten Mann kennen, einen jungen Politikstudenten, mit dem sie sich ihren Wunsch nach einem Kind endlich erfüllen kann. Auch ihr neues Ehe- und Familienleben ist nicht frei von Konflikten, die materielle Situation ist weiterhin schwierig, und nun ist da ja auch noch ein kleines Mädchen, das Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Im von der Außenwelt unverstandenen Gefühlschaos zwischen Mutterliebe und „regretting motherhood“ wird sie erneut schwanger. Die Passagen, in denen es um die verzweifelten Versuche geht, das Kind abzutreiben, sind mit die bewegendsten und erschütterndsten in dieser Autofiktion. Was die Erzählerin nicht nur moralisch und psychisch, sondern auch körperlich durchgemacht hat, ist kaum vorstellbar und ist sicher nicht oft in einer so direkten und zugleich zurücknehmenden Weise erzählt worden. Es dauert dann auch nicht mehr lange, und auch diese zweite Ehe, die aus Liebe geschlossen wurde und in Untreue und Unverständnis mündet, geht zuende. Denn Tove lernt jemand anders kennen: auch einen Mann, ja, aber wer sie eigentlich so in Bann schlägt, dass sie ihr ganzes bisheriges Leben für ihn aufgibt, ist kein Mensch, sondern ein Gefühl, ein Rausch, eine Betäubung. Sie wird abhängig von Schmerzmitteln, die sie in einen künstlichen und höchst gefährlichen Zustand des Glücks, der Ruhe versetzen. Sie geht eine Beziehung ein, die man wirklich mit dem inzwischen inflationär gebrauchten Adjektiv toxisch beschreiben muss. Denn der junge Arzt, der ihr dritter Ehemann werden wird, beschafft ihr diese Rauschmittel, bis sie schließlich süchtig und völlig aus der Spur geworfen wird. Abhängig ist sie nicht nur von den Medikamenten, sondern auch von ihrem Mann, mit dem sie zwei weitere Kinder hat, ein leibliches und ein uneheliches, adoptiertes. Abhängigkeit liest sich zuletzt wie eine Tragödie, soziale Isolation, körperlicher Verfall, Aufenthalt in der Psychiatrie. Und das Ende bleibt, zumindest in dieser autofiktionalen Trilogie, offen. Dass ein Entzug keine Garantie ist, deutet sich schon auf den letzten Seiten des Textes an, die von Rückfall und einer neuen Liebe erzählen. Wer die Biographie der Autorin kennt, weiß, dass die Verzweiflung bleibt. Abhängigkeit, Depression, Psychiatrieaufenthalte bestimmen auch ihr weiteres Leben, in dem sie noch einige bedeutende und stets autobiographisch grundierte Romane schreibt, bevor sie sich 1976 das Leben nimmt.
Trotz aller äußerer und innerer Dramen enthält Tove Ditlevsens Text auch kleine Utopien, etwa wenn sie von der Auszeit mit einer Freundin auf dem Landsitz einer Bekannten erzählt, wo sie schreiben kann, so viel sie will, wo sie Gespräche auf Augenhöhe führt, eine Nähe ohne Begehren und ohne Reibung lebt. Und auch der unprätentiöse Stil der Autorin bewirkt, dass man die Kopenhagen-Trilogie in allen drei Teilen sehr gerne liest. Unwilkürlich wird man hineingesogen in diese Geschichte, man fühlt mit, doch auch das Denken wird nicht ausgeschaltet durch diesen beeindruckenden Text, der zur Reflexion über soziale und geschlechterspezifische Ungleichheiten anregt, über psychologische und soziologische Mechanismen, die auch dann ins Rollen kommen, wenn man einen ganz anderen Weg einschlagen will.
Bibliographische Angaben
Tove Ditlevsen: Kindheit, Aufbau Taschenbuch 2022
Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein
ISBN: 9783746639925
Tove Ditlevsen: Jugend, Aufbau Taschenbuch 2022
Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein
ISBN: 9783746639932
Tove Ditlevsen: Abhängigkeit, Aufbau Taschenbuch 2022
Aus dem Dänischen von Ursel Allenstein
ISBN: 9783746639949
Bildquelle
Tove Ditlevsen, Kopenhagen-Trilogie
© 2025 Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin