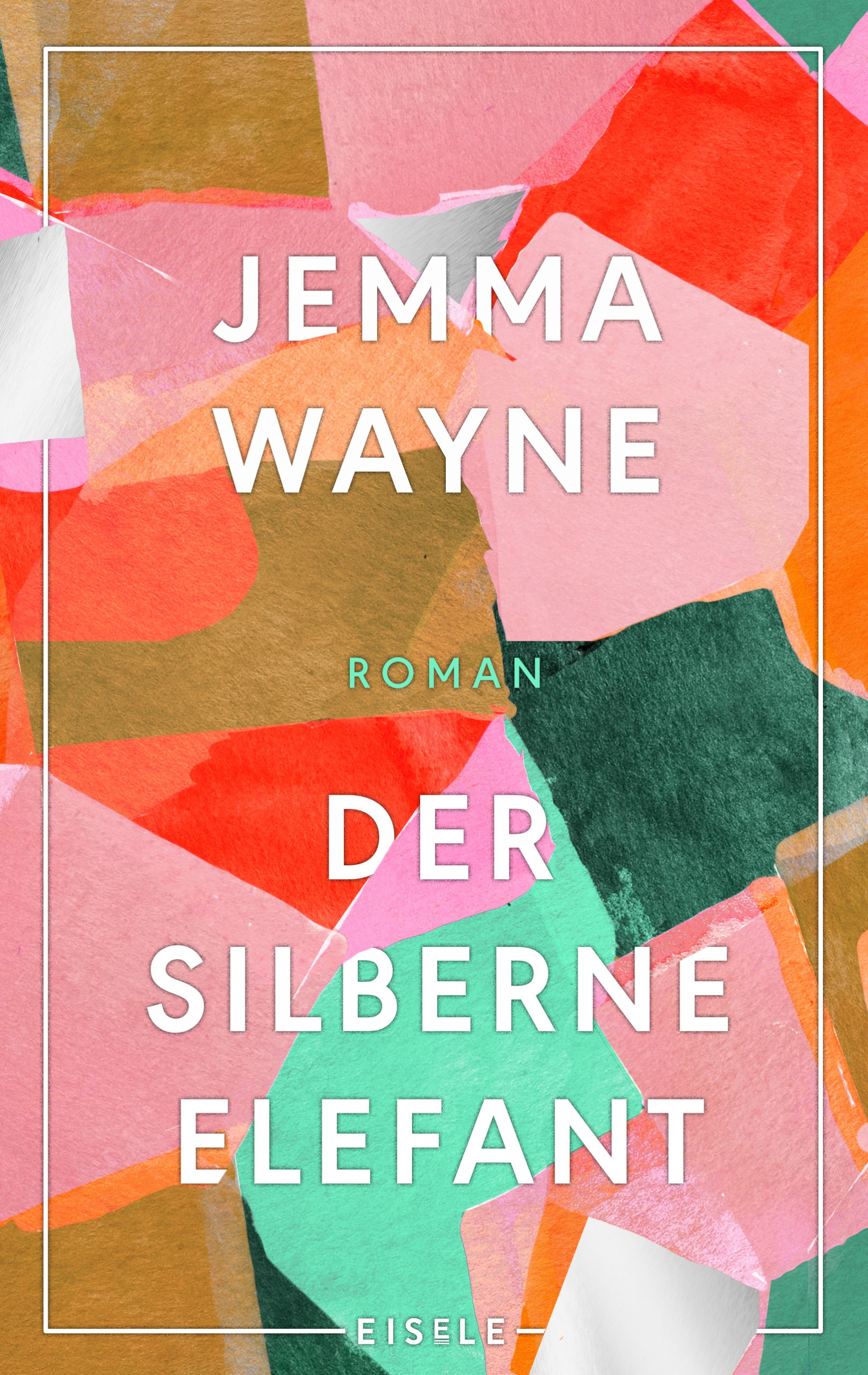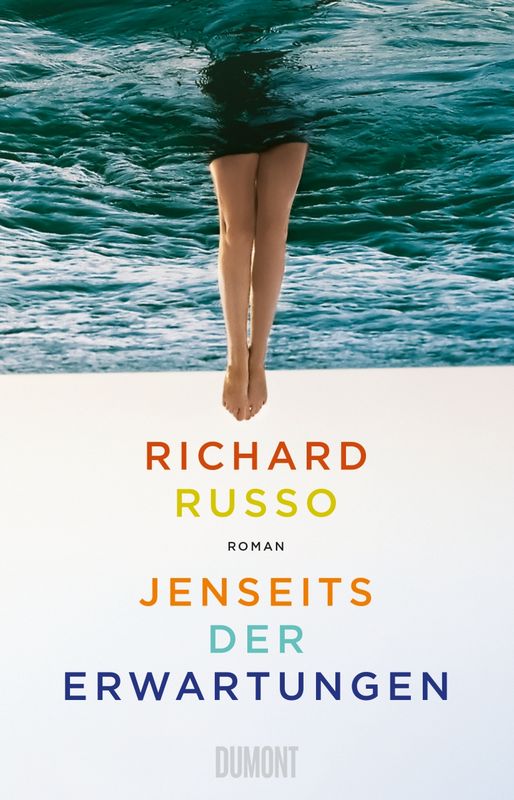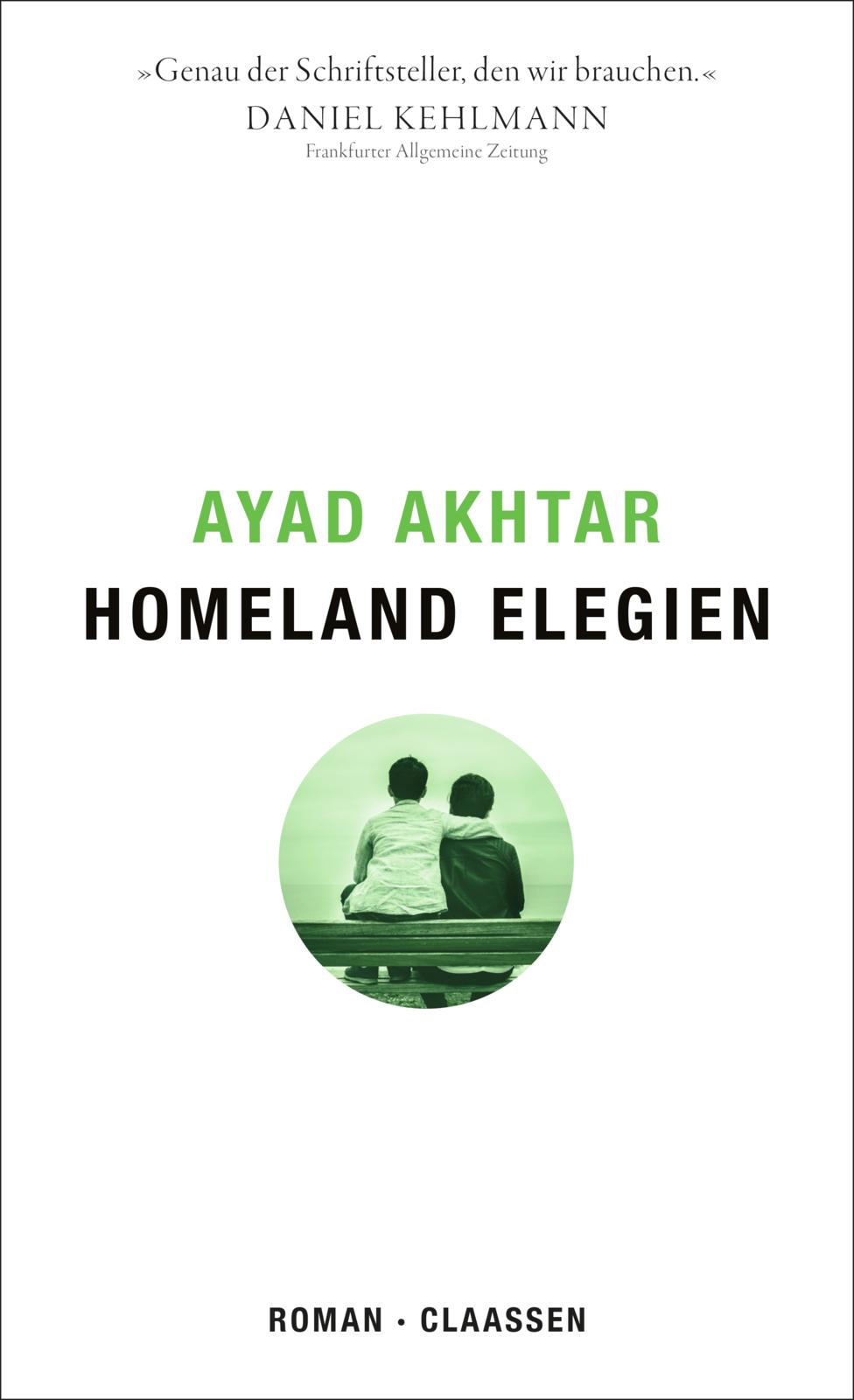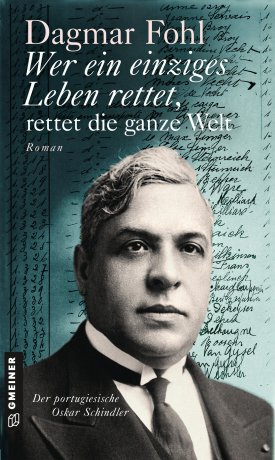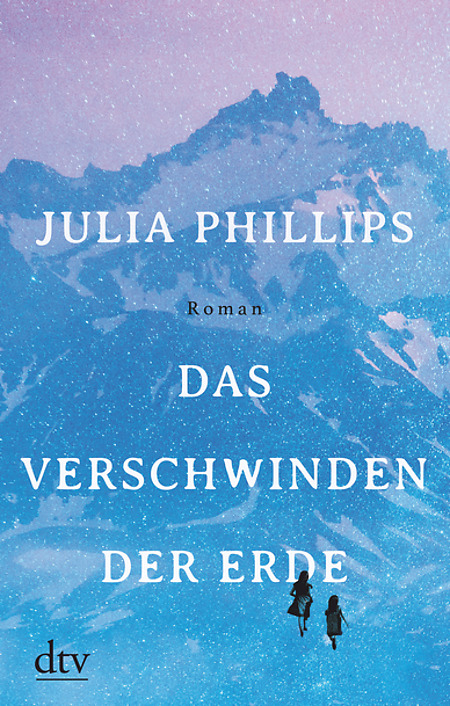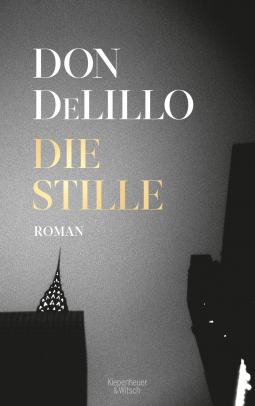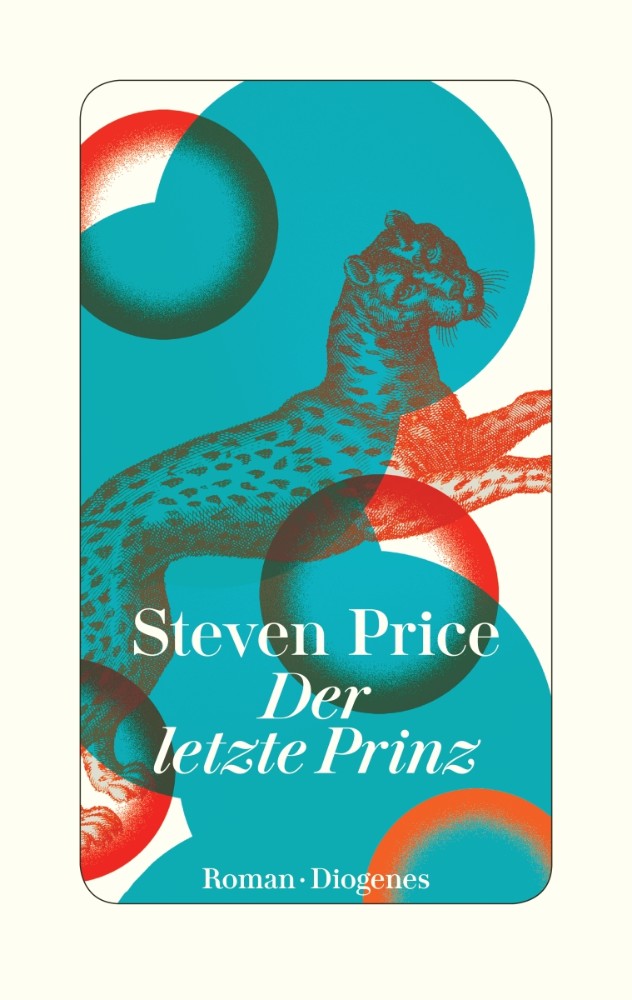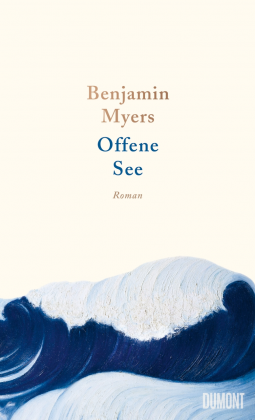Die britische Journalistin und Autorin Jemma Wayne erzählt in ihrem beeindruckenden ersten Roman gleich drei weibliche Lebensgeschichten, die sie zu einem stimmigen Gesamtwerk verknüpft. Sie schreibt mit einem feinen Gespür für das psychologische Detail und die verschlungenen und alles andere als eindeutigen Pfade der menschlichen Emotionen, mit einem entlarvenden Blick auf ihre Figuren, der kritisch ist und doch zugleich von großer Empathie getragen wird.
Denn das, wonach sich die drei so unterschiedlichen Frauen — die schwerkranke Witwe Lynn, die mit Lynns Sohn verlobte junge Vera und die aus Ruanda geflohene Emilienne –, die abwechselnd und in verschiedenen Konstellationen im Zentrum der Erzählung stehen, alle sehnen, was sie aufreibt und woran sie zu scheitern drohen, gründet letztlich bei jeder in den fundamentalen menschlichen Bedürfnissen von Freiheit und Geborgenheit. Jede Einzelne von ihnen sucht auf ihre Weise einen Platz in einer Welt, die genug Widerstände, Schmerz und Leid bereithält, dass man an ihnen zugrunde gehen könnte. Dass Waynes Protagonistinnen das nicht tun, liegt auch daran, dass sie letztlich trotz allen Bewusstseins einer Abhängigkeit von äußeren Umständen und trotz Phasen tiefster Verzweiflung und zermürbender Selbstkritik doch unermüdlich daran arbeiten, ihre eigene Geschichte mitzugestalten. Dabei ist der „room for one’s own“, den sich eine jede auf ihre Weise schafft, jedoch nur eine Etappe auf dem Weg zu einer hier ganz weit gefassten Form von Emanzipation. Denn ganz auf sich selbst zurückgeworfen gerät man schnell in einen Teufelskreis aus zerstörerischen Grübeleien, ist man den erlebten Verletzungen, Traumata und auch den eigenen Fehlern schonungslos ausgesetzt. Alle drei sind Einzelkämpferinnen, denen das Risiko der eigenen Verwundbarkeit näher ist als ihre Nächsten und die in einem mehr als holprigen Miteinander erst allmählich begreifen, dass ein Gegenüber, dem man vertrauen kann, unverzichtbar ist. So besteht die große Herausforderung darin, erst wieder neu zu lernen, sich einem anderen zu öffnen und zu vertrauen. Die Autorin zeigt diesen für alle überaus schwierigen Prozess auf eine glaubhafte und ganz wunderbare Weise, die einen auch immer wieder schmunzeln lässt.
Doch wer sind die drei Frauen, die sich hinter den Namen Vera, Lynn und Emilienne bzw. Emily verbergen? Ohne zu viel von der Geschichte vorwegzunehmen, kann man Vera als eine schöne, aber innerlich zerrissene, von ihrem Gewissen zerriebene und um ihr fragiles frisches Liebesglück bangende junge Frau beschreiben, die seit kurzem mit dem sehr gläubigen, streng christlich lebenden Luke liiert ist — eine aus moderner, aufgeklärter Sicht etwas ungewöhnliche Beziehung, die Vera jedoch geradezu als himmlische Rettung aus einer Vergangenheit betrachtet, in der sie einen folgenschweren Fehler begangen hat. Ihr Charakter ist ein bisschen nach dem biblischen Vorbild einer Maria Magdalena angelegt, die nach einer ausschweifenden Jugend nun eine moralische Kehrtwende unternimmt und sich mit aufrichtigem, aber immer wieder auch von Rückschlägen geplagten Einsatz zum Glauben hinzuwenden versucht. Zu dieser Kehrtwende gehört auch das Bemühen um eine gute Beziehung zu ihrer künftigen Schwiegermutter Lynn, was sich als ziemlich aussichtsloses Unterfangen herausstellt.
Lynn, die reiche, gebildete und inzwischen schwer erkrankte Witwe und Mutter zweier erwachsener Söhne kämpft — wie im Grunde schon ihr Leben lang — um ihre Autonomie und wehrt sich vehement dagegen, irgendeine Schwäche einzugestehen, weder gegenüber ihren Mitmenschen noch gegenüber sich selbst. Deshalb will sie auch auf keinen Fall, dass sich irgendwer um sie kümmert, schon gar nicht ihre so blutjung und kraftvoll mit allen Möglichkeiten im Leben stehende Schwiegertochter. Mehr pro forma protestiert sie anfangs auch gegen die ruandische Krankenpflegerin Emily, die sie erst einmal nur als Putzhilfe akzeptiert. Nach und nach begreift man beim Lesen die tiefere Ursache für die harsche Ablehnung ihrer Mitmenschen und die unter der Oberfläche deutlich knirschenden Beziehungen in ihrer Familie, nämlich ihr Hadern mit dem eigenen Lebensentwurf, der nie mit ihrem als junge Frau angestrebten Idealbild in Einklang zu bringen war. Um mit dieser Enttäuschung umzugehen, schafft sie sich ihren eigenen Raum der Kunst und entwirft an einem Ort, zu dem sie niemand anderem Zugang gewährt, expressive Gemälde. Ein weiterer Raum eröffnet sich ihr mit Emily, die sich in Bezug auf ihre eigene Geschichte noch verschlossener zeigt als Lynn. Doch genau darin liegt wohl der Schlüssel zu ihrer sich ganz behutsam anbahnenden Beziehung; wie zwei scheue Wildtiere zähmen die beiden sich gewissermaßen gegenseitig, mit äußerster Vorsicht und im Notfall jederzeit die Krallen ausfahrend oder die Flucht ergreifend.
Emilienne schließlich, die sich in England Emily nennt, hat es als einzige ihrer Familie, ja ihres Dorfes geschafft, dem brutalen Völkermord an den Tutsi zu entkommen: lebend, aber alles andere als unversehrt, körperlich und vor allem seelisch tief verwundet, versucht sie, an einem anderen Ort, weit entfernt von ihrer Heimat, die ihr keine mehr ist, ein neues Leben aufzubauen. Doch natürlich holt sie die Vergangenheit immer wieder ein, gegen die tiefen Traumata können ihre Verdrängungsstrategien nichts ausrichten. Denn wie soll sie sich eine Zukunft gestalten und neue Beziehungen zu Menschen knüpfen, wenn kein Vertrauen mehr übriggeblieben ist? Trotzdem versucht Emilienne in einem bewundernswerten Kraftakt, auf eigenen Füßen zu stehen und von niemandem abhängig zu sein. Für ihr kleines Londoner Zimmerchen arbeitet sie sich klaglos als Putzkraft auf und erwirbt sich nebenbei noch eine Qualifikation zur Krankenpflegerin. Dieser Weg führt sie dann auch zu Lynn, deren anfängliche Schroffheit ihr, die schon alles Menschen(un)mögliche erlebt und ausgehalten hat, nichts mehr anhaben kann, ja ihrem eigenen emotionalen Schutzwall sogar entgegenkommt:
Statt einer Antwort gab Lynn ein ungeduldiges Schnauben von sich und wedelte herablassend mit der Hand. „Angenehm mild heute“, bemerkte sie dann und spähte flüchtig aus dem Fenster, als wäre das Wetter und nicht ihr Gesundheitszustand der Grund dafür, dass sie hier saßen und miteinander Tee tranken, ungeachtet der Kluft zwischen ihnen — eine Kluft der Generationen, der Ethnien und der persönlichen Geschichten, die sie einander noch nicht offenbart hatten.
Wayne, Der silberne Elefant, S. 164
Jede Szene ist mit Bedacht konstruiert und genau beobachtet; psychologisch spannend und lebendig wird erzählt, wie es zwischen den Figuren immer wieder zu leichten Misstönen kommt und wie sich daraus größere Missverständnisse entwickeln. Tragikomisch wirken auch die stolpernden Versuche, den anderen zu verstehen oder sich dem anderen verständlich zu machen, die durch Vor-Urteile oder regelrechte Abwehr des anderen verkompliziert werden. Und doch zeichnen sich mehr und mehr gewisse Gemeinsamkeiten ab, die über die scheinbar unüberwindlichen sozialen, kulturellen und generationellen Unterschiede hinaus eine zwischenmenschliche Verständigung möglich machen. So erwacht eine leise Neugier am Gegenüber, der andere wird als Mensch mit einer eigenen Geschichte beachtet und geachtet:
Emily erfasste schlagartig, dass sie hier eine Frau vor sich hatte, die in zwei getrennten Welten lebte: eine, die man mit den Augen sehen konnte, und eine, zu der nur ihre Gedanken Zutritt hatten, in etwa so, wie Emily es von sich selbst kannte.
Wayne, Der silberne Elefant, S. 159
Aus der hier anklingenden Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdbild, das im Grunde den ganzen Roman beherrscht, bezieht die Autorin das Konfliktpotential und die Dynamik ihrer Erzählkonstruktion. So lehnt etwa Lynn ihre künftige Schwiegertochter Vera gerade deshalb ab, weil sie in ihr die Verkörperung des Ideals sieht, an dem sie in ihrem Leben gescheitert ist, scheint Vera doch wie selbstverständlich weibliche Schönheit und Attraktivität mit Selbständigkeit, Berufstätigkeit und Freiheit vereinbaren zu können. Im zusätzlichen Bewusstwerden ihres mit der Krankheit zunehmenden Autonomieverlusts bricht eine alte und nie verheilte Wunde in ihr auf: Sie, die einst emanzipierte Studentin, die Historikerin werden wollte, hatte stattdessen die Rolle der liebenden Ehefrau und Mutter übernommen. Lynns Schmerz und ihre Wut, die sich eigentlich gegen sie selbst richtet, rührt darin, dass sie sich entgegen ihrem jugendlichen Optimismus irgendwann doch zwischen zwei unvereinbaren Welten entscheiden musste. In ihrem eifersüchtigen Zorn übersieht sie dabei — und das ist der erzählerische Kniff, den Wayne mehrfach anwendet –, dass auch Vera alles andere als glücklich und frei ist, dass sie sich vielleicht sogar weitaus ähnlicher sind, als Lynn sich das vorstellen kann.
Durch den wechselnden Fokus auf die verschiedenen Figuren, das subtile Nebeneinander von Innenschau und Dialogen, von inwendig Gefühltem und nach außen Getragenem, gelingt es der Autorin, sowohl die individuellen Gefühle und Perspektiven erlebbar zu machen, als auch eine ästhetische Distanz zu wahren, die den Leser über das identifikatorische Mitgefühl mit den Figuren hinaus Zusammenhänge begreifbar macht, problematische Denk- oder Verhaltensweisen entlarvt, tieferliegende Ursachen erkennen lässt und auf diese Weise genau vor den vorschnellen Urteilen bewahrt, denen die Protagonisten immer wieder in die Falle gehen.
Wichtig erscheint es mir noch, auf die erzähltechnische Funktion des Genozids in Ruanda hinzuweisen, der über die Geschichte Emiliennes, die in einzelnen schockierenden und aufwühlenden, sehr intensiven Rückblicken in die Romanhandlung eingebunden ist. Emiliennes Schicksal, die Grausamkeiten, die sie erlebt hat, ihre Traumata, sind objektiv keinesfalls vergleichbar mit der Lebensgeschichte der gutsituiert in England aufgewachsenen Lynn. Doch da die Autorin den Frauenschicksalen auf einer subjektiven Ebene nachspürt, fügen sich die drei gänzlich unterschiedlichen Biographien eben doch zueinander und erlauben den Blick auf eine gemeinsame Herausforderung, der sich drei Individuen auf ganz unterschiedliche Weise und mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen stellen: Sie teilen die Gewissheit ihrer Verwundbarkeit, ihre Angst und zugleich Sehnsucht, Vorsicht und Misstrauen in Vertrauen umzuwandeln und sich einem anderen zu öffnen. Der silberne Elefant ist kein Roman, der den Konflikt in Ruanda historisch-kritisch aufarbeitet. Er enthält aber doch ein empathisches Sich-Annähern auf literarischer Ebene, mit den Mitteln der Fiktion, die dem Ausmaß der Gewalterfahrung vielleicht nur ansatzweise einen realistisch überprüfbaren Ausdruck verleihen kann, es dafür aber in eine individuelle Geschichte transformiert, die ihrer Heldin eine Stimme gibt und sie zu so viel mehr macht als einem Opfer.
Sie wusste nicht, woher dieser plötzliche Eifer kam; möglicherweise aus dem Antrieb heraus, etwas zu konstruieren oder zu rekonstruieren: ein Leben, eine Geschichte. Ein winziger silberner Elefant erinnerte sie flüchtig an ihre eigene Geschichte, an einen Park, den sie besucht hatte. Sie ließ ihn kurzerhand in ihrer Hosentasche verschwinden.
Wayne, Der silberne Elefant, S. 162
Genau das steht auch im Zentrum des ganzen Romans: in mehreren Varianten ein Leben, eine Geschichte zu konstruieren oder rekonstruieren, die uns Leser auf intelligente und erkenntnisreiche Weise unterhält und zugleich immer wieder innehalten und uns über den eigenen Lebensentwurf nachdenken lässt: darüber, wo er im Verhältnis zu den vielfältigen anderen möglichen Lebensentwürfen steht, welcher Grad an Autonomie, welche Grenzen der Freiheit unser Leben bestimmen und auf welche Weise wir unsere beruflichen und familiären Vorstellungen und Wünsche verwirklichen oder miteinander auszubalancieren verstehen.
Bibliographische Angaben
Jemma Wayne: Der silberne Elefant, Eisele Verlag (2021)
Aus dem Englischen übersetzt von Ursula C. Sturm
ISBN: 9783961611058
Bildquelle
Jemma Wayne, Der silberne Elefant
© 2021 Eisele Verlag in der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin