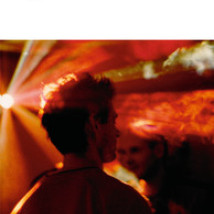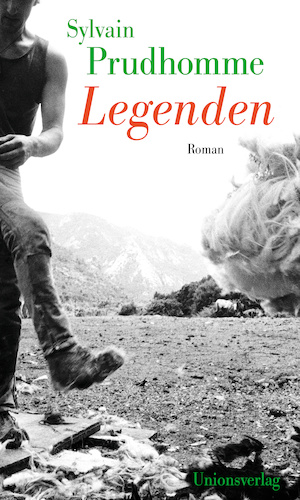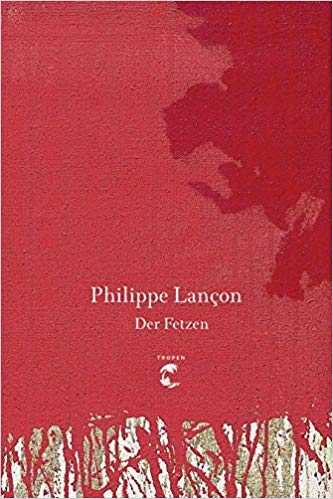Ich muss gestehen, ich habe Sylvain Prudhommes Roman ursprünglich vor allem deshalb angefangen zu lesen, weil sein Name meinem französischen Lieblingsdichter Sully Prudhomme so wundersam ähnelt. Mit dem übrigens nobelpreisgekrönten Dichter aus dem 19. Jahrhundert hat der französische Gegenwartsautor Sylvain Prudhomme, Jahrgang 1979, dessen jüngster Roman Par les routes kürzlich mit dem Prix Femina ausgezeichnet wurde, nun wirklich nicht im Mindesten etwas zu tun. Trotzdem habe ich diesem klanglichen Zufall eine wunderschöne literarische Entdeckung zu verdanken.
In Légende, 2016 in Frankreich erschienen, erzählt Sylvain Prudhomme zurückhaltend, feinsinnig und zugleich unheimlich intensiv von einer kargen Landschaft in der südfranzösischen Provinz, und entfaltet ausgehend von diesem lokalen Mikrokosmos eine Geschichte, die letztlich weit über die französische Grenze hinaus- und tief in die Vergangenheit hineinführt.
Getragen und in Bewegung gebracht wird der Roman durch die Geschichte einer noch jungen Freundschaft. Die Familienväter Nel und Matt haben sich über ihre Kinder kennengelernt und durch ihre geteilte Liebe zur Natur einen Draht zueinander gefunden. Nel ist Fotograf und fängt die raue, schroffe Schönheit von La Crau, der Gegend östlich von Arles, in der er aufgewachsen ist, in zahlreichen Landschaftsaufnahmen ein. Auch der Engländer Matt ist dem visuellen Medium verbunden, er plant einen Film über seine südfranzösische Wahlheimat, den er ausgehend von Gesprächen mit ihren Bewohnern, und natürlich auch mit Nel, entwickeln möchte.
In vielen Gesprächen, die Nel bisweilen fast zu intim werden, so dass er sich phasenweise aus der Freundschaft zurückzieht, entsteht so die Geschichte einer vergangenen Epoche voller Intensität, Freiheit und jugendlicher Grenzüberschreitung, deren Kehrseite mit den Begriffen Aids, Drogen, Gewalt und Tod aufwartet. Der Übergang vom Heute ins Gestern, die Rekonstruktion einer Familiengeschichte, die immer wieder sehr persönliche und bilderreiche Einblicke in das Frankreich der achtziger Jahre gibt, gelingt dem Autor dabei auf ganz unauffällige und sehr stimmige Weise.
Man erfährt von Nels Cousins Fabien und Christian, die nicht nur auf den kleinen Nel damals faszinierend gewirkt haben müssen, da sie so frei und anders zu leben schienen als man es in der französischen Provinz kannte. Fabien ist der Intellektuelle, der Selbständige, der Freigeist, der als Kind allein mit seiner Großmutter in Frankreich lebt, während seine Eltern und sein jüngerer Bruder am anderen Ende der Welt Schmetterlinge fangen und klassifizieren. Doch dann erkrankt Fabien an der damals neuen tödlichen Krankheit Aids. Sein Bruder Christian ist auf andere Weise ebenso hungrig nach Leben wie Fabien, er kann seine Leidenschaft für das Abenteuer zeitweise in der Natur ausleben, indem er in die Fußstapfen seines Vaters tritt und in Afrika unbekannten Schmetterlingen nachjagt. Doch lässt sich sein Verlangen allein dadurch nicht stillen, immer wieder provoziert er, wird handgreiflich und verfällt schließlich den Drogen. Ohne auf irgendeine Weise moralisch zu argumentieren, zeichnet Prudhomme ein ambivalentes Bild jener Zeit, er zeigt auch die beängstigende Seite einer Autonomie, die nicht vor Verletzlichkeiten schützt. Beide Brüder werden fast zeitgleich und in sehr jungen Jahren vom Tod eingeholt, der ihr exzessiv aber auch poetisch geführtes Leben grausam beendet.
Fast zwangsläufig, wenngleich eher skeptisch blickt Nel gemeinsam mit Matt auch in die eigene, ganz in der Provinz verankerte Familiengeschichte zurück. Seine Vorfahren lebten als Schäfer und Schafzüchter in enger Verbundenheit mit der Natur ein anspruchsloses, nomadenhaftes Dasein. Sein Vater entschied sich bewusst gegen die Tradition, indem er die Tochter von Landwirten heiratete und von da an einen Bauernhof bewirtschaftete. Doch der Region blieb er treu, genauso wie auch sein Sohn Nel durch seine Landschaftsfotografie der Heimat wie schicksalhaft verbunden bleibt. So führt uns Prudhomme mit seiner Erzählung behutsam vor Augen, dass man seinen Wurzeln trotz neuer Lebensentwürfe nie ganz entkommt.
Die Gegend von La Crau, ob Heimat oder Wahlheimat, ist letztlich auch die eigentliche „Hauptfigur“, das Zentrum, in dem die Geschichten von Nel und Matt, Fabien und Christian zusammenlaufen. Durch den Titel und ebenso auf den ersten Seiten der Erzählung wird diese Landschaft geradezu mythisch aufgeladen. Die Legende von Herakles, der sich hier einst, so wird es von Aischylos in dem nur fragmentarisch erhaltenen Stück Der gelöste Prometheus überliefert, dank einem von Zeus gesandten Steinregen gegen die riesenhaften Liguren verteidigen konnte, wird hier gleichsam als Ursprungsmythos der Region heraufbeschworen (vgl. Valéry Raydon: Le mythe de la Crau).
In der deutschen Übersetzung wurde vielleicht gar nicht zu unrecht der Titel Legenden im Plural gewählt, werden im Text doch weitere Legenden ausgegraben, um die herum sich Geschichten spinnen, wie die der verstorbenen Brüder oder der alten Diskothek, die damals eine Art symbolischer Mittelpunkt für die Jugend von La Crau darstellte. Schließlich taucht der Begriff „légende“ auch im Sinne einer Bildunterschrift auf, als Klassifizierung der von Christian und Onkel André neu entdeckten Schmetterlingsarten und wird auf diese Weise zu einem Symbol des Exotischen, zum Gegenpol der südfranzösischen Steinwüste, die letztlich doch alle Figuren wieder zu sich „nach Hause“ holt.
Die Geschichte ist einfach so wunderschön erzählt, so unaufdringlich und sensibel für die feinen Töne, dass sie ihren ganz eigenen Zauber entfaltet und man bald dem rauen, zerklüfteten Charme der Landschaft und seiner Bewohner verfällt.
Sylvain Prudhomme: Légende, Gallimard Collection Folio (2018)
ISBN: 9782072765124