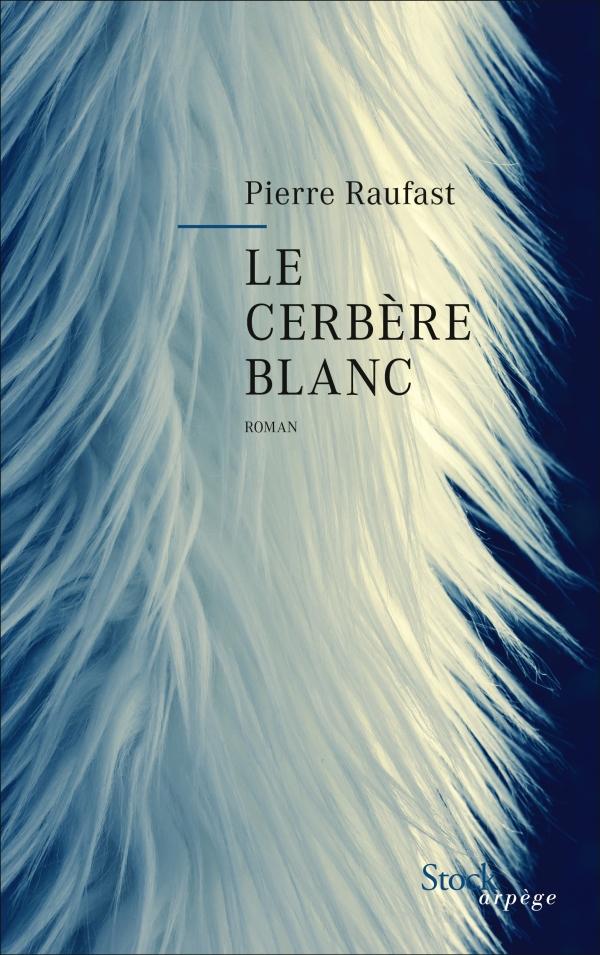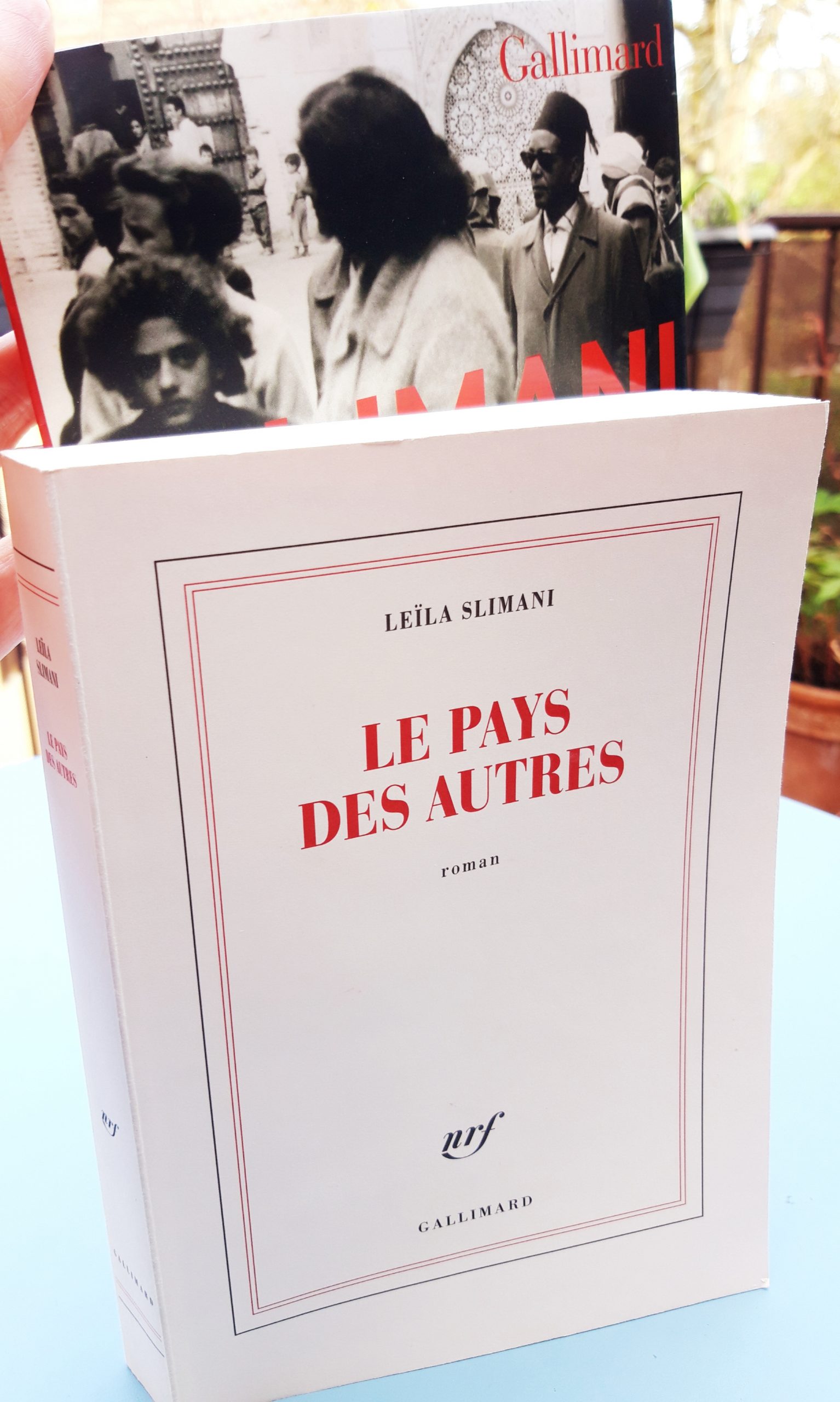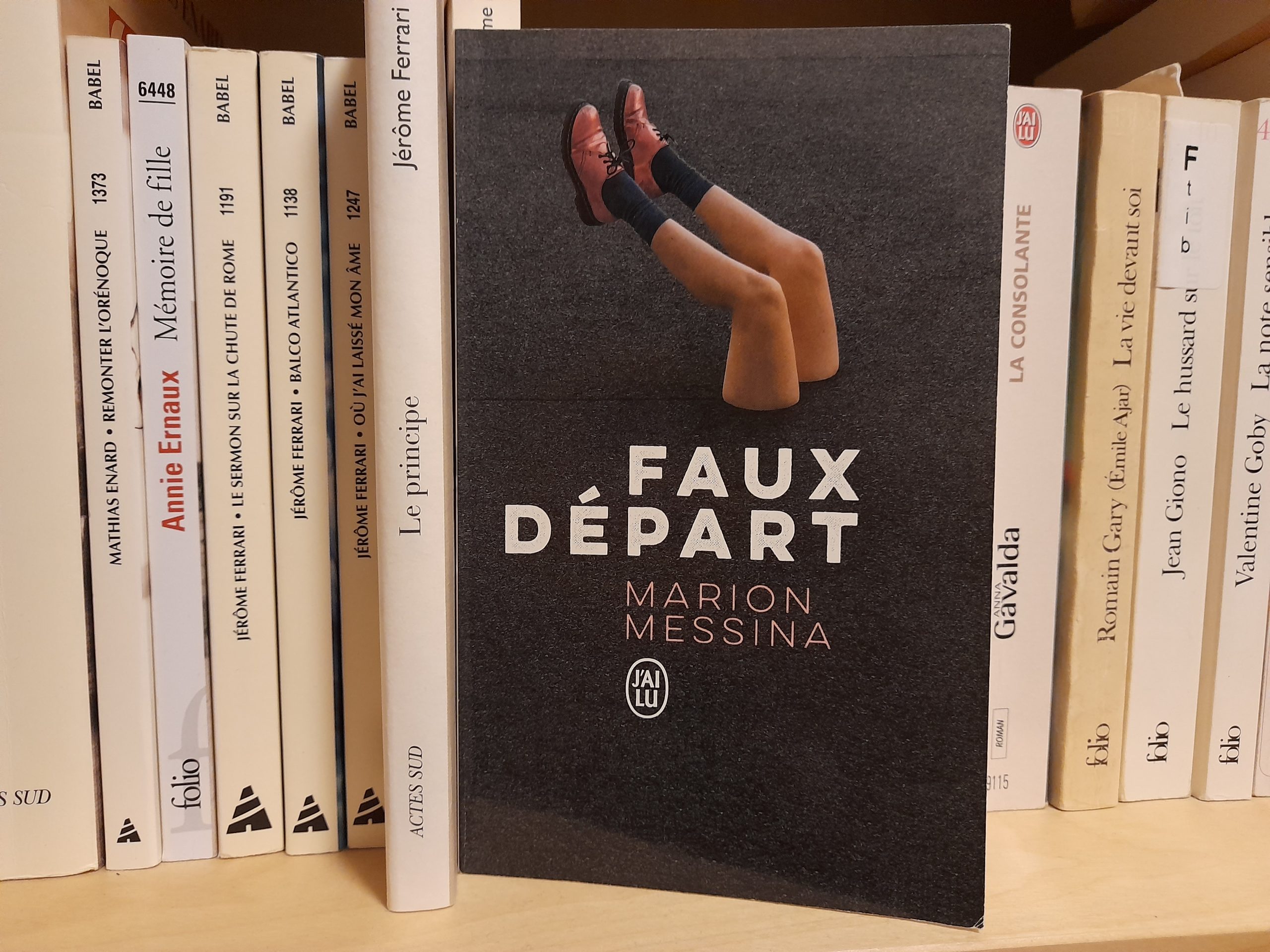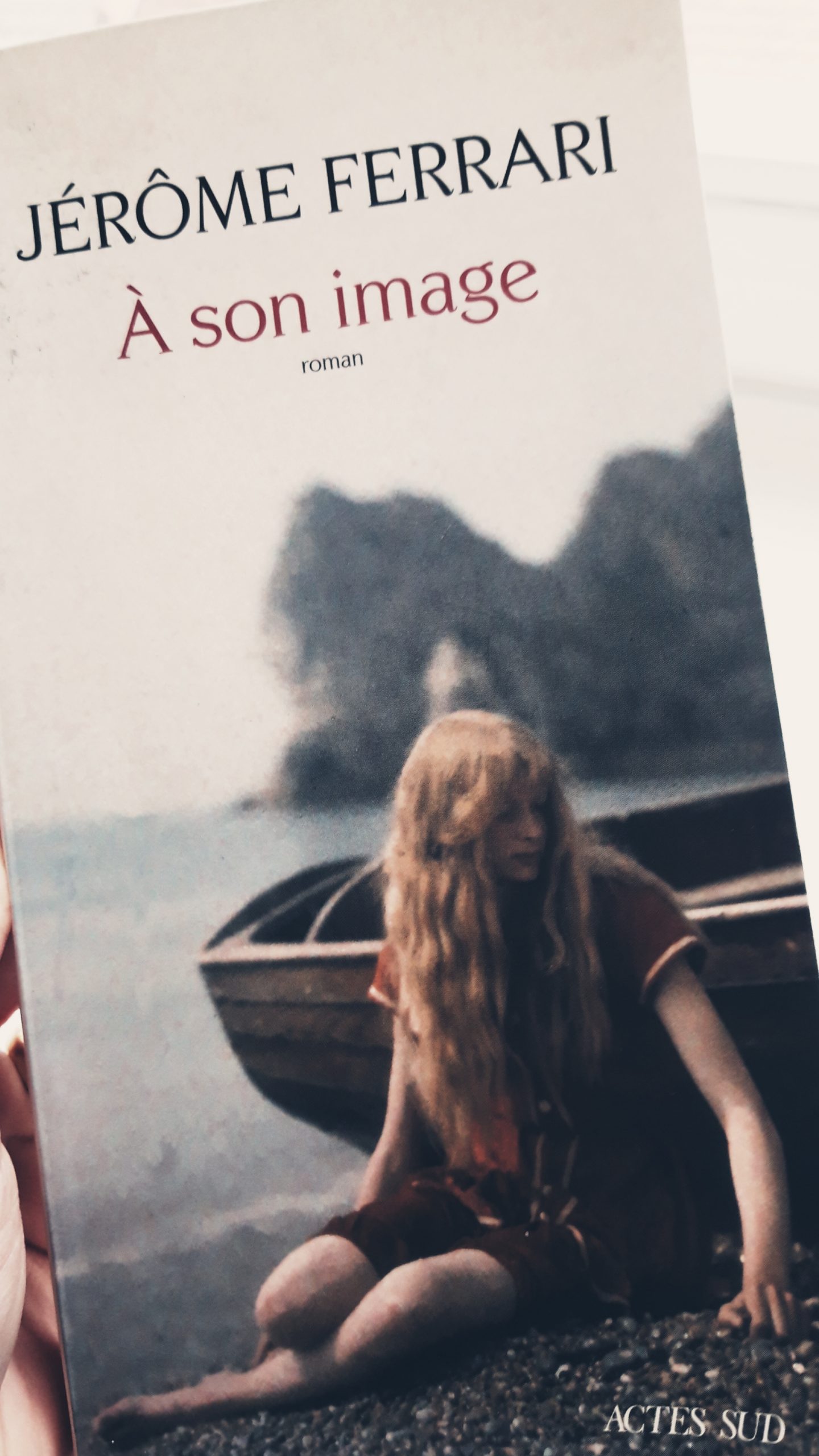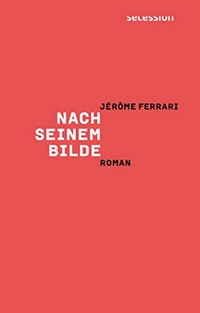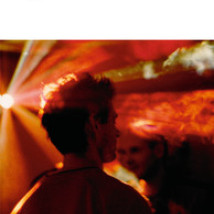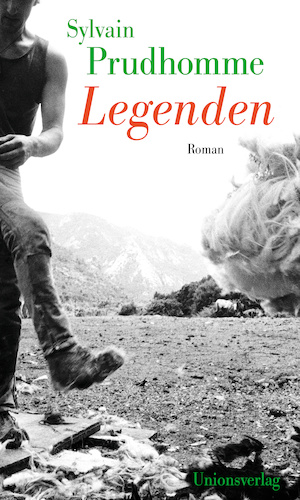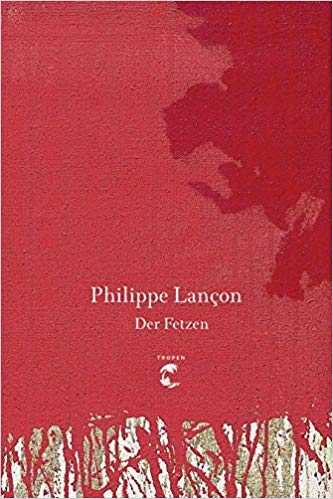Zwei gegensätzliche Gefühle durchfahren einen bei der Lektüre dieses unheimlich eindringlichen bzw. unheimlichen und eindringlichen neuen Romans der Französin Cécile Wajsbrot: der mehr als beunruhigende Schauder, dass diese Dystopie einer jede Erinnerung auslöschenden, Reflexion und Komplexität durch Unterhaltung und banale Eindeutigkeit ersetzenden Diktatur im Paris des 21. Jahrhunderts sich als Folge von Entwicklungen darstellt, die wir Leser selbst in unserer unmittelbaren Gegenwart wahrnehmen können, sowie das ehrfürchtige und hingerissene Staunen angesichts der Poesie und metaphernreichen Vielstimmigkeit der Sprache, die all die Zwischentöne kunstvoll heraufbeschwört, die in der fiktionalen Realität des Romans in Auflösung begriffen, der titelgebenden Zerstörung anheimgefallen sind.
Form und Inhalt greifen in diesem poetischen Meisterwerk ineinander. Das Thema des Romans spiegelt sich in der Erzählsituation, die bis zuletzt von Ambivalenz (bzw. Polyvalenz) durchdrungen ist. Mysterium und Zweifel sind dem allmählichen Verstehensprozess eingeschrieben, Hoffnung und Misstrauen wechseln einander ab. Die Erzählerin, oder besser Sprecherin, ist eine namenlose Frau, Schriftstellerin und Literaturliebhaberin, die allein in einer Pariser Wohnung lebt. Eine mysteriöse Organisation, die ihre Ziele geheimhält, hat sie telefonisch kontaktiert. Sie lässt sich rekrutieren, getrieben vom „aufrichtigen Wunsch, zu widerstehen, de[m] Wunsch, etwas zu teilen…“ (Zerstörung, S. 35) Denn Paris, ja ganz Frankreich, wurde von einer diktatorischen Macht usurpiert, die schleichend die Herrschaft ergriffen hat und nun das öffentliche und private Leben der Menschen immer weiter kontrolliert, überwacht, einschränkt, bereinigt. Persönliche Bilder werden beschlagnahmt, Bücher eingezogen, Namen getilgt, die Erinnerung an alles, was älter als zehn Jahre ist, ausgelöscht, das Stadtbild verändert, Häuser abgerissen, Museen, Theater und Bibliotheken gesperrt. Durch diese Bilder fühlt man sich unweigerlich an die Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts erinnert; droht sich hier die überwunden geglaubte Geschichte alptraumhaft zu wiederholen?
Die massive Zerstörung der traditionsreichen Stadt, ihre Verwandlung in eine einzige Baustelle, die ihren Bewohnern den Boden unter den Füßen entzieht, ist eine eindringliche Metapher, die das Bild des porösen, brüchigen, immer mehr Leerstellen und Abwesenheiten schaffenden Untergrunds mit dem fortschreitenden Verlust des kollektiven und individuellen Gedächtnisses zusammenbringt. Die andere Metapher, die das Buch leitmotivisch durchzieht, ist die der Sonnenfinsternis, die auch mit dem Raum der Nacht verschmilzt, aus dem heraus die Erzählerin spricht:
Ich bin in der Nacht — nicht nur in der mich umgebenden, die Sie gerne als einzigen Rahmen meiner Nachrichten sehen möchten (…), sondern auch in jener inneren, die meine sämtlichen Gedanken einhüllt.
Zerstörung, S. 31
Denn akustischen Kontakt zu ihren Auftraggebern hat sie nur des Nachts; der Kern ihres Daseins hat sich in die Dunkelheit verlagert, wenn sie über das Medium eines „Soundblogs“ eine Art Stimmen-Collage quasi ins Nichts hinein entstehen lässt. Dabei vermischt sich ihre eigene Stimme — suchend, fragend, zweifelnd, sich widerspenstig erinnernd — mit den Stimmen anderer namenloser Menschen, deren Gespräche sie aufgenommen und in ihren Text integriert hat. Dieses Sprachmaterial soll roh und unbearbeitet, nicht schriftlich fixiert und literarisiert sein, und bringt doch eine sehr literarische, ästhetisch-philosophische Textform hervor, die uns extrafiktionaler Leserschaft im zum Glück noch nicht verbotenen Medium Buch vorliegt. Allerdings ist man als Leser sehr versucht — und sollte sich unbedingt versuchen lassen –, sich den Text laut auf der Zunge zergehen zu lassen, erinnert die Form doch immer wieder an ein langes Prosagedicht.
Die Erzählerin erlaubt sich immer wieder kleine Akte des Widerstands gegenüber ihren Auftraggebern; so reist sie etwa unangekündigt nach Berlin, in dem noch kein diktatorischer Umsturz stattgefunden hat, vielleicht, weil hier die Erinnerung an die überwundenen Diktaturen der Nationalsozialisten und der DDR noch nicht ausgelöscht wurde? Dennoch kehrt sie in die Unfreiheit ihres eigenen Landes zurück, in banger Erwartung, am Widerstand teilnehmen zu können; und tatsächlich scheint die Widerstandsbewegung allmählich aus der Sonnenfinsternis herauszutreten, als stumme Menge, die ihr einvernehmliches Schweigen als womöglich einzig wirksame Waffe gegen die lärmende Diktatur einsetzt. Doch ist dieser von der ominösen Organisation diktierte Widerstand wirklich ein Widerstand, oder nur ein riesengroßer Fake, mit dem im Gegenteil jeder weitere Widerstand gebrochen wird?
Die große Faszination des Textes, seine poetische Kraft, beruht in der verdichteten Sprache, die niemals eindimensional ist, die Kehrseite eines Wortes immer mitassoziiert und viele weitere Schattierungen mitdenken lässt. Wenn etwa von den körperlosen Stimmen die Rede ist, die in der neuen Welt der Erzählerin bedeutsam sind, wird das mythologische Bild des in die Unterwelt hinabsteigenden Aeneas heraufbeschworen, und mit ihm der Tod, aber auch die Kraft des Gehörten, das frei von der sensationsheischenden Ebene des Visuellen ist; doch ebenso klingt in der Körperlosigkeit immer wieder auch die Entpersönlichung und Entmenschlichung, die Technisierung der Welt an. Ebenso zwiespältig ist die Anweisung der körperlosen Auftraggeber, die sich einen spontanen, ganz auf die Gegenwart gerichteten, vom Ballast der Tradition und der Künstlichkeit des Schriftlichen freien Text von ihr wünschen. Geht es ihnen um Befreiung oder nicht doch um Bereinigung? Entsteht so die Aufrichtigkeit des nackten, ungeschliffenen Gedankens oder eine ephemere, dem sofortigen Vergessen ausgelieferte Mündlichkeit, ein gedächtnisloser Abgrund, in dem wir uns verlieren?
Unbestreitbar ist, dass sich die Erzählerin trotz oder gerade durch den beengten Rahmen, der sie ganz auf sich selbst zurückwirft — „hier, in dieser Nacht, in der ich mit dem Widerhall meiner eigenen, wieder anders klingenden Stimme konfrontiert bin“ (Zerstörung, S. 98) –, auf das Wesentliche konzentriert und einen neuen und unverstellten Blick auf die Dinge freilegen kann. Und dabei spielt die allseits bedrohte und verpönte Erinnerung eine zentrale Rolle:
Die Menschen, die ich befrage (…) sind genauso verloren wie ich. Und in ihrem Verlorensein greifen sie oft auf die Vergangenheit zurück, auf ihre Erinnerungen. (…) um sich zu vergewissern, dass sie wirklich existieren.
Zerstörung, S. 54 f.
Die Stimmen, die sie aufnimmt und in ihre eigenen Gedanken einbaut, sind Stimmungs- und Diskursbilder des frühen 21. Jahrhunderts, und legen somit Zeugnis ab von einer Zeit, die unsere Gegenwart ist:
— Schließen.
— Davon war die Rede.
— Das Wort war allgegenwärtig.
— Die Grenzen.
— Die Türen.
— Sicherheit.
— Vorgeschobene Riegel.
— Schließen.
— Die Sache war allgegenwärtig.
— Aber man nannte sie In-den-Griff-Bekommen, Misstrauen.
— Und man sprach nicht von Intoleranz.
— Man sprach von Achtung.
— Achtung der Gesetze, des Rechts, des Territoriums.
— Nie der Person.
Zerstörung, S. 75
Stets ist diesen Stimm-Collagen eine hinterfragende, kritische Stimme eingeschrieben. Sie zeigen die Suggestions- und Manipulationskraft bestimmter Worte; verkümmerte, sinnentleerte, gewaltsame Parolen werden durch die stilistischen Operationen der Autorin als solche entlarvt und in ein vielschichtiges Klanggebilde eingebettet, das die hinter den vereinfachten Worthülsen und Slogans sich verbergenden Problematiken durchscheinen lässt. Jedoch ist dieses Unterfangen ein Wettlauf gegen die Zeit; die Distanz zwischen der Vergangenheit, welche die Stimmen evozieren, an die sie sich noch erinnern können, und der sich unaufhaltsam verabsolutierenden Gegenwart, die gedächtnislos in eine gewichts- und gesichtslose Zukunft steuert, nimmt immer mehr ab.
Die Erzählerin erkennt in diesen Diskursen, die unserer eigenen Gegenwart so unheimlich ähneln, im Nachhinein Symptome oder Zeichen, die die Zerstörung vorbereitet haben. Es geht um das Ausspielen der Sicherheit gegen die Freiheit, um Polarisierung, Gewalt, um Oberflächlichkeit und den Wunsch nach Vereindeutigung, um Rankings und Akkumulation statt Ästhetik, Reflexion und Komplexität, um steigendes Misstrauen, sinkende Solidarität, Beziehungslosigkeit und Virtualität:
— Man glaubte, mit der ganzen Welt in Kontakt zu sein. (…)
— Während man sich doch immer mehr hinter seinen Bildschirmen isolierte.
— Abschirmte.
Zerstörung, S. 156
Im Unterschied zu den Stimm-Kompositionen der Erzählerin ist das Stimmengewirr der virtuellen Netzwerke ein akkumuliertes Chaos, das zwar allerhand Warnungen hervorstieß, die man in dem dabei entstehenden Lärm jedoch nicht mehr wahrnahm. Es gab keine reflexive Distanz mehr, „so dass schließlich der Kommentar unmittelbar auf das Geschehen folgte, quasi gleichzeitig eintrat“. (Zerstörung, S. 188) All das schuf eine Atmosphäre der Zerstörung, die schließlich in der dystopischen Situation mündete, die in der Gegenwart des Romans längst eingetreten ist.
Auch wenn es ihr zunehmend schwerer fällt, schreibt bzw. spricht die Erzählerin gegen das Vergessen an und setzt auf diese Weise einen Verstehensprozess über die Frage in Gang, wie sich die Diktatur etablieren konnte und nach welchen Prinzipien sie funktioniert. Selbstkritisch hinterfragt sie auch ihr eigenes Verhalten und erkennt, dass sie zu leichtfertig war, auch in ihrem früheren Schreiben. Ihr Stil ist jetzt ein anderer, beim Sprechen, aber auch bei ihren neuen Schreibversuchen. Immer wieder schleicht sich auch ein Gefühl der Ohnmacht ein, steht die Frage im Raum, wann die Kräfte des Widerstands aufgebraucht sind, wie lange eine Extremsituation der Bedrohung und Ungewissheit den Einzelnen über sich selbst hinauswachsen lässt und wann sie ihn zerbricht. Mögliche Antworten findet man in dem im Roman omnipräsenten Kontext der Literatur(geschichte), aus der sich erhellende oder ermutigende Vergleiche schöpfen lassen. Solange man sich an die düsteren Zeiten, die bestimmte Literatur verboten, zensierten oder verbrannten, noch erinnert, kann man sich auch Beispiele von Schriftstellern ins Gedächtnis rufen, die trotz dieser Schikanen weiter geschrieben haben, von verfemten Werken, die sich einen festen Platz im Geist ihrer künftigen Leserschaft erobert haben. Zudem ist die Fiktion der Ort, an dem man über die Wirklichkeit hinausgehen kann:
— (…) Warum sollte man sich für Geschichten interessieren, die es nicht gibt, für Ereignisse, die nie passiert sind?
— Weil sie manchmal mehr Existenz haben als die, die passiert sind.
Zerstörung, S. 41
Die Literatur, so lautet vielleicht die zentrale Botschaft des Romans, ist wie die Erinnerung unabkömmlich für den Fortbestand einer Gesellschaft. Gedächtnis, Tod und Imagination sind dabei eng miteinander verwoben:
Auf Friedhöfen ist das Denken freier. (…) wo das Erinnern erlaubt ist, geht der Geist auf Reisen.
Zerstörung, S. 125
Hier ist Cécile Wajsbrot — Tochter polnischer Juden, die während des Nationalsozialismus nach Frankreich geflohen waren, der Vater kam in Auschwitz um — auch geprägt von ihrer eigenen Geschichte. Erinnerungsarbeit und der Umgang mit den Traumata der Geschichte sind Themen, die sie bereits in ihren Vorgängerromanen behandelt hat. In vielem erinnert auch das lyrisch-romaneske Ich ihres neuen Romans an die Autorin, die Komparatistik in Paris studierte, u.a. als Rundfunkredakteurin arbeitete und sich heute als Übersetzerin, Romanautorin und Essayistin dem Lesen und Schreiben widmet.
— Die Ereignisse wiederholen sich nicht.
— Oder vielmehr, ihre Form verändert sich, sodass sie nicht wiederzuerkennen sind.
— Oder vielmehr, man erkennt sie wieder — wenn es zu spät ist.
Zerstörung, S. 3
Der Roman mit seinem offenen, aber beunruhigenden Ende wirft viele Fragen auf, auch die nach der Verantwortung:
Wir dachten, die Dinge stünden schlecht, taten aber, als stünden sie gut, und waren anschließend erstaunt, dass sich nichts änderte.
Zerstörung, S. 85
Unsere Demokratie und unsere Freiheit haben keine Ewigkeitsgarantie, und ihre Unterhöhlung ist ein schleichender Prozess. Umso wichtiger ist es, auf die kleinen Diskrepanzen und Misstöne zu achten, um nicht irgendwann überrumpelt zu werden. Gerade das Feld der Sprache sollte man nicht unterschätzen. Worte können eine performative Kraft entwickeln, im Guten wie im Schlechten, und in der Ausdrucksweise spiegelt sich auch das gesellschaftliche Bewusstsein einer Gesellschaft:
— Endlich äußern wir uns.
— Ohne Filter.
— Also ohne nachzudenken.
— Lassen freien Lauf.
— Dem Hass.
— Dem Groll.
— Dem Offenkundigen.
— Das tut gut.
— Es ist befreiend.
— Wir meiden komplizierte Wörter. (…)
Zerstörung, S. 147
Einer solchen Verarmung und Verrohung der Sprache, die wir als „hate speech“, in Form der enthemmten Beleidigungen und vorschnellen Urteilsbildungen der sozialen Medien längst kennen, setzt die Autorin ebenso wie ihre Erzählerin die reflektierte, vielstimmige Poesie ihrer eigenen Sprache entgegen — eine résistance poétique:
So sprachen sie nicht, sie drückten sich einfacher aus, aber ich will ihre Worte hier nicht wiedergeben, ich lehne es ab, mich von ihrer Sprache anstecken zu lassen. (…) Hinter den besänftigenden Worten kam der Hass zutage, hinter den einvernehmlich gewordenen Ideen tauchte ihr ursprüngliches Ansinnen auf — die Zerstörung. (…) Ich habe angefangen zu schreiben (…), und ich lasse mich mit Genuss in die Windungen der Sprache gleiten, die von den Schriften der Vergangenheit genährt sind.
Zerstörung, S. 66-69
Cécile Wajsbrot: Zerstörung, Wallstein (2020)
Aus dem Französischen von Anne Weber
ISBN: 9783835336100