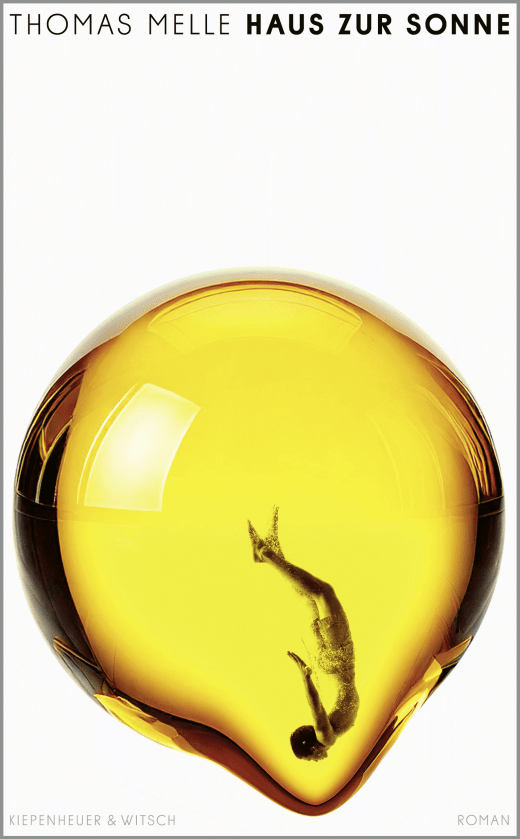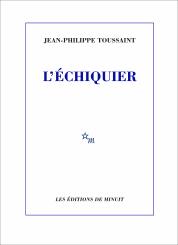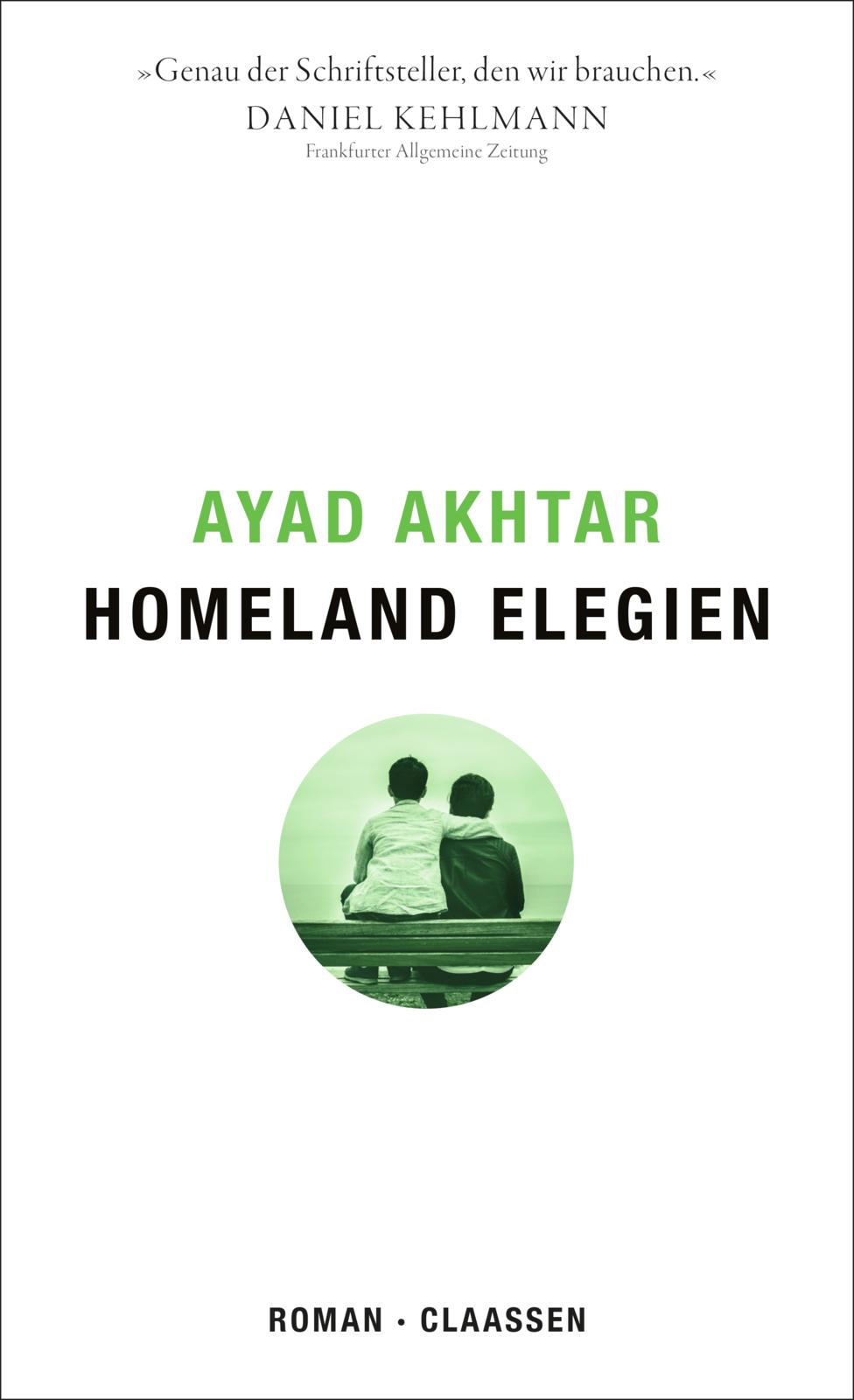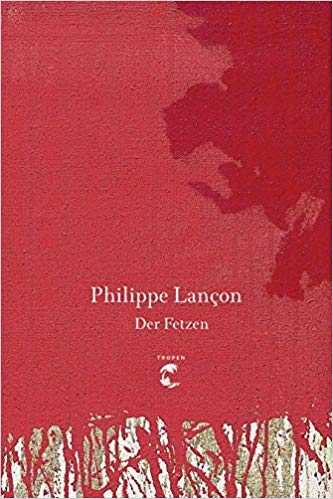Am Anfang des Romans steht ein faustischer Pakt. Nach einem Rückfall in die psychische Krankheit, der den Ich-Erzähler mit der Aussichtslosigkeit konfrontiert, sein Leben je wieder in Griff zu bekommen, entdeckt er auf dem Arbeitsamt einen etwas nebulös gehaltenen Flyer mit einem verlockenden Versprechen: Lebensmüde sollen eine letzte gute Zeit erleben, sollen vor einem assistierten Suizid noch einmal die Möglichkeit bekommen, es sich mit allen Mitteln der Medizin und Technik gut gehen zu lassen. Mit der Unterschrift des Ich-Erzählers ist es besiegelt; er bricht alle Kontakte zur Außenwelt ab und zieht ins so genannte „Haus zur Sonne“, dessen Name im Laufe der Geschichte, die immer alptraumhaftere Züge annimmt, sehr bald einen zynischen Beigeschmack bekommt.
Es geht in diesem Roman um alles, um Glück, um Leben, um Tod, um Krankheit, und darum, wie der Einzelne und wie die heutige Gesellschaft mit Tod und Sterben und Krankheit umgehen. Thomas Melles vielschichtiger Text ist Dystopie und Sehnsuchtsroman, ist ein wahrhaftes „Todesbuch“, wie Miriam Zeh es treffend im Deutschlandfunk formuliert hat, ist Autofiktion mit Thrillerelementen.
Trotzdem darf man den Ich-Erzähler hier nicht mit dem Autor gleichsetzen, wenngleich viel Autobiographisches in den Text mit eingeflossen sein mag, der wesentlich auf der Erfahrung am eigenen Leib und Geiste beruht, wie eine psychische Erkrankung ein Leben prägt und verändert. Seine bipolare Störung, die wechselnden Phasen von Manie und Depression, hat Thomas Melle schon vorher literarisch bearbeitet. Auch in Haus zur Sonne macht er ganz klar Literatur daraus, so dass man sich beim Lesen, anders als in vielen anderen als Autofiktion klassifizierten Romanen, nicht die Frage stellt, was denn nun „authentisch“ und was „hinzugedichtet“ ist. Man schlüpft vielmehr ganz unter die Haut des Roman-Ichs, das in seinem Erleben und in seinen Gedanken so nah und auch so komplex erzählt wird, dass, wie es in der Kunst eben möglich ist, das Allgemeine im Individuellen aufscheint.
Die erzählte Krankheitsgeschichte hat als Geschichte eines Rückfalls eine besondere Hoffnungslosigkeit, zumal der Rückfall so heftig erlebt wurde. In der letzten Manie sind Freundschaften zu Bruch gegangen, hat der Ich-Erzähler seine Wohnung ruiniert, sein Geld verprasst, ist polizeiauffällig geworden; in der sich anschließenden Depression hat sich ein tiefes Gefühl von Scham und Trostlosigkeit breitgemacht. Hinzu kommt die sehr rational wirkende Angst vor einem erneuten Rückfall. Und der Frust darüber, dass sein früheres Krankheitsbuch und damit sein verarbeitendes Schreiben sich als illusionär herausgestellt hat. Und dennoch schreibt der Erzähler erneut, er schreibt um sein Leben, radikal und schonungslos. Er schreibt einen Text, der nichts Aufbauendes hat, nichts Versöhnliches, seitenweise geht es um den Tod, richtig beklemmend ist die Todessehnsucht, die den Text zu grundieren scheint.
Doch während man den Ich-Erzähler beim Lesen allmählich immer besser kennenlernt, versteht man, dass er von einer Todessehnsucht mit Vorbehalt erzählt: Dieser ist der Kipppunkt, ist das Entscheidende, das Urmenschliche, das Unberechenbare, das die Dynamik des Romans bestimmt, die mehr und mehr an einen Thriller erinnert und einen beim Lesen wirklich mitnimmt. Mitnimmt in beiderlei Sinne: man ist gefesselt und erschüttert, durchgerüttelt; denn es geht in dieser Geschichte ums Ganze, es geht um Leben und Tod, um die conditio humana, um das, was man doch so gern verdrängt und weit nach hinten schiebt, mit dem wir beim Lesen konfrontiert werden und dem wir an keiner Stelle ausweichen können. Manchmal erinnert Thomas Melles Text an die Philosophie des Absurden, an Camus oder Beckett, immer wieder, angesichts der undurchsichtigen Strukturen im „Haus zur Sonne“, auch an Kafka, auf dessen kleine Fabel der Ich-Erzähler einmal anspielt.
Wie den Erzähler erfasst auch den Leser eine zunehmende Klaustrophobie, je weiter die Zeit im „Haus zur Sonne“ voranschreitet. Was genau man sich unter diesem Haus vorstellen soll, wissen auch seine Bewohner, die Patienten, die hier Klienten genannt werden, nicht genau. Ist es eine Klinik, ein Sanatorium, eine Versuchsanstalt, ein Fegefeuer? Wohlwollend könnte man es ein Hospiz nennen, das jedoch mit sehr eigentümlichen Palliativmaßnahmen aufwartet. Das sich in Menschenfreundlichkeit kleidende Angebot, dabei zu unterstützen, sich kurz vor dem Tod noch einmal Herzenswünsche zu erfüllen und ein Glück zu konsumieren, das in der „normalen“ Welt draußen unerreichbar schien, erweist sich als janusköpfig. Denn eingelöst werden soll dieses große Versprechen mit KI, mithilfe von Simulationen, die nach den geäußerten Wünschen des Klienten erstellt werden und ihn virtuell in seine Wunschwelt eintauchen lassen. Wenn man jedoch gar nicht weiß, was seine innigsten Wünsche sind, wird es schwierig, wie der Erzähler schnell feststellt. Auch bei abstrakten Wünschen wie Geborgenheit und Freiheit gerät die KI an ihre Grenzen. Beschwerden über Fehler und Unzulänglichkeiten der Simulationen häufen sich, und der Verdacht drängt sich auf, dass die so genannten Klienten nichts anderes sind als Lebendmaterial in einer großen Versuchsmaschinerie. Jenseits der stets ein Gefühl des Ungenügens zurücklassenden Glückssimulationen wählt der weiterhin an Depression leidende Erzähler folgerichtig immer wieder auch Simulationen des eigenen Sterbens, probiert auf diese Weise verschiedene Todesarten aus. Das mag makaber anmuten, knüpft aber zugleich an bestimmte Selbsttechniken der Kultur- und Philosophiegeschichte an, in denen es darum geht, sich mental auf den Tod vorzubereiten, ihn zu imaginieren. Überhaupt durchzieht den Text ein schwarzer Humor, der genauso gut ins Alptraumhafte wie ins Absurde und ins Philosophische gleiten kann.
Im Text ist der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Simulation mit dem Wechsel vom Präteritum ins Präsens markiert; ansonsten werden diese beiden Wahrnehmungsebenen für den Erzähler, und auch für den Leser, immer schwerer zu unterscheiden, geht es im „Haus zur Sonne“ doch letztlich um nichts anders als darum, eine künstliche Realität für seine Insassen zu erzeugen. Was ist echt, was ist fiktiv? Was ist geträumt, was ist medikamenteninduziert, was ist simuliert? Der Erzähler beginnt zu zweifeln, an seiner eigenen Wahrnehmung und an den ihm immer unheimlicher werdenden Methoden des Hauses. Im Verlauf des Romans schwankt er auf teilweise extreme Weise in der Beurteilung dieser Methoden, mal lässt er sich auf sie ein, mal schreckt er vor ihnen zurück, entwickelt Fluchtreflexe. Ein vergleichbar großes Pendel schlägt in seinem Inneren zwischen Hoffnung und Angst, Auflehnung und Resignation, Versöhnung und Niedergeschlagenheit; dabei werden diese hin und herpendelnden Gefühlszustände sprachlich in feinsten Nuancen eingefangen. So gut wie nie verliert der Ich-Erzähler jedoch seinen kritischen Blick, auch wenn er sich in manchen Momenten der Illusion hingibt, dass hier wirklich etwas zu seinem Wohl getan wird und das „Haus zur Sonne“ nicht nur eine virtuell aufgehübschte Verwahr- und Todeszelle für die untauglichen Elemente der Gesellschaft ist. Doch auch wenn die Lage aussichtslos ist und auch wenn angesichts des Todes auf Erden alles nur Fiktion ist, so möchte der Erzähler diese wenigstens selbst bestimmen. Und so ändert er am Ende, so viel darf man verraten, wie die kleine Maus in der Fabel die Laufrichtung.
Bibliographische Angaben
Thomas Melle: Haus zur Sonne, Kiepenheuer & Witsch 2025
ISBN: 9783462004656
Bildquelle
Thomas Melle, Haus zur Sonne
© 2025 Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co KG, Köln